-
 [Story]Durch einen Spiegel ein dunkles Bild (remastered)
[Story]Durch einen Spiegel ein dunkles Bild (remastered)
Durch einen Spiegel ein dunkles Bild
Vorwort
Wie kaltherzig muss man sein, sein Baby, in ein paar Lumpen gehüllt, einfach am Straßenrand liegen zu lassen?  Dieses Schuldgefühl habe ich seit Jahren meiner Erstlingsgeschichte im Forum gegenüber, „Durch einen Spiegel ein dunkles Bild“. Irgendwie bin ich damals in eine Sackgasse geraten, die Erzählfäden waren durcheinandergeraten, der Falke davongeflogen. Aber es hat mir immer Leid getan, denn, nun ja, ich mochte die Geschichte um Morgan und Jenna wirklich. Also will ich sie noch mal erzählen, neu überarbeitet, etwas gestrafft (wer hätte das nicht gern?) und ohne die ganz peinlichen Stellen, die John immer zum Lachen gebracht haben. Dieses Schuldgefühl habe ich seit Jahren meiner Erstlingsgeschichte im Forum gegenüber, „Durch einen Spiegel ein dunkles Bild“. Irgendwie bin ich damals in eine Sackgasse geraten, die Erzählfäden waren durcheinandergeraten, der Falke davongeflogen. Aber es hat mir immer Leid getan, denn, nun ja, ich mochte die Geschichte um Morgan und Jenna wirklich. Also will ich sie noch mal erzählen, neu überarbeitet, etwas gestrafft (wer hätte das nicht gern?) und ohne die ganz peinlichen Stellen, die John immer zum Lachen gebracht haben.
Ich will niemanden mit altem Wein in neuen Schläuchen langweilen, aber einerseits gibt’s es seit 2009 ziemlich viele neue Gesichter im Forum, und andererseits, naja, wenn ich mit meiner Geschichte einem der Alteingesessenen oder gar Eingeborenen hier die Zeit an einem langen Herbst- oder Winternachmittag vertreiben kann, wieso eigentlich nicht? Seid also herzlich eingeladen zum Neu- und Wiederlesen, gebt mir die Hand und folgt mir…dahin, wo es dunkel ist.
Kapitel
Zum PDF hier lang!
Geändert von MiMo (29.03.2017 um 21:56 Uhr)
-
I. Licht und Finsternis
Es war eine sternenklare Nacht, eine der ersten, die die junge Welt gesehen hatte. Tausende von kleinen Lichtpunkten überzogen den dunklen Himmel, wie achtlos auf schwarzen Samt gestreute Brillanten, und zeigten die Bilder künftiger Helden und Schlachten. Von Norden blies ein kühler Wind über das Gebirge und im fahlen Silberschein des Mondlichtes wogten die Äste wie die Wellen eines Meeres, das Rauschen der Blätter erfüllte die Luft wie Flügelschläge unzähliger, unsichtbarer Geschöpfe.
Es war das einzige Geräusch, denn eine gespannte Stille lag über dem Wald. Unterhalb der mächtigen Baumkronen waren noch immer die nächtlichen Jäger auf der Pirsch. Raubechsen strichen durch die Dunkelheit, um dem Wild aufzulauern, das unvorsichtig in das Revier der mächtigen Jäger eingedrungen war.
Der Morgen war nicht mehr fern und im Osten verblassten die ersten Sterne. In die Geräusche der Nacht mischte sich das erste Zwitschern der Vögel. Mit sanften Fingern berührte das erste, rosige Licht den Himmel. Das Samtschwarz verblasste zu dunkelblauer Wasserfarbe. Ein neuer Tag brach an, und das samtige Dunkelviolett des Himmels über dem Wald verwandelte sich in Blau. Das milde Licht des Morgens ließ die Luft wie aus Seide erscheinen. Der Wind trug unzählige Düfte mit sich, Orchideen, Jasmin, Flammenbeeren.
Es wurde heiß, und ein rauchiger Bodennebel lag in den Tälern der neu geborenen Insel. Eine gelbe Raupe kroch über ein großes grünes Blatt und warf einen Schatten hinter sich. Ein Geschöpf mit zähen, häutigen Flügeln stieß aus den Baumkronen hinab, packte die Raupe mit seinem hornigen Schnabel und schoss über dem Wasser dahin, das sich in einem schmalen Bett schäumend und strudelnd durch die Wildnis dieser neuen Welt wälzte. Der Strom donnerte und brauste unter ihm dahin, als ein riesiger, rosasilbriger Fisch in unglaublich hohem Bogen aus dem Wasser schnellte, nach dem geflügelten Jäger schnappte und ihn in das glitzernde Wasser riss.
Vögel kreisten am Himmel und kreischten heiser, erst nur ein oder zwei Dutzend, dann immer mehr, schließlich so viele, dass dichte Vogelscharen die Sonne verdunkelten. Ein zartgliedriges Tier mit braunem kurzem Fell brach durch das Dickicht und floh nach Südosten.
Etwas würde geschehen.
Wieder raschelte es im Gebüsch, und weitere Tiere rannten und sprangen davon. Die Vogelschwärme flogen kreischend gen Süden. Dann trat Stille ein wie vor einem bösartigen Gewittersturm, wenn sich der Wind völlig legt und die Luft eine unheimliche, widernatürliche Farbe annimmt.
Die Sonne hing am Himmel wie eine geschmolzene Münze, ein brennender Kreis, umgeben von märchenhaft schillernden Ringen.
Etwas verdrängte die Stille.
Der Himmel wurde dunkler und nahm einen seltsamen Grünton an, und vom westlichen Horizont näherte sich rasch ein dunkles Gebilde, das ständig größer wurde.
Es war eine stetige, leichte Vibration, die eher zu fühlen als zu hören war und allmählich stärker wurde. Sie hatte keinen Klang. Es war nur ein seelenloses, tonloses Geräusch.
Auf den zartgrünen Blättern der üppigen Pflanzen erschienen helle und dunkle Streifen, dann wurde es noch dunkler und merklich kühler, Blüten schlossen sich, die Sonne verdunkelte sich und ihr Rand leuchtete zwischen den Mondbergen und -tälern hindurch wie Perlen auf einer Schnur.
Die Vibration wurde stärker und stärker und bekam eine Stimme – ein tiefes, rollendes Dröhnen, das zu einem zerschmetternden Crescendo anschwoll.
Dann flammte die Sonnenkorona auf, die den schwarzen Mond umhüllte, und gleichzeitig schienen die Wolken in rotem Feuer zu leuchten, das von oben auf sie hereinbrach. Ein breiter Strom von bedrohlichem Tiefrot, das sich zu einem grellen, dünnen Strahl bündelte. Es kam Wind auf, ein heißer, sengender Wind. Als der Lichtstrahl den Boden berührte, folgte eine alles zermalmende Erschütterung, ein blendendes Feuer, und eine gewaltige Rauchwolke stieg aus dem gigantischen Krater hervor, der sich tief in den Fels gegraben hatte. Der Wind trieb den Geruch des brennenden Waldes vor sich her und der Rauch verhüllte alles Grün und Rot und Grau des Tages.
Irgendwann, als der Mond weitergezogen war auf seiner ewigen Reise, schimmerte die Sonne durch den Rauch auf die Insel herab. Später würde es regnen, und der Krater würde sich mit dem Regenwasser füllen. Seerosen würden dort wachsen und was nun dort unten war, würde eine Zeit lang schlafen. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: Der siebte Tag.
Geändert von El Toro (05.08.2013 um 08:40 Uhr)
-
II. Morgan. Wieder in Khorinis
An einem Tag in Khorinis, der so heiß war, dass er ihm die Luft aus der Brust zu saugen schien, bevor sein Körper sie verarbeiten konnte, kam Morgan an das Tor der großen Hafenstadt. Es war Jahre her, seit er Khorinis zuletzt betreten hatte. Damals war er fast noch ein Kind gewesen, als er gemeinsam mit anderen Jungen auf einem großen Schiff der königlichen Flotte zum Festland übersetzte, um Rhobars Truppen gegen die Orks zu unterstützen.
Jetzt reiste er allein. Das Stadttor von Khorinis, das noch den Blumenschmuck eines Festes trug, stand einladend offen, aber die Stille dahinter passte ganz und gar nicht. Keine Hammerschläge auf einen schartigen Amboss, kein Knirschen von Wagenrädern, keine Händler, die ihre Waren feilboten, nicht mal einer dieser gottverdammten Prediger, die tagein, tagaus Innos oder Adanos priesen, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die einzigen Geräusche waren das Zirpen der Grillen, das Läuten einer kleinen, verträumten Glocke und ein Klopfen, wie auf dünnem Holz, als würde eine kleine Faust verstohlen an eine Tür pochen - oder an einen Sargdeckel.
Die Blumen am unbewachten Tor - unbewacht, wieso unbewacht? War Khorinis nicht dafür bekannt, dass es eine der wehrhaftesten Städte Myrtanas war? - waren bei näherem Hinsehen schlaff, ließen ihre Köpfe hängen und begannen in der Hitze übel zu riechen.
Morgan betrachtete das Tor nachdenklich: Es war erbaut worden, um unerwünschte Besucher fern zu halten, daran gab es keinen Zweifel. Eine solide Stadtmauer schloss Khorinis zur Landseite hin ab. Hinter dem Tor konnte Morgan etwas sehen, das wie eine völlig normale Straße aussah: ein Krämerladen, eine Schmiede, rechts ein Aufgang zur Oberstadt. Derweil das singende Zirpen und das Klopfen, wie eine Faust auf Holz.
Hier stimmt etwas entschieden nicht, dachte Morgan. Orks? Die waren seit Jahren besiegt, sowohl auf dem Festland als auch auf Khorinis. Der Zugang zum alten Minental war längst verschüttet, unpassierbar. Außerdem konnte er keine Spuren von Kampf oder Verwüstung erkennen. Auf seiner Reise von Jharkendar in den südlichen Teil der Insel hatte er Verwüstung gesehen, die die Orks zu verantworten hatten, aber die Schlachtfelder waren mittlerweile von Pflanzen überwuchert, unter Ranken und Winden zur letzten Ruhe gebettet.
Morgan trat unter dem welkenden Blumenschmuck hindurch in die Stadt. An dem Stand sollte ein Krämer stehen, der seine Raritäten feilbot, aber er war verlassen. Unter der alten Kastanie nebenan, eine Bank. Hier sollten alte Männer sitzen, die über den König, die Schifffahrt und die Jugend schimpften, aber dort saß niemand. Unter der Bank lag, von einer unachtsamen Hand fallen gelassen, eine Ahle. Die Fenster der Schmiede waren dunkel und kein Rauch stieg aus dem rußigen Kamin auf. Eine der Türen der Tischlerwerkstatt war herausgerissen worden und lehnte an der Wand des Gebäudes. Sie war mit einer rostfarbenen Substanz bespritzt, die Farbe sein konnte, aber wahrscheinlich keine war. Rechts von der Schmiede führte eine kleine Passage zu einem weitläufigen Platz. Morgan sah das Skelett eines ausgebrannten Gasthauses. Das Feuer musste an einem Regentag ausgebrochen sein, sonst wäre die ganze Stadt in Flammen aufgegangen; eine große Volksbelustigung für alle, die noch in der Lage waren, es zu sehen. Das Heiligtum Adanos’ war verlassen, aber kaum beschädigt. Es war ebenfalls mit Blumen geschmückt, die zwar schlaff und trocken, aber noch nicht ganz verdorrt waren. Als Morgan näher trat, sah er, was das Läuten verursachte. am Schrein Adanos’ war eine Kordel in einem langen, durchhängenden Bogen befestigt worden. Etwa ein Dutzend kleine, silberne Glöckchen hingen daran. Obwohl die drückende Hitze kaum durch ein Lüftchen bewegt wurde, reichte bereits der Hauch der See aus, dass die Glöckchen nie ganz verstummten.
„Hallo Khorinis“, rief Morgan in die Stille, aber außer den Glöckchen und den Grillen gab es keine Antwort darauf. Doch, es folgte wieder das leise Klopfen auf Holz, dessen Ursprung Morgan nicht ausfindig machen konnte. In diesem Augenblick wurde er von dem beklemmenden Gefühl überwältigt, beobachtet zu werden. Es war so stark, so körperlich, dass sich die Härchen in seinem Nacken aufrichteten. Er wandte sich um, aber ihm war bereits klar, dass die Augen der Beobachter unsichtbar sein würden. Morgan ging in die entgegengesetzte Richtung. Eine Festung, möglicherweise das Quartier der Stadtmiliz, ragte in den trüben, heißen Himmel. Die Treppe zur Festung war mit derselben rostfarbenen Flüssigkeit bespritzt, die er schon an der Tür der Tischlerwerkstatt bemerkt hatte. Schweiß lief an Morgans Hals hinab. Er stieg die Stufen hinauf und gelangte in einen Innenhof. Die Waffen der Miliz waren ordentlich in ihre Ständer gestellt worden. Mehrere Türen führten in verschiedene Flügel der Burg. Morgan entschied sich für die Tür zu seiner Linken und öffnete sie, während ihm Schweißtropfen in die Augen liefen. Als er die Tür aufstieß, entwich heiße, abgestandene Luft wie mit einem Seufzen aus dem Raum. Atmen schien ihm unmöglich, er konnte nur von der heißen Schwüle nippen. Das leise Summen von Fliegen war das einzige, aber umso verräterische Geräusch hier drinnen. Er folgte dem Summen durch eine weitere Tür. Das Gefängnis von Khorinis bestand aus drei Zellen, die geräumig waren und auf den ersten Blick leer schienen. Er sah ein Paar schmutziger Lederstiefel mit aufgeplatzten Nähten, die ebenfalls rostrot gesprenkelt waren. Die Pritsche war durchtränkt damit, und Morgan hatte mehr als berechtigte Zweifel daran, dass es sich nur um Farbe handelte. Hier labten sich die Fliegen, die er gehört hatte. In der Ecke stand ein Bücherpult, darauf eine in rotes Leder gebundene Kladde. [/i]Register[/i] stand in geprägten Buchstaben darauf. Der letzte Eintrag lautete: Knives, Bürger von Khorinis, Dieb zur Verurteilung. Die Tinte war frisch, so frisch wie die klebrige Lache unter der Pritsche.
Wer auch immer Knives gewesen war, er schien die Lichtung am Ende seines Weges erreicht zu haben. Als er in den Innenhof und von dort aus der Festung hinaustrat, hörte er wieder das leise Klopfen. Es schien von links zu kommen, vom berühmten Marktplatz von Khorinis. Zwischen den verlassenen Ständen, auf denen Äpfel in der Hitze des trüben Tages zu Zerrbildern ihrer selbst anschwollen und den Platz in gasig süßen Gestank hüllten, stand ein Wassertrog, den bis vor kurzem ein metallenes Rohr gespeist hatte. Das Rohr lag nun unbeachtet neben dem Trog, denn Morgans ganze Aufmerksamkeit lag jetzt auf dem Bein in dem angenagten Stiefel, das aus dem Trog ragte. Angenagt hatte den Stiefel ein räudiger Wolf, der versuchte, das lederne Hindernis, das ihm den Zugang zum Fleisch verwehrte, von dem grässlich steifen Bein zu zerren. Es war ihm nicht gelungen, denn das Bein musste in der Hitze so angeschwollen sein, dass der Stiefel sich nicht ablösen ließ. Dabei stieß der Stiefelabsatz immer wieder gegen den hölzernen Trog und erzeugte das leise Klopfen.
Morgan legte einen Pfeil auf die Sehne seines Bogens und zielte auf den Kopf des Wolfs, zögerte und überlegte es sich dann anders. Er ruckte den Bogen leicht nach links, und der Pfeil surrte eine Handbreit an der Schnauze des Tiers vorbei. Der Wolf warf sich herum und starrte ihn aus einem gelben Auge wütend an. Das andere Auge war vor langer Zeit einem Kampf zum Opfer gefallen, die leere Höhle war bereits schwarz und zu einem runzeligen Schlitz zusammengeschrumpelt. Morgan fischte einen weiteren Pfeil aus dem Köcher und zielte auf das Tier. Der Wolf trabte in holprigem Galopp zum Stadttor. Seine Vorderpfote musste gebrochen sein, und der Anblick tat Morgan in den Augen weh - und ein wenig auch im Herzen.
Widerstrebend wandte sich Morgan dem Wassertrog und dem Bein zu, das in einem unnatürlichen Winkel aus dem Trog ragte. Die Leiche lag bäuchlings in dem flachen Wasser, das sich in der Hitze in einen ganz besonderen Fleischeintopf verwandelte. Morgan atmete tief durch, versenkte seine Hände in dem fast siedenden Wasser, packte zu und bat inständig, dass der Körper des Toten nicht auseinander fallen möge wie eine schlampig gefertigte Puppe.
Mit einem Ruck drehte er die Leiche um. Die milchig weißen Kugeln, die vor kurzem noch Augen gewesen waren, starrten in den milchig weißen Himmel. Er versuchte, die Augen des Toten zu schließen, aber die Augäpfel waren durch das warme Wasser so aufgequollen, dass es Morgan nicht gelang, die Lider weiter als bis zur Hälfte zu senken. Und mehr konnte Morgan nicht für den Jungen tun, der sein Leben im Wassertrog des Marktplatzes von Khorinis hatte beenden müssen.
Er hatte genug gesehen. Er wandte sich um und unterdrückte mühsam den Impuls zu rennen. Er lief wieder vorbei an dem ausgebrannten Gasthaus, vorbei an der verlassenen Schmiede zum Stadttor. Er dachte an den toten Jungen auf dem Marktplatz, den seine Mutter niemals wieder in die Arme schließen würde, er dachte an den mageren, verkrüppelten Wolf, als ihn eine kleine Bewegung, die er im Augenwinkel wahrnahm, aus seinen Gedanken riss. Morgan fuhr herum. Wenige Augenblicke der Sentimentalität hatten offenbar ausgereicht, die zunehmend schrillen Alarmzeichen, die sein Instinkt seit Betreten der Stadt aussandte, in den Hintergrund zu drängen. Deshalb reagierte er nicht sofort, wie ein erfahrener Herumtreiber hätte reagieren müssen. Und dieser winzige Augenblick sollte ihm zum Verhängnis werden. Morgan schien es, als würden sämtliche Nervenstränge seines Körpers in höchster Anspannung vibrieren. Er konnte sie förmlich in seinem Inneren summen hören. Hektisch sah er sich nach dem Verursacher dieser kleinen, verstohlenen Bewegung um, sah aber nichts außer der verlassenen, stillen Stadt, die in der weißen Hitze des Tages dalag.
Ein dröhnendes Rasseln zerriss die Stille, als das Gitter des Stadttors hinter Morgan herunterfiel. Die Seile, an denen es wohl tausendmal heruntergelassen worden war, mussten einfach durchgeschnitten worden sein; die blank gescheuerten Spitzen, in denen das Gitter am unteren Ende auslief, hatten winzige Splitter aus dem Kopfsteinpflaster geschlagen. Morgan rannte Richtung Osttor, das er am Marktplatz gesehen hatte, doch aus den Ecken und Winkeln der Stadt lösten sich Gestalten und formierten sich zu losen Reihen, wie Treiber, die versuchten, Niederwild oder Vögel aufzuscheuchen. Ihre Haut hing in schwarzen faulenden Fetzen von ihren Gliedern. Einer von ihnen hatte ein großes, ausgefranstes Loch in Wange und Morgan konnte tatsächlich die Kiefermuskeln hirnlos mahlen sehen. Das Geschlecht der Kreaturen war schwer zu schätzen, aber was für eine Rolle hätte es auch gespielt? Mit gebückter, zielstrebiger Langsamkeit schlichen sie dahin, wie Leichen, die Beliars Magie wiederbelebt hatte. Ihre Arme baumelten schlaff an ihren Schultern, aber die knotigen Hände umklammerten Keulen, die mit rostigen Nägeln gespickt waren, schwere Äste oder Tisch- und Stuhlbeine. Was auch immer in Khorinis geschehen war, es musste unheilige Magie gewesen sein.
Morgan hob seinen Bogen und richtete ihn auf die Kreatur mit dem Loch in der Wange. Nun konnte er das Schlurfen ihrer Füße im Staub der Stadt hören und das verschleimte Röcheln ihres Atems. „Bleibt stehen, wo ihr seid! Nehmt euch in Acht vor mir, wenn ihr den Abend noch erleben wollt!“ rief Morgan mit einer Stimme, die nicht ganz so fest war, wie er es sich wünschte. Das Wesen mit dem Loch in der Wange betrachtete Morgan mit einer Gier, die ebenso grauenerregend wie unmissverständlich war, aber es blieb stehen. Das Ding, das neben ihm gegangen war - etwas mit einer schmutzigen roten Samtjacke und nässenden Schwären am Hals -, warf das Stuhlbein, das es in der Hand hatte, verfehlte Morgan aber knapp.
Der Pfeil, mit dem Morgan auf das Wesen gezielt hatte, löste sich von der Sehne. Der Sand, den das Geschoss aufgewirbelt hatte, als es haarscharf vor den Füßen der Kreatur in den Boden einschlug, prasselte auf zerfetzte Überreste von etwas, das einmal ein eleganter Schuh gewesen sein mochte.
Die Gestalten flohen nicht wie der Wolf. Sie starrten ihn nur mit ihrer dumpfen Gier an, während ihre seltsam verzerrten Schatten sich hinter ihnen auf dem Boden abzeichneten.
Als Morgan seinen Bogen ein weiteres Mal spannte, machte einer von ihnen - ein Ding mit tonnenförmiger Brust und dem schlaffen Gesicht eines Toten - einen Sprung vorwärts und gab mit schriller, seltsam kraftloser Stimme eine Art Gelächter von sich. Er schwang etwas, das wie ein aus dem städtischen Galgen herausgebrochener Balken aussah.
Morgan schoss. Die Brust der Kreatur stürzte ein wie ein baufälliges Dach, als der Pfeil sie durchbohrte. Das Wesen taumelte rückwärts, versuchte, das Gleichgewicht zu halten und griff sich mit der freien Hand an die Brust. Dann stürzte es hin und gab ein eigentümliches, einsames Röcheln von sich.
„Wer will der Zweite sein?“ rief Morgan mit donnernder Stimme, die ganz im Gegensatz zu dem aufgeregt flatternden Kolibri stand, in den sich sein Herz verwandelt zu haben schien.
Offenbar wollte es keiner. Sie standen nur da, beobachteten ihn, kamen nicht näher…aber wichen auch nicht zurück. Wie schon bei dem Wolf am Wassertrog musste er gegen den Impuls ankämpfen, sie einfach zu töten, wie sie da standen, dass er einfach seinen Bogen ein ums andere Mal spannen und sie niedermähen sollte. Es wäre für einen geübten Schützen wie ihn ein Kinderspiel, riesige Lücken in ihre Reihen zu reißen. Aber die Zeiten waren vorbei. Sehr langsam trat Morgan den Rückzug an. Als das Ding mit dem Loch in der Wange einen schleppenden Schritt nach vorne machte, schoss er einen weiteren Pfeil direkt vor dessen Fuß in den Staub der Straße.
„Das war die letzte Warnung“, rief er. Er hatte keine Ahnung, ob sie verstanden, und es kümmerte ihn auch nicht weiter. Er ging jedoch davon aus, dass sie die Melodie dieses Liedes nur zu gut verstanden, auch wenn sie dem Text nicht folgen konnten.
„Es läuft so ab: Ihr bleibt und ich gehe. Folgt mir einer, ist er tot. Ihr habt nur diese eine Chance. Es ist zu heiß für Spielchen, und ich habe mein…”
„Ha!“ rief eine raue, verschleimte Stimme direkt hinter ihm. Bevor Morgan seinen Bogen herumreißen konnte, traf ihn eine schwere Keule dort, wo Hals und Schulter ineinander übergehen. Als er zu Boden sank, hörte er gerade noch die rauen, feuchten Laute der Wesen, die auf ihn losstürmten. Dann nichts mehr.
Geändert von El Toro (01.08.2013 um 11:39 Uhr)
-
III. Jenna. Wieder in Khorinis
Der Tag wird dunkel…“es ist der Mond, Jenna, der sich vor die Sonne schiebt“…kühler, viel kühler, obwohl es bis eben so heiß war…der träge Salzgeruch des Meeres…“vom Floß aus können wir es am besten sehen…“ immer dunkler, bis die Sonne ganz verschwindet…ein gleißender Ring von Licht…“bei Innos, Jenna, schau doch!“…die Holzbohlen unter ihr sind sonnenwarm…“ich habe Angst“…das sanfte Schaukeln auf den Wellen…“ich halte dich fest, ganz fest“…die Hand…seine Hand…“nein…“ das Gleißen schmerzt in ihren Augen, Tränen rinnen ihre Wangen hinab…“es passiert dir doch nichts. Es muss ja keiner wissen“…der Wind weht frisch auf, sie zittert vor Kälte und Unbehagen…seine Hand, immer noch…“ich will zurück. Mir ist kalt“…er hält sie fest, sie wagt nicht, sich zu rühren…es tut weh…“ich liebe dich, Jenna“…Tränen laufen an ihren Wangen hinab, während sie gebannt auf den gleißenden Ring schaut, der die Sonne war… das Meer riecht nach Kupfer, und sie schmeckt Kupfer in ihrem Mund…
Das Bild zerfaserte, löste sich in seine Bestandteile auf.
Ein Flug durch heiße Sommerluft, hin zum blauen Glitzern des wartenden Wassers. Das Auftauchen, durch kalte und warme Schichten, bis zur Oberfläche. Jenna war als Kind so oft vom Floß ihres Onkels Ezechiel in das kühle, einladende Meer gesprungen, wenn die Tage so heiß waren.
Heiß…
Jenna kam aus ihrem unruhigen Schlaf empor wie damals aus dem Wasser. Zuerst herrschte schwarze, brüllende Verwirrung, als befände sie sich im Inneren eines tosenden Strudels. Sie spürte nur einen anhaltenden, pochenden Schmerz im Nacken und in den Schultern. Ihre Muskeln dort schienen in einem Krampf erstarrt zu sein.
Sie kämpfte sich mit aller Kraft ihren Weg hindurch, ohne die geringste Ahnung zu haben, wo sie war oder wann sie war. Dann, eine wärmere, ruhigere Schicht. Sie hatte den schlimmsten Alptraum ihres Lebens hinter sich, aber es war nur ein Alptraum gewesen, und er war vorbei, endgültig und für immerdar. Als sie noch näher an die Oberfläche gelangte, kam eine weitere kalte Schicht: Der Gedanke, dass die Wirklichkeit, die sie erwartete, genauso schlimm war wie der Alptraum. Möglicherweise sogar noch schlimmer.
Was ist es, fragte sie sich. Was könnte schlimmer sein als das, was ich gerade durchgemacht habe?
Sie weigerte sich, darüber nachzudenken. Die Antwort lag in ihrer Reichweite, ganz nah, sie hätte sie fast mit den Fingerspitzen berühren können,
…ich kann meine Finger nicht spüren, wie kann…
aber wenn sie ihr einfiel, beschloss sie vielleicht, einfach umzukehren, wieder in die Tiefe hinabzutauchen, in das kühle, einladende Wasser des Meeres vor Khorinis. Das hieße ertrinken, aber ertrinken war vielleicht nicht der schlimmste Weg hinaus; doch die Vorstellung, dass der schale Geschmack von Salz, Tang und Kupfer das letzte sein könnte, das sie in ihrem Leben wahrnahm, war ihr unerträglich.
Obwohl sie im Wasser schwamm, fühlte sie sich völlig trocken. Ihre Kehle war wie die Wüste, nicht nur ausgetrocknet, sondern staubig und sandig.
Jenna schwamm verbissen weiter nach oben; über die Wirklichkeit würde sie sich Gedanken machen, wenn sie den Wasserspiegel durchbrochen hatte und frische, klare Luft in ihre Lungen strömen würde.
Die letzte Schicht, durch die sie schwamm, war warm und furchteinflößend zugleich, wie frisch vergossenes Blut. Sie wusste plötzlich, warum sie ihre Finger nicht mehr spürte, warum ihr Nacken und ihre Schultern so schlimm schmerzten.
Jenna keuchte und schlug die Augen auf. Ihre Arme zuckten unkontrollierbar in einem nervösen Stakkato von Nadelstichen. Das metallische Rasseln, das sie dabei verursachte, verschaffte ihr die letzte Gewissheit.
Sie wusste, dass sie einen Traum gehabt hatte, und sie fühlte immer noch die Panik und die Scham, aber das Entsetzen, das sich angesichts der Wirklichkeit in ihr breit machte, ließ diese Empfindungen in den Hintergrund treten. Der Traum selbst schien auszutrocknen wie aufgeplatzte Samenkapseln der Sonnenaloe. Tote Hüllen, in denen das Leben für einen kurzen Moment gewütet hatte, bevor es sie verließ.
Die Wirklichkeit traf sie wie ein Schlag. Sie war immer noch hier. Immer noch in ihrer Zelle. Sie wusste nicht, wie lange schon; aber das war auch nicht die Frage. Die Frage war vielmehr, seit wann keine Menschenseele mehr bei ihr gewesen war. Sie konnte es nicht sagen, und vielleicht war es auch besser, es nicht zu wissen. Der Mond schien durch das winzige, vergitterte Fenster.
In der irrsinnigen Hoffnung, etwas könnte sich an ihrer Lage geändert haben, während sie schlief, wandte Jenna ihren Kopf so weit wie möglich nach links. Ein glasklarer Schmerz dort, wo die Schulter in den Nacken überging, machte den winzigen Funken Hoffnung zunichte.
Erhöhte Ausbruchsgefahr, hatte der Milizionär gesagt. Anketten!. Dann hatte er die Tür des Wachturms verriegelt. Das Gefängnis sei nicht sicher genug. Zu viele Ausbrüche in letzter Zeit. Und wenn einem so ein Vögelchen ins Netz ging wie Jenna, war höchste Achtsamkeit geboten.
Anfangs hatte man ihr Wasser und ein paar Mahlzeiten gebracht. Unter der Aufsicht dreier Milizen hatte sie sogar selbst essen dürfen, während die Ketten wie tote, schwarze Schlangen reglos am Boden lagen.
Aber irgendwann… war etwas geschehen. Sie hatte nichts gehört, sie hatte nichts gesehen, aber etwas war beunruhigend anders. Nicht nur, dass man sie hier offenbar vergessen hatte, das Fest in Khorinis musste doch noch andauern. Aber da war nichts. Nur die kleinen Glöckchen konnte sie immer noch hören, die Adanos’ Tempel für diese wenigen Tage im Jahr schmückten. Niemand hatte sie wieder abgenommen, und sie läuteten ihr feines, silbernes Klingeln einfach weiter.
Jenna hatte Durst. Den schlimmsten Durst ihres Lebens. Sie würde nicht mehr lange so überleben können, das war ihr auf eine erschreckend sachliche, nüchterne Weise klar.
Vielleicht war das die Rache Khorinis’ dafür, dass sie es verlassen hatte - und es vergessen hatte. Sie hatte nie an Khorinis gedacht, fast nie, zumindest. Nicht an ihre Eltern, nicht an Cassia, nicht an die Spiele im Sand an der Küste. Lediglich der abgestandene Geruch von Meerwasser hatte sie verfolgt, und manchmal - meistens nachts, wenn sie sich unruhig auf ihrem Lager herumwälzte -, hatte sie eine flüchtige Ahnung von Unbehagen und Schmerz überkommen und die Erinnerung daran, dass er versucht hatte, die Sonne auszulöschen.
Wer?
Warum war sie überhaupt zurückgekommen? Aussicht auf leichte Beute? Sicherlich. Das war plausibel. Trotzdem wusste sie: Khorinis hatte sie gerufen, nach all den Jahren, um sich an ihr zu rächen. Um sie zu zwingen, Rede und Antwort zu stehen, warum sie es verlassen hatte.
Jennas von Durst und Angst verwirrter Geist war der Meinung, dass das auch das gar nicht die entscheidende Frage war. War es nicht viel wichtiger, darüber nachzudenken, warum sie Cassia, ihrer kleinen, süßen Cassia, an jenem Nachmittag - Jennas letztem Tag in der Hafenstadt - so fest mit dem Handrücken auf den Mund geschlagen hatte, dass sie blutete. Cassias Miene war ein einziger Ausdruck der Fassungslosigkeit gewesen, bevor sich ihr blutiger Mund verzerrte und sie weinend zu ihrer Mutter lief. Es musste doch einen….
Ihre Gedanken brachen mit dem lauten Knacken eines Holzscheites ab, der im Feuer explodiert. Ihr Blick der unablässig durch das Rund des Wachturms geschweift war, verweilte dort, wo der karge Mondschein ein kaltes Rechteck auf den Boden der Zelle zeichnete.
Dort stand ein Mann.
Jenna wurde von einem größeren Entsetzen erfüllt, als sie es je zuvor empfunden hatte. Das Gefühl war so überwältigend, dass sie glaube, ihr Herz müsse stehen bleiben. Sie konnte nicht mehr denken. Sie konnte nicht mehr atmen. Ein leises Wimmern entrang sich ihrer Kehle und verhallte im Dunkeln. Jennas Muskeln in den Schultern, die sich eben noch wie Eisen angefühlt hatten, schienen jetzt warmes Wasser zu sein, das an der Wand des Turms hinabzufließen drohte.
Ein Mann, ein Mann im kalten Rechteck des Lichts, das der Mond auf den Steinboden zeichnete.
Sie konnte seine dunklen, leeren Augen sehen, die blicklos ins Dunkel starrten und seine wächsernen, eingefallenen Wangen. In einer klaffte ein Loch, so groß und ausgefranst, dass es aussah wie der Eingang zu einem Rattennest. Sie konnte die hohe Stirn des Mannes erkennen, den Rest eines Gesichts machte das Spiel der Schatten unkenntlich.
Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie in dieser grässlichen Halbstarre lag, so reglos wie ein Käfer nach dem Biss einer Spinne. Die Sekunden verstrichen, und Jenna war außer Stande, auch nur die Augen zu schließen. So, wie ihre Angst langsam abebbte, stieg unaufhaltsam ein noch schlimmeres Gefühl in ihr auf: Grauen und ein ganz und gar unvernünftiger Ekel.
Ihr Besucher stand nur da, sonst nichts. Sie lag in ihren Ketten mit über den Kopf gestreckten Armen und wundgescheuerten Handgelenken da und kam sich vor wie eine Frau auf dem Grund eines tiefen Brunnens.
Als es ihrem Denken gelang, sich durch die dunkle Mauer der Angst hindurchzuarbeiten, stahl sich eine unendlich tröstliche Vermutung in ihren Kopf:
Außer dir ist keiner da, Jenna. Der Mann in der Ecke ist eine Mischung aus Schatten und Einbildung, mehr nicht. Ein halb verdursteter Mensch sieht nun mal Dinge, die nicht existieren. Nimm noch deine Angst hinzu, und dann…
Der Mann bewegte sich.
Panisch zerrte sie ihren Körper in eine halb sitzende Haltung, ihr Gesicht eine Grimasse des Schmerzes; sie versuchte, die bloßen Fersen in den Boden zu stemmen, rutschte weg, atmete in kurzen, keuchenden Stößen, ohne dabei den Blick von dem verzerrten Schatten in der Ecke zu nehmen. Ihr Verstand brüllte:
Das ist nur eine Ausgeburt des Mondlichts! Ein Überbleibsel aus deinem Traum! Er ist viel zu groß für einen Menschen. Denk doch mal nach! Schau doch einfach genau hin!
Der Mann drehte den Kopf nun völlig in ihre Richtung und starrte sie aus dunklen Augenhöhlen an. Jennas Herzschlag wurde schneller und unregelmäßiger.
Mach die Augen zu, dann sieht er dich vielleicht nicht und geht dahin zurück, woher er gekommen ist.
Stattdessen kam ein Wort über ihre trockenen, aufgesprungenen Lippen, ein sandiges Flüstern, aber deutlich zu vernehmen in der absoluten Stille der Stadt, die nur von dem feinen Klingeln der Silberglöckchen und dem Gesang unendlich vieler Zikaden unterbrochen wurde.
„Hilf…“
Jenna räusperte sich - oder versuchte es -, und schmeckte metallisches Blut in ihrer Kehle:
„Hilf mir.“
Die Gestalt antwortete nicht, sondern stand nur da, ließ die schmalen, weißen Hände baumeln und starrte sie weiter an.
„Bitte“, brachte sie heraus, „wenn du wirklich bist…“
Nichts. Keine Bewegung, keine Antwort. Er stand einfach nur da, wenn er überhaupt da war
und betrachtete sie hinter seiner trügerischen Maske aus Schatten.
Jenna spürte, wie ihr Tränen über Wangen liefen und sie fragte sich, wie ihr ausgetrockneter Körper überhaupt noch dazu im Stande sein konnte.
„Warum sagst du nichts? Wenn du wirklich da bist, sprich mit mir, ja?“
Hysterie wickelte ihren dünnen Schleier um sie, packte ihr Bewusstsein mit ihren knochigen Klauen und trug es fort. Aber nicht weit.
Sie hörte, wie sie die schattenhafte Gestalt anflehte, ihr schmeichelte, Versprechungen machte und mit tränenerstickter Stimme immer wieder darum bat, sie doch bitte von den Ketten zu befreien, bitte, bitte zu befreien.
Während sie da lag und dem dünnen Flüstern einer Frau lauschte, die um ihr Leben bettelte, schien sich das Gesicht der Gestalt zu verändern. Es grinste. Ein dunkles Grinsen, aber gleichzeitig hatte es etwas schrecklich Vertrautes an sich, und Jenna spürte, wie der Kern ihrer geistigen Gesundheit, der ihrer Lage bisher mit bemerkenswerter Kraft standgehalten hatte, ins Wanken geriet.
„Ezechiel?“
-
IV. Der Gott des Gemetzels
Makoshh stand auf dem Dach des Herrenhauses und sah mit betäubendem Entsetzen auf das Gemetzel hinab, das sich vor seinen Augen abspielte. Er hatte in seinem Leben viele Kriege gesehen, er kannte den Tod, die Schreie der Verwundeten und Sterbenden. Er hatte immer gewusst, dass es ihm, dem Anführer der Krieger, vorherbestimmt war, durch Ströme von Blut zu waten. Doch in diesem Moment wünschte er sich, er wäre blind, um das entsetzliche Schlachten in den Straßen und Gassen nicht mit ansehen zu müssen. Er sah von seinem Dach aus, wie ein junger Ork, kaum älter als zwanzig, unter Schreien und heftiger Gegenwehr von zwei schwer bewaffneten Kriegern auf die Füße gezerrt und auf den von einer niedrigen Steinmauer gesäumten Platz vor dem Herrenhaus der Krieger geschleift wurde. Dort zwangen sie ihn auf die Knie. Einer der Krieger
O Adanos, das ist Prakkaz…
spuckte aus und berührte mit der Spitze seines Schwertes den Leib seines Gefangenen.
„Nein!“, schrie der Junge hysterisch, „Ich komme mit euch, bei Beliar, ich schwöre es! Ich…“
„Imnamendesgottesadanosderallegeschöpfegleichermaßenliebt“, intonierte der Krieger, den Makoshh als Prakkaz erkannt hatte, und rammte das Schwert in den Bauch des Orks, der vor ihm kniete. Der Junge blickte einige Sekunden lang entsetzt auf seine Eingeweide, die aus der klaffenden Wunde hervorquollen und versuchte, sie mit blutigen Händen festzuhalten. Dann fiel er vornüber und landete mit seinem Gesicht in der größer werdenden Lache seines eigenen Blutes.
Makoshh riss seinen Blick von der Hölle los, die sich vor seinen Augen aufgetan hatte.
Ein Gefühl, größer noch als das Entsetzen und die Fassungslosigkeit, griff nach seinem Herzen und umklammerte es mit seiner eisigen Klaue.
Ich hätte es verhindern können.
Ein einziger Gedanke beherrschte seinen Geist: Ich habe dem Gott des Gemetzels geopfert, und er ist erwacht.
Es war zu spät. Das Schicksal seines Volkes war in dem Augenblick besiegelt gewesen, als er dem Ritual zugestimmt hatte. Sein Geist hatte der schmeichelnden Stimme, mit der der Gott des Gemetzels in den grauen Stunden des morgendlichen Zwielichts zu ihm sprach, nicht widerstanden.
Makoshh stöhnte und sah zum aufgehenden Mond hinauf, der in dunklem Orange tief und aufgedunsen über dem Tal hing. Kein Gedanke konnte bei diesem fiebrigen Licht je zu etwas Gutem führen. Dennoch wusste Makoshh, dass er eine Entscheidung treffen musste. Nein, er wusste, dass er seine Entscheidung bereits getroffen hatte und nun mit sich ringen musste, sich selbst einzugestehen, dass es nur eine einzige Möglichkeit gab, die Vernichtung der Welt aufzuhalten. Sein Bruder Varagh und die vier anderen Schamanen waren ohnehin verloren. Es gab nichts, was er noch für sie und die ungezählten Tempeldiener tun konnte.
Er sah noch einmal hinab auf den kleinen Platz vor dem Herrenhaus. Im Sommer hatte hier ein Springbrunnen die Luft mit fröhlichem Plätschern erfüllt. Nun war der steinerne Schattenläufer, aus dessen Mund das Wasser lebhaft gesprudelt hatte, von seinem Sockel hinabgestürzt und lag in Trümmern auf dem Pflaster. Nicht das klare Wasser aus der Quelle am Tempel, sondern dunkles Blut lief nun in Strömen über die Kopfsteine. Der junge Ork lag immer noch in einer gerinnenden Lache seines Blutes. Im Sterben hatte er den Kopf gewandt, als wolle er ein letztes Mal den Himmel sehen. Das furchterregende Licht des Fiebermondes spiegelte sich in seinen leeren, gebrochenen Augen, auf seinen kalkweißen Wangen zeichneten sich dunkle Flecken ab.
Links und rechts ging das Morden weiter. Makoshh konnte eine Orkfrau erkennen, die im Schatten der niedrigen Umfriedung des Platzes lag. Sie war tot, daran bestand kein Zweifel. Aber etwas mit ihr stimmt nicht. Erst nach einer Sekunde angestrengten Grübelns erkannte sein gequälter Geist, was nicht stimmte: Dort, wo ihr Kopf hätte sein sollen, befand sich nur eine Masse aus Blut und Gehirn.
Wieder blickte Makoshh zum Mond auf, der seine Reise am Himmelszelt unbeeindruckt von all dem Morden und Schreien fortgesetzt hatte. Nun glühte er nicht mehr in düsterem Orange, sondern war weiß wie polierter Knochen. Makoshh wusste nicht, wie lange er schon in das silberne Angesicht des Mondes gestarrt hatte, als er eine Hand auf seiner Schulter spürte.
Doch als er sich umwandte, sah er das Gesicht Kaans vor sich. Die Augen des Schamanen, die sonst vor Entschlossenheit strahlten, waren verschleiert, seine Mundwinkel schlaff und sein Antlitz zerfurcht von tiefen Falten. Er war nur noch ein matter Abglanz des Orks, der er bis vor wenigen Wochen gewesen war. Zu tief saß das Entsetzen über das blutige Schauspiel, das sich in den Straßen abspielte.
„Es ist alles vorbereitet. Wir können den Tempel jetzt versiegeln, mit allen, die noch darin sind. Hast du deine Entscheidung getroffen?“
Ein letztes Mal in dieser Nacht sah Makoshh zum bleichen Mond hinauf. Aus dem Dunkel der Nacht drangen nur noch dumpf vereinzelte Schreie und das ferne Klirren von Waffen. Nebel war aufgekommen und erstickte das leise Stöhnen der Sterbenden.
Er blickte dem Hohepriester fest in die Augen und erwiderte:
„Bei Adanos, das habe ich.“
Geändert von El Toro (02.08.2013 um 09:20 Uhr)
-
V. Morgan. Totes Fleisch.
„Morgan!“
Fergus sah krank und elend aus, als er auf Morgan zukam.
Der Junge, der später Morgan sein würde, wandte den Blick von dem grauen Ungetüm ab, das dort lag, nach Salz und Tang roch und dessen gewaltige Oberfläche von winzigen, weißen Schaumflocken bekrönt wurde. Er stand auf der steilen Klippe nahe dem Leuchtturm und genoss den Wind, der ihm das schwarze Haar zerzauste. Draußen auf dem Meer trieb ein kleines Floß, und Morgan konnte undeutlich zwei Gestalten darauf erkennen. In der schwülen Hitze des Mittags klang das Rauschen der Wellen gedämpft. Morgan kam gern hierher, und noch lieber war es ihm, wenn ihn Fergus begleitete. Der schmächtige Junge mit dem schmalen Gesicht war für ihn wie ein Bruder.
Heute waren Fergus’ hellgrüne Augen dunkel vor Zorn und Mitleid, und im harten Licht des Mittags sah sein Gesicht bekümmert und alt aus.
Morgan verspürte einen Anflug von Unwillen, den er nicht völlig unterdrücken konnte. Er war hierher gekommen, um seinen letzten Tag in Khorinis würdig abzuschließen - die Jungen in Khorinis sprachen seit Tagen von nichts anderem als der Sonnenfinsternis -, und er hatte nicht geringste Lust, sich den Abschied verderben zu lassen. Nicht einmal von Fergus. Obwohl er sich Mühe gab, seine Verärgerung nicht zu zeigen, klang seine Stimme nicht so unbeschwert wie sonst, als er mit einem schiefen Lächeln sagte:
„Fergus! Schön, dass du doch noch gekommen bist. Ich bin wirklich…“
Fergus erwiderte sein Lächeln nicht. Er fasste ihn am Arm und sagte:
„Lass uns ein Stück gehen, ja?“
Wieder wallte Verärgerung in Morgan auf, und er schämte sich ein wenig dafür. Daher nickte er wortlos und folgte seinem Freund den Weg zum Strand hinunter. Als sie, immer noch schweigend, über den warmen Sand zum dunkleren, härteren Boden am Wasser gingen, fand Morgan, dass es vielleicht doch eine ganz gute Idee gewesen war. Das anschwellende Geräusch der Wellen, die ans Ufer schlugen, beruhigte ihn. Eine Möwe, die sich bemühte, gegen den Wind Höhe zu gewinnen, malte ein weißes M an den Himmel. Gegen seinen Willen musste Morgan lächeln. Endlich unterbrach Fergus das Schweigen:
„Du bist dir verdammt sicher, was?“
„Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss“, sagte Morgan leichthin, obwohl er schon wieder aufkeimende Wut auf seinen Freund verspürte. Wieso nahm sich Fergus das Recht heraus, seine wohl überlegten Entscheidungen anzuzweifeln?
„Du bist noch ein Kind, Morgan.“
Morgan schnaubte. „Vielen Dank, Vater.“
„Ich wollte, ich wäre dein Vater“, sagte Fergus böse. „Dann würdest du nämlich nicht herumlaufen und allen erzählen, dass du an diesem Feldzug teilnehmen willst. Und wenn deine Leute es nicht fertig bringen, dir das auszutreiben, sollte ich es vielleicht tun.“
Fergus’ Gesicht sah erschrocken und bestürzt aus, als erwarte er, dass Morgan auf ihn einschlagen würde.
Morgans Augen verengten sich. So wollte es ihm Fergus also heimzahlen, dass man ihn nicht für geeignet gehalten hatte, in den Dienst des Königs einzutreten. Er war genau wie die anderen. Jetzt, wo Morgan gerade dabei war, etwas aus seinem Leben zu machen, hassten ihn alle. Alle hatten die Messer gezückt. Allzu schnelle Tränen wollten seinen Blick verschleiern, aber er riss sich zusammen.
„Lass mich einfach in Ruhe.“
Fergus hatte die Tränen in Morgans Augen bemerkt. Aber er wusste, dass ein paar Tränen die Felsformation seines Wesens ebenso wenig ändern konnten wie ein kurzer Sommerregen ein Gebirge verändern konnte. Hatte Morgan diese Härte schon immer an sich gehabt? Fergus war davon überzeugt. Schon als Kind hatte er manchmal gedacht, dass es bei Morgan war, als würde man auf dünn ausgewalztes Silber beißen. Er war ihm immer ein guter Freund gewesen, daran bestand kein Zweifel, aber was wäre gewesen, wenn sie einmal wirklich in Schwierigkeiten gesteckt hätten? Morgan mit seinem wachen Verstand und seiner gewinnenden Art hätte sich aus jeder verzwickten Lage befreien können, aber was wäre mit ihm gewesen? Er war sich sicher, dass Morgan ihn zurückgelassen hätte, damit er selbst schwimmen oder eben untergehen könnte. Das Schlimmste daran war, dass Morgan es nicht einmal böse meinte. Es war einfach sein Verständnis von Gerechtigkeit, dass sich jeder um sich selbst zu kümmern hatte, wenn es die Situation erforderte.
Morgan konnte Fergus’ Blick nicht länger ertragen. Wind war aufgekommen, und die Vögel schienen ihren Gesang zu unterbrechen. Bald würde sich der Mond vor die Sonne schieben und den Mittag für einige Momente in finsterste Nacht verwandeln.
„Ich werde morgen früh abreisen.“ Es war, als würde er jedes Wort wie einen trockenen Ballen Sägespäne ausspucken.
„Geh nicht. Ich will nicht, dass du gehst. Ich will nicht, dass du stirbst…“
Doch Morgan hatte sich bereits abgewandt und ging durch den warmen Sand zurück.
Fergus rannte los, packte ihn am Arm und riss ihn grob herum. Ein Stück Seetang klebte an seiner Wange.
Seetang?
„Verstehst du das denn nicht? Du wirst kein Held sein. In ein paar Tagen wirst du einfach nur tot sein, ein Haufen totes Fleisch auf einem Schlachtfeld, und…“
Morgan verzog die Lippen zu einem harten Lächeln:
„Mach dir keine Sorgen um mich, Fergus. Ich schaff’ das schon.“
Fergus’ ganze Gestalt schien in sich zusammenzusinken. Trübes Seewasser rann aus seinen roten Haaren und durchnässte seine Kleidung.
Seewasser?
„Ja, womöglich. Solche wie du schaffen es immer.“
Morgan funkelte Fergus wütend an. Eine winzig kleine Krabbe arbeitete sich unter größten Anstrengungen zwischen Fergus’ schlaffen, blauen Lippen hervor.
Eine Krabbe?
Er verfolgte gebannt, wie sich die Krabbe aus Fergus’ Mund zwängte. Fergus hob beiläufig eine seiner bleichen, aufgedunsenen Hände und wischte sie geistesabwesend fort. Sie fiel in den Sand, landete auf dem Rücken und zappelte hilflos mit ihren winzigen, fast durchsichtigen Beinchen. Morgan sah, dass auf Fergus’ Handrücken eine kleine Kolonie Seepocken klebte. Seine Fingernägel waren violett - zumindest die Nägel der beiden Finger, die noch vollständig waren. Daumen, Mittel- und Ringfinger waren faserige Stümpfe, aus denen bleiche, säuberlich abgenagte Knochen ragten.
Morgan riss den Blick von Fergus’ entsetzlicher Hand los und sah in das Gesicht seines Freundes. Fergus verzog die Lippen zu einem Grinsen, wobei zwei Rinnsale Meerwasser aus seinen Mundwinkeln flossen. Aus seinen leeren Augenhöhlen schien er Morgan höhnisch anzusehen. Sand und Fetzen von Seetang malten bizarre Muster auf die fischbauchweiße, aufgequollene Haut seiner Wangen.
Morgan keuchte.
„Was…ist mit dir geschehen?“
Das Ding, das einmal Fergus gewesen war, kicherte blubbernd und stieß dabei einen ganzen Schwall trübes Wasser aus. „Die Sonne hat sich verdunkelt, weißt du nicht mehr? Du hast die Sonne für mich verdunkelt, Morgan.“
Fergus’ leere Augenhöhlen verschmolzen zu einem einzigen, runden, goldenen Auge, das wie eine düstere Sonne in seinem bleichen Gesicht schwebte. Morgan wich zurück. Er empfand ein grässliches, nie gekanntes Entsetzen, aber dieses Gefühl verschwamm, trat in den Hintergrund und gab einer Empfindung Raum, die viel größer, viel bedeutsamer war. Morgan erkannte sie nicht sofort,
Mitleid?
aber je länger er dem wahnsinnigen, gequälten Kichern des Dinges lauschte und zusah, wie Ströme von Wasser aus den von Salz und Schwärmen winziger Fische zerfressenen Lippen hervorquollen, desto klarer wurde ihm, dass er Reue verspürte.
Obwohl er wusste, dass er die Antwort kannte, kennen musste, fragte er wieder:
„Was ist mit dir geschehen?“
Doch das blubbernde Etwas, zu dem sein Freund geworden war, kicherte und schluchzte weiter, unaufhörlich, der Mond schob sich vollends vor die Sonne, und Morgan wurde fortgewirbelt in einem dunklen Strudel der Ohnmacht, in tiefste, finsterste Nacht.
Geändert von El Toro (02.08.2013 um 09:02 Uhr)
-
VI. Jenna. Morgenstund’ hat Gold im Mund.
Jenna befand sich in der im trüben Zwielicht gelegenen Zone zwischen Ohnmacht, Schlaf und Erwachen. Hier und da wurde das graue Licht von Blitzen heller Panik durchzuckt.
Sie war im Dunkeln gewesen…
Dinge änderten sich in der Dunkelheit, das hatte Jenna schon damals gelernt. Menschen, die allein im Dunkeln waren, wurden zu offenen Türen, und wenn sie riefen oder um Hilfe schrieen, wer konnte sagen, wer von draußen hereinkam?
Sie hatte geschrieen…
Ihre Handgelenke waren bis aufs rohe Fleisch wundgescheuert und begannen zu pochen. Durch das Fenster tröpfelte nebliges Morgenlicht herein und hüllte
Ezechiel
die Gestalt ihr gegenüber in bizarre Schattenmuster.
Jenna kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen und presste durch ihre staubige, schmerzende Kehle:
„Du bist nicht Ezechiel. Ich glaube nicht, dass du überhaupt jemand bist. Du bestehst nur aus Schatten und Angst.“
Diesmal musste Jenna nicht vergeblich auf eine Antwort warten. Die Gestalt bückte sich zu einer spöttischen Verbeugung, und in diesem Augenblick kam das Gesicht - ein Gesicht, das so wirklich war, dass man nicht daran zweifeln konnte - aus dem Schatten heraus, und die fahlen Lichtstrahlen hoben seine Züge so grell hervor wie bei einer hölzernen Jahrmarktsfigur.
Es war nicht Ezechiel.
Verglichen mit dem Bösen und dem Wahnsinn, der im Antlitz ihres Besuchers lag, hätte sie selbst Ezechiel willkommen geheißen. Aus tiefen, von Runzeln gesäumten Höhlen funkelten tückische, goldene Augen. Durch das Loch in seiner Wange konnte einen Wimpernschlag lang die glänzende Muskulatur seines Kiefers sehen. Seine Unterlippe, violett wie ein Stück Leber, hing schlaff herab und entblößte unregelmäßige, schwarze Schneidezähne. Während Jenna das Wesen anstarrte, verzog sich dessen Mund wieder zu einem Grinsen, das breiter und breiter wurde, bis sie ein schwaches Funkeln von Gold weiter hinten im Mund erkennen konnte. Ihr gequälter Verstand lachte hysterisch auf.
Goldzähne! Er hat doch wirklich Goldzähne!
Es konnte nur ein Traum sein. Es musste ein Traum sein, den sie im Halbschlaf hatte. Besser: eine Wahnvorstellung. Es war ja auch kein Wunder, sie lag seit Tagen ohne Wasser in einer Zelle, voller Angst vor der Dunkelheit und vor dem unausweichlichen Sterben… und vor den Erinnerungen, die sie so sorgfältig unter einer grob gewebten Decke verborgen hatte und die ihr jetzt, wo die Decke fadenscheinig und löchrig wurde, spöttisch wie boshafte Kinder zuzwinkerten.
Ich muss nur aufwachen.
Sie schloss die Augen und zerrte verzweifelt an ihren Fesseln, um sich durch die Schmerzen in ihren Schultern und am nackten Fleisch ihrer Handgelenke in die Wirklichkeit zurückzureißen.
Der Schmerz kam wie erwartet, so klar und erlesen, dass Jenna laut aufschrie. Sie spürte dumpf, wie die dünne Schicht Haut, die sich um die Wunden herum gebildet hatte, aufplatzte und frisches Blut oder Eiter warm an ihren Armen hinab lief. Jetzt war sie wach, daran bestand nicht der geringste Zweifel.
Triumphierend riss sie die Augen auf und starrte in das Gesicht, das mittlerweile dicht über ihr schwebte und in stummer Heiterkeit verzerrt war. Der eben noch schlaffe Mund war zu einem stummen Grinsen aufgesperrt und die hängenden Schultern wogten vor unterdrücktem Gelächter.
Jennas Verstand setzte zu einem letzten Gedanken an, bevor sie endlich von der gnädigen, dunklen Umarmung der Bewusstlosigkeit umfangen wurde:
Er hat nicht ausgesehen wie Ezechiel, aber vielleicht nur deshalb, weil er sein Sonnenfinsternisgesicht getragen hat…
Geändert von El Toro (02.08.2013 um 09:04 Uhr)
-
VII. Morgan. Die Straße gleitet fort und fort.
Morgans Erwachen glich einem Aufstieg aus den schwärzesten Tiefen eines Ozeans. Tintenschwarz wich dem dunklen Grau schwerer Regenwolken, dann dem milchigen Grau von Morgennebel, durch den bald die ersten Sonnenstrahlen brechen würden. Ein Summen, wie ein Lufthauch, der über Bambus weht, oder wie ein unterirdischer Chor, der einen einzigen, surrenden Ton ausstieß, begleitete diesen Aufstieg. Über seiner Reise aus der Dunkelheit lag ein Gefühl, als wäre er in einem sanften, aber unentrinnbaren Aufwind gefangen.
Ich bin tot, dachte er. Ich bin tot und steige in Innos’ Ewigkeit auf. Der Gesang, den ich höre, ist das Singen der toten Seelen.
Mit der Helligkeit nahm auch das Summen zu, schwoll an zu einem vielstimmigen Singen ohne Ursprung, das ihn von allen Seiten umfing. Es klang nun wie der Gesang von Grillen und Grillen, nur lieblicher, durchwirkt von den feinen, silbernen Tönen kleiner Glöckchen. Glöckchen und Grillen, wie er sie schon einmal gehört hatte, an einem heißen Tag, in der Hafenstadt Khorinis.
Mit diesem Gedanken schlug Morgan die Augen auf.
Der weiße Himmel über Khorinis blickte ihm gleichgültig entgegen. Morgan wusste nicht, wie lange er schon in dieses trübe Milchweiß gestarrt und dem Gesang der Silberglöckchen im aufkommenden Wind gelauscht hatte, als sich die Welt um ihn herum plötzlich in Bewegung setzte. Ein dumpfes Poltern schien rings um ihn herum aufzusteigen und vermischte sich mit dem Gesang der toten Seelen.
In diesem Augenblick begannen Schmerzen in seinem Rücken wie ein Baum zu wachsen. Seine Wirbelsäule war ein glühender Stamm, der seine brennenden Äste bis in Morgans Schultern ausstreckte und von dort seine feinen, weißglühenden Triebe seine Arme entlang sandte.
Weitaus schlimmere Schmerzen pochten in seinem Nacken. Dort, wo mich die Keule getroffen hat, dachte er. Die Keule…?
Khorinis!
Die Erinnerung brach über ihn herein wie ein eisiger Wasserguss.
Er war nach Khorinis gekommen, und dort war etwas geschehen. Er erinnerte sich an einen toten, aufgedunsenen Jungen im Wassertrog, an Fetzen von schwarzer, verwesender Haut, an die dumpfe Gier in toten, glanzlosen Augen, an ein verschleimtes Kichern hintern ihm und an das Knirschen, mit dem sich das glatte Eichenholz einer Keule in die Vertiefung zwischen Schulter und Nacken gegraben hatte.
Morgan versuchte, seinen Kopf hochzureißen, doch sein Körper versagte ihm den Dienst. Entsetzliche Schmerzen, hell wie geschmolzenes Silber, durchzuckten seinen Rücken. Morgan unterdrückte ein Stöhnen, schloss die Augen und versuchte, möglichst ruhig und flach zu atmen. Er wusste nicht genau, wo er sich befand - und was noch schlimmer war: in wessen Gesellschaft -, und der Krieger, der er mittlerweile geworden war, wusste nur zu gut, wie unklug es war, in einer solchen Lage Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Hätten sie seinen Tod gewollt, so hätten ihn auf dem Marktplatz von Khorinis ausweiden können wie einen Hasen. Aber er lebte noch. Er musste also warten…und sich bereithalten.
Morgan hörte das Poltern von Holz auf Pflastersteinen, sein ganzer Leib wurde erst leicht, dann immer stärker erschüttert, bis er durchgeschüttelt wurde wie eine Lumpenpuppe. Seine Hände tasteten vorsichtig nach einem Halt, doch er spürte nur die raue Wärme von Holz rings herum.
Ein Wagen. Ich liege auf einem Wagen.
Er lauschte dem gleichmäßigen Poltern. In das gleichgültige Weiß des Himmels schoben sich Dachgiebel, Äste und hin und wieder der Schatten eines der mächtigen Wehrtürme der Stadt. Morgan musste an eine Zeile aus einem Buch denken, dass er vor langer, langer Zeit einmal gelesen hatte.
Die Straße gleitet fort und fort…
Er versuchte, seinen Kopf ein wenig zu drehen, aber sein Nacken schien völlig steif zu sein. Seine linke Hand erkundete weiter die Umgebung, stieß auf noch mehr Holzbretter, schief eingeschlagene Nägel, kleine Astlöcher, bis sie schließlich etwas Weiches, Feines
Haar?
ertastete.
Mit größter Anstrengung zwang Morgan die steinharte Muskulatur seines Nackens, sich um Fingerbreite nach links zu drehen. Widerwillig und nur unter schmerzhaftem Protest leistete sie Folge, so dass Morgan zischend Luft einsog. Er befand sich tatsächlich auf einem Gefährt aus grob gezimmerten Holzbrettern. Aus den Augenwinkeln konnte er eine weitere Gestalt erkennen, die reglos auf dem Wagen lag. Sie lag zusammengekauert auf der Seite und hatte die Knie eng an die Brust gezogen. Ihre Hände hielten die Knie fest umklammert, obwohl die Frau bewusstlos zu sein schien. Von ihren Kopf ergoss sich eine wahre Flut roter Locken, die ihr Gesicht, ihre Schultern und den Holzboden des Wagens um sie herum bedeckten. Morgan war sicher, dass dieses Haar an einem sonnigen Tag Funken sprühen würde, aber nun war es matt und stumpf, verklebt von Schweiß und Staub.
Morgan versuchte, mehr von der Gestalt zu erkennen, deren Haar so tröstlich seine Hand berührte. Ein anderer Mensch. Ein lebender Mensch.
Seine Augen begannen vor Anstrengung zu tränen und sein Gesicht verzog sich zu einer Maske der Qual, als er seinen Kopf noch ein winziges Stück weiter nach links wandte.
Nun sah er etwas deutlicher. Das Kleid, das die bewusstlose Frau trug, war schmutzig und stellenweise zerfetzt, außerdem schien es ihr zu groß zu sein, wie der Pelz eines Tieres, der nach dem langen Winterschlaf seltsam weit für den nun schmächtigen Körper wirkte.
Das, was durch die Fetzen der Ärmel von ihren Armen zu sehen war, war schmutzig, zerkratzt und…
Morgan erschrak.
Sein Blick hatte ihre Handgelenke erreicht, die nur noch aus einer blutigen, eitrigen Masse rohen Fleisches zu bestehen schienen, die stellenweise schwarz und brandig wurde. Er hatte viele Verletzungen gesehen in den letzten Jahren, und diese an den Handgelenken der Frau waren von der schlimmeren Sorte. Sie würden sie in ein paar Tagen umbringen, wenn sie nicht behandelt würden. Morgan fragte sich, was ihr solche Wunden hatte zufügen können.
Morgan wurde jäh aus seinen Gedanken gerissen, als der Wagen unvermittelt stehen blieb. Sie waren am Ziel.
Wieder schloss er die Augen und konzentrierte sich auf die Geräusche seiner Umgebung. Der Schmerz in seinem Rücken hatte sich in eine dunkle Ecke zurückgezogen und wartete darauf, zu gegebener Zeit zurückzukehren. Morgans ganzer Körper schien vor Anspannung leicht zu vibrieren.
…ruhig. Atme ruhig…
Schritte, langsam und schleppend, auf trockenem Gras.
Ein gluckerndes, irgendwie wässriges Kichern, ein Geräusch wie Meerwasser in einem Kupferrohr.
Eine Wolke des Geruchs, den Morgan schon so oft auf den nördlichen Schlachtfeldern wahrgenommen hatte. Am Anfang war er schlimm gewesen, wirklich schlimm, kaum zu ertragen. Aber heute kam er Morgan vor wie ein alter Bekannter.
Das unbeschreibliche Geräusch eines leblosen Körpers, der über Holzbretter gezogen wurde, dann dumpf in verdorrtes Gras fiel und einem unbekannten Ziel entgegengeschleift wurde.
Schließlich Hände an seinem eigenen Körper, weich wie Fisch, der in der Sonne gelegen hatte, aber mit stählerner Härte darunter.
Morgan spürte, wie er langsam über den Holzboden des Karrens gezogen wurde. Er bereitete sich darauf vor, im nächsten Augenblick ins Gras zu stürzen, als die Bewegung plötzlich abbrach.
Ein Flüstern, nass und rau:
„Morgan?“
-
VIII. Jenna. Tochter des Liebreiz’.
„Du willst mir nicht weismachen, dass du immer noch Angst hast vor der alten Marta?“ Onkel Ezechiel hatte Jenna aufmerksam und mit Respekt zugehört, während sie sprach, aber nun gab er sich besondere Mühe, das amüsierte Funkeln in seinen Augen zu verbergen.
„Nun ja, du weißt schon, so ein bisschen…“
Jenna hatte ihren Onkel auf der Bank vor seiner Hütte gefunden, wo er in einer fleckigen Ausgabe von „Jagd und Beute“ blätterte. Es war noch früh am Morgen, doch Jennas Mutter war bereits mit Cassia unterwegs, um einige Besorgungen zu machen. Sie hatte Jenna eine lange, eng beschriebene Liste hinterlassen: kleine, nach links geneigte Buchstaben, die wie streng zusammengekniffene Augen aussahen. Jenna hatte die Liste sorgsam gelesen und sie eben so sorgsam - Kante auf Kante - zu einem kleinen, festen Papierfächer zusammengefaltet.
Jennas Aufgabe bestand darin, die Vorbereitungen für den morgigen Tag zu treffen. Und genau damit hatte Jenna gerade begonnen - anders jedoch, als ihre Mutter es vorgesehen hatte. Ihr zwölfter Geburtstag lag noch einige Monate in der Zukunft, aber sie hatte, wie sie selbst fand, einen außerordentlich geschickten Schlachtplan entworfen.
Wie ein richtiger Paladin, dachte sie und kicherte ein bisschen.
„Ein bisschen, soso…“ Ezechiel lachte leise.
Jenna drehte den Papierfächer in ihren Händen und schwieg. Sie schämte sich ein wenig, doch als sie ihrem Onkel ins Gesicht sah, stellte sie fest, dass seine Erheiterung freundlich war und sein Lachen möglicherweise verschwörerisch.
„Und außerdem möchte ich bei dir bleiben.“ Sie strahlte ihn an legte all ihre kindliche Zuneigung in ihr Lächeln. Sie war auf dem besten Weg - das spürte sie -, diesen wunderbaren und einzigartigen Tag mit ihrem Onkel verbringen zu dürfen, den sie mehr vergötterte, als sie es mit den einfachen, kunstlosen Worten, die sie abends in ihrem Tagebuch notierte, ausdrücken konnte.
Jenna wusste, dass es ihrer Mutter gar nicht gefallen würde, und sie wusste auch, was ihre Mutter von der Behauptung hielt, dass Jenna immer noch Angst vor dieser alten Hexe hatte, obwohl es schon mehr als fünf Jahre her war, dass Marta ihr den himmelschreiend ungerechten Schlag mit der Weidenrute verpasst hatte. Cassia würde enttäuscht sein, aber auch das bedeutete Jenna in diesem Augenblick nicht viel. Bekam Cassia nicht sonst alles, was sie wollte?
Ezechiel hob ihre Hand zu seinen Lippen wie ein varantinischer Edelmann und küsste galant ihre Fingerspitzen. Er hatte sich an diesem Tag nicht rasiert und das raue Kratzen seiner Bartstoppeln ließ sie angenehm erschauern.
„Ihrr seid zu ent-zuck-end, o Tochterr des Liebrreiz!“
Jenna kicherte und wusste in diesem Moment ganz sicher, dass die Dinge den Lauf nehmen würden, den sie vorgesehen hatte. Sie blickte auf das im Morgenlicht glitzernde Meer hinaus.
„Können wir die Sonnenfinsternis nicht von deinem Floß aus ansehen? Bitte!“
Ezechiel lachte: "Aber nur, wenn du dir das hübsche Sommerkleid von letztem Jahr anziehst, hörst du? Darin hast du ausgesehen wie eine Prinzessin."
Geändert von El Toro (03.08.2013 um 14:44 Uhr)
-
X. Morgan. Ein Spaziergang im Park, ein Schritt ins Dunkel.
Morgan saß an diesem herrlichen ersten Morgen nach der Apokalypse auf einer Bank im Park der königlichen Residenz. Das stolze Schloss war nun eine qualmende Ruine, doch die von hohen Hecken und Bäumen umgebene, elegant angelegte Miniaturlandschaft, die Menagerie und die steinernen Bänke rings herum waren wie durch ein Wunder unversehrt, als hätte diese letzte, entscheidende Schlacht am Vorabend niemals stattgefunden - wenn man von der ein oder anderen vereinzelten Leiche eines königlichen Soldaten oder eines Orkkriegers absah, der sich zum Sterben in den Schatten der Ginsterbüsche zurückgezogen hatte. Der Himmel spannte sich in strahlendem Blau über Vengard.
Morgan war allein, alle anderen waren entweder tot oder geflüchtet. Von seiner Bank aus konnte er in den Gehegen der Menagerie zwei Löwen, einen Schattenläufer und einen an schmiedeeiserne Ketten gelegten Oger sehen. Das Löwenpärchen lag verendet im Sand seiner künstlichen Oase. Mit dem ersten Morgenlicht waren auch die Fliegen gekommen und hingen in großen, summenden Trauben an den Kadavern. Auch der Schattenläufer war tot, in seinem stumpfen, verklebten Fell krochen Maden herum. Morgan glaubte nicht, dass die Tiere Opfer der Krushs geworden waren. Einen eingesperrten Löwen zu töten brachte einem Ork keine Ehre. Nur Morras gefiel es, zahme Schattenläufer und vom Alter geschwächte Löwen in Jagdschauspielen unter dem Jubel des Publikums niederzumachen. Die Tiere der königlichen Menagerie waren seit weiß Innos wie langer Zeit nicht mehr getränkt und gefüttert worden. Morgan sah, wie schlaff das Fell der Löwen an den abgemagerten Körpern hing. Es ist eine grausame Welt, dachte er.
Der Oger war noch am Leben, aber er hatte sich, seit Morgan im ersten Sonnenlicht des Tages auf der Bank saß, höchstens drei- oder viermal bewegt. Er schien schlauer gewesen zu sein als seine Mitgefangenen und hatte es geschafft, trotz seiner Ketten nicht zu verhungern und zu verdursten - bisher. Nun war er jedoch am Ende seiner Kräfte und dämmerte dem Tod durch Auszehrung entgegen.
Rechts von Morgan schlug die mechanische Uhr neun. Die kleinen Tierfiguren aus Zinn, die alle Kinder von Vengard zu jeder vollen Stunde in Entzücken versetzt hatten, spielten jetzt vor leeren Rängen. Der Bär stieß in sein Horn, der mechanische Scavenger schlug mit seinem Schnabel das Tambourin, der Goblin spielte Querflöte. Morgan lächelte bitter.
Düstere Töne. Die Suite zum Ende der Menschheit, arrangiert für mechanische Tiere.
Nach einer Weile verstummte die Uhr wieder, und Morgan hörte Vogelstimmen und das beruhigende Summen der Fliegen, die die toten Tiere umkreisten. Ein blauer Schmetterling tanzte an Morgans Gesicht vorbei, flatterte um eines der nahen Blumenbeete herum und ließ sich auf einer Pfingstrose nieder. Der Brustkorb des Ogers hob und senkte sich langsam.
Irgendwann mischte sich ein heiseres Schreien in die heitere Stille des Vormittags. Es war noch ziemlich weit entfernt, aber Morgan ahnte, dass er, bevor es Mittag wurde, eine weitere Begegnung mit dem Urheber des Geschreis haben würde.
Zum ersten Mal hatte er ihn in der vergangenen Nacht gehört, die er in den Ruinen des Innostempels verbracht hatte. Er hatte nicht gewusst, wohin er gehen sollte, als sich die Finsternis über die furchteinflößend ruhige Stadt gelegt hatte. Seine Kameraden waren gefallen oder lagen im Sterben, von den Generälen hatte er nichts mehr gesehen, seit die Orks das Schloss gestürmt hatten. Morgan vermutete, dass irgendein Zauber sämtliche Würdenträger sicher aus der Stadt gebracht hatte, als die letzte Bastion gefallen und es absehbar war, dass Rhobars Truppen der Übermacht der Orks nicht mehr würden standhalten können. Die jämmerlichen Reste des königlichen Heeres waren über die ganze Stadt versprengt, verwirrt, orientierungslos und ohne Führung. Einigen war die Flucht aus der brennenden Stadt gelungen, andere hatten, wie Morgan, Schutz in den Trümmern der Gebäude gesucht. Die Orks schienen sich nach dem Fall der Hauptstadt vorerst in ihr Lager außerhalb der Mauern Vengards zurückgezogen zu haben.
Als Morgan hinter dem umgestürzten Altar Innos’ gekauert und versucht hatte, dem Wahnsinn zu trotzen, der sich seiner hatte bemächtigen wollen, hatte die Stimme des Mannes, der dort schrie, dunkel und volltönend geklungen, wie die Stimme eines umnachteten Propheten, die durch die Straßen von Vengard schwebte, von den steinernen Wänden zurückgeworfen und durch das Echo verzerrt wurde.
Beliar! Beliar ist unterwegs! ER kommt!
Lange Zeit hatte es sich so angehört, als würde der Mann auf den Innostempel zuhalten und immer näher kommen. Morgan war überzeugt gewesen, dass im nächsten Moment die notdürftig versperrten Türen des Innenraums bersten und das Wesen, das seine düsteren Prophezeiungen schrie, mit gefletschten Zähnen vor ihm stehen würde, schwarz und riesig wie ein Troll.
Bereut! Beliar ist nah! Macht euch bereit! ER wird keinen leben lassen!
Zitternd hatte Morgan gelauscht, bis sich die Stimme wieder entfernt und allmählich im Dunkel der Stadt verloren hatte. Irgendwann war er in einen unruhigen Schlaf gefallen.
Am frühen Morgen hatte er den Mut gefasst, den Tempel zu verlassen. Die Straßen waren mit gefallenen Kriegern übersät, Orks und Menschen gleichermaßen. Das Stöhnen der Sterbenden war über Nacht fast gänzlich verstummt. Als Morgan ziellos durch die Trümmer Vengards streifte, hatte er von weitem den Mann gesehen, der die Ankunft des dunklen Gottes ohne Unterlass verkündete. Es war kein Troll, kein Dämon aus Beliars Reichs, sondern nur ein verrückter alter Mann in zerrissenen Lumpen und einem merkwürdigen Hut, auf dem keck etwas wippte, das einmal eine Raubvogelfeder gewesen war.
Sie hatten einander über die Ruinen hinweg angestarrt. Als die lähmende Furcht von Morgan abfiel, hatte er leicht die Hände erhoben, eine Geste, die er in den Jahren des Krieges verinnerlicht hatte.
Ich bin unbewaffnet.
Der alte Mann jedoch war voller Entsetzen davongelaufen und hatte über die Schulter gerufen, dass Beliar jeden Augenblick auftauchen würde. Dann war er über ein Trümmerstück gestolpert und der Länge nach auf den mit Blut besudelten Boden der Hauptstraße hingeschlagen, so dass ihm sein merkwürdiger Hut vom Kopf geflogen war. Morgan hatte sich in Bewegung gesetzt und war auf ihn zugelaufen, aber bevor er ihn erreichen konnte, hatte sich der Alte aufgerappelt, seinen Hut an sich gerafft und war zu der dicht mit Bäumen umsäumten Promenade gerannt. Dabei hatte er unaufhörlich seine Warnungen herausgeschrieen.
Morgan hatte einen angesichts der Situation absurden Anflug von Wut und Verärgerung verspürt. Seine Empfindungen gegenüber dem heruntergekommenen Propheten hatten sich innerhalb weniger Stunden von nacktem Entsetzen in Langeweile gewandelt.
Immer noch der alte Morgan.
Er verdrängte diesen unangenehmen Gedanken schnell und konzentrierte sich auf den sterbenden Oger. Morgan hatte keine Ahnung, was er tun sollte. Früher oder später würde ihm eine Idee kommen, wie er sich aus seiner misslichen Situation würde herauswinden können. Er hatte es bisher noch immer geschafft, am Leben zu bleiben. Und er würde es auch heute schaffen, die Stadt zu verlassen, bevor die Orks in geordneten Reihen in Vengard einmarschieren und die ehemalige Hauptstadt Myrtanas entweder dem Erdboden gleichmachen oder, Rhobar zum Hohn, als neue Königsresidenz wieder aufbauen würden. Er musste warten. Möglicherweise, dachte Morgan, war dies seine beste Eigenschaft. Warten können. Den Überblick behalten. Sich aus allen Schwierigkeiten herauswinden.
Seine Mutter war anderer Meinung gewesen… „Und was ist mit den anderen?“, hatte sie gefragt. „Was ist mit uns?“
Selbst schwimmen…oder eben untergehen…
Er hatte mit den Schultern gezuckt, nicht aus Trotz, sondern weil er nichts zu sagen gehabt hatte. Er hatte sich um diese Frage noch keine Gedanken gemacht. Vielleicht würde er morgen darüber nachdenken, aber nicht jetzt. Trotzdem hatte er gespürt, dass er ihr etwas antworten musste, so verlangten es die Spielregeln. Er hatte ein schiefes Lächeln aufgesetzt, das er für gewinnend hielt und gesagt:
„Nicht weinen, Mutter. Ich komm’ schon heil...“
Noch während er die Worte aussprach, hatte er Zorn in ihren Augen aufblitzen sehen. Nichts in seinem Leben hatte in je so erschreckt. Er war so plötzlich verstummt, als hätte jemand seine Worte mit einem scharfen Messer abgeschnitten.
„Ja“, hatte sie mir bebender Stimme erwidert, „du wirst zurückkommen. Aber erst dann, wenn du nicht mehr weißt, wohin du gehen sollst. Wenn du keinen findest, der dich aufnehmen wird. Ich habe niemals ein schlechtes Wort über dich gesagt, Morgan, niemals. Innos wird mir verzeihen, dass ich das sage, denn Innos weiß, dass es wahr ist. Willst du wissen, was ich denke? Du bist…“. Sie kämpfte einen Augenblick lang mit dem Wort, das ihr auf der Zunge lag, versuchte, es zurückzudrängen und hinunterzuschlucken, doch es ließ sich nicht mehr aufhalten. „Du bist ein selbstsüchtiger Egoist. Du kannst nur nehmen. Deshalb wirst du irgendwann zurückkommen. Weil du weißt, dass ich deine Mutter bin und geben muss.“ Ihre Augen hatten sich vor Entsetzen geweitet und sie hatte sich die Hand vor den Mund geschlagen. Tränen waren über ihre Wangen gelaufen.
„Morgan…“
Morgan hatte sich abgewandt, weil er nicht wollte, dass sie die Tränen in seinen Augen sah.
„Ich werde schon heute gehen, wenn du das willst. Wenn du mich nicht mehr ertragen kannst.“
Dann war ihm eingefallen, dass er erst in wenigen Tagen eine Unterkunft im Lager vor der Stadt bekommen konnte, in dem die bereits rekrutierten Soldaten auf die Abreise warteten. Er hatte kein Geld gehabt, mit dem er ein Zimmer bei Hanna oder eine Mahlzeit bei Coragon hätte bezahlen können. Der Gedanke hatte ihn mit Unbehagen erfüllt.
„Bitte nicht“, hatte sie leise gesagt, „bitte geh noch nicht. Ich möchte, dass du bleibst, solange es möglich ist. Ich habe ein paar gute Sachen bei Fenia gekauft. Hast du vielleicht gesehen.“
„Also gut“, hatte er gesagt und sich wieder gut gefühlt, richtig gut. Er reiste wieder umsonst. Immerhin war sie seine Mutter, und sie hatte ihn darum gebeten. Richtig, sie hatte ein paar Dinge gesagt, die ihn getroffen hatten, bevor sie ihn gefragt hatte, aber sie hatte gefragt. Das war doch so gewesen, oder?
Plötzlich war sich Morgan, als er dort auf seiner Bank saß und dem Oger beim Sterben zusah, nicht mehr ganz sicher, ob es so gewesen war.
Er sah hoch zum Himmel und blinzelte in die Sonne, die den Park in warmes Licht hüllte. Und obwohl kein Schatten das helle Licht des Innosgestirns trübte, musste Morgan plötzlich daran denken, wie es gewesen war, als der Mond das strahlende Antlitz der Sonne verdunkelt hatte. Es war gut, sich daran zu erinnern, denn im Nachhinein kam es Morgan so vor, als sei er an diesem Tag zum letzten Mal glücklich gewesen.
Bevor er sich im Streit von Fergus getrennt hatte.
Bevor der Mond die Sonne verdunkelt hatte.
Und obwohl Morgan alles dafür getan hätte, Fergus noch einmal wiederzusehen und ihn um Verzeihung bitten zu können für das, was er ihm angetan hatte, stieg wieder Verärgerung in ihm auf, als er an die Worte dachte, die ihm sein Freund an jenem Tag entgegengeschleudert hatte.
Immer noch der alte Morgan.
„Lass mich einfach in Ruhe“, murmelte er, ohne zu wissen, wen oder was er eigentlich meinte.
Doch es dachte nicht daran, ihn in Ruhe zu lassen. Plötzlich kam ihm die Wirklichkeit dünn vor, sehr dünn. Der Krieg, der Fall Vengards…das alles, was um ihn herum geschah, wie bedeutend und entsetzlich es auch sein mochte, es war nicht mehr als ein Tuch, das über Dunkelheit gebreitet worden war. Das ist vielleicht der Grund, warum wir die Gesichter von Toten bedecken, dachte Morgan zusammenhangslos. Sie sind eine Art Tor, das uns noch verschlossen ist. Aber es wird nicht immer so bleiben. Eines Tages öffnet es sich…
Das Tuch wurde fadenscheinig, und das Gesicht darunter lugte hervor. Die Sonne begann sich zu verdunkeln.
Mit Entsetzen erkannte Morgan, dass hier und jetzt, auf einer Bank im Park der in Trümmern liegenden Königsresidenz, zwischen den Leichen erschlagener Krieger und den Kadavern verhungerter Tiere, am ersten Morgen nach dem Ende der Herrschaft der Menschen in Myrtana die Zeit gekommen war. Die Zeit der Erinnerung, vielleicht auch die Zeit der Abrechnung. Er schmeckte Meerwasser im Mund. Sand knirschte zwischen seinen Zähnen. Morgan keuchte. Er konnte auf einmal nicht mehr atmen. Er begann zu husten und würgte Salzwasser hervor. Er spürte, wie er über sandigen Boden rollte, sein Haar war nass, seine Hände krümmten sich um…um etwas allzu Nachgiebiges, das dem Druck seiner Finger nicht lange würde standhalten können. Blasse, mit Sand verklebte Hände fuhren ziellos durch sein Gesicht, zerkratzten es verzweifelt…Wieder musste Morgan husten. Er rang nach Luft, doch er konnte seine Hände nicht lösen. Er wusste nicht einmal, ob er seine Hände lösen wollte. Er…
„Beliar ist nah! Bereut! ER wird keinen am Leben lassen!“
Morgan riss entsetzt die Augen auf. Er lag auf dem Rasen vor der steinernen Parkbank, schwer atmend, zitternd, schweißüberströmt, die Hände zu Klauen verkrampft. Mit einer raschen Bewegung rappelte er sich auf. Er musste vorsichtig sein. Was auch immer eben mit ihm geschehen war, es war nicht mehr wichtig.
„Beeeliar! Beliar wird uns alle vernichten! Bereut und macht euch bereit!“
Die Stimme des Alten, die jetzt heiser und angestrengt klang, war sehr nah. Wahrscheinlich predigte er hinter einer der Reihen blühender Ginsterbüsche. Morgan setzte sich wieder auf die Bank. Von dem verrückten Greis ging keine Gefahr aus, dessen war er sich sicher. Irgendwie schien auch der Alte zu spüren, dass Morgan in der Nähe war, denn die Stimme wurde wieder leiser, suchte andere, tote Zuhörer.
Morgan ahnte, dass es bald Zeit sein würde, die Stadt zu verlassen. Die Orks würden binnen kurzem einmarschieren, und es lag auf der Hand, dass sie mit den Morras, die sie noch lebend antrafen, nicht zimperlich sein würden. Er überlegte einen Moment, ob er versuchen sollte, den Alten mit sich zu nehmen. Doch das würde ihn wertvolle Zeit kosten, Zeit, die er vielleicht gar nicht mehr hatte. Womöglich würde er den Mann sogar bewusstlos schlagen müssen, um ihn aus der Stadt schaffen zu können. Der verrückte Alte würde selber schwimmen müssen…oder eben untergehen.
Der Oger starb um Viertel vor zwölf. Seine Lider flatterten, er kippte nach vorne und landete mit einem unbeschreiblichen Geräusch auf dem Steinboden des Käfigs. Eine grausame Welt, dachte Morgan noch einmal. Er wollte nicht mehr auf dieser Bank sitzen bleiben.
Geändert von El Toro (02.08.2013 um 09:28 Uhr)
-
XI. Jenna. Ein dunkles Bild.
Zuerst nahm Jenna die Stimmen wahr, die durch die strahlendweißen Stoffbahnen gedämpft an ihre Ohren drangen. Sie konnte nicht verstehen, was diese Stimmen sagten - sie fragte sich, wie das wässrige Gluckern und Murmeln überhaupt einer menschlichen Kehle entspringen konnte -, aber es war offensichtlich, dass zwei
Wesen
Menschen gedämpft miteinander sprachen.
Jenna hob ihren Kopf. Die Bewegung schien unendlich lange zu dauern, doch sie bereitete ihr weder Mühe noch Schmerzen. Im Gegenteil. Eine wohlige Ruhe hatte sich in ihrem Körper ausgebreitet, der sich warm und geschmeidig anfühlte.
Ich hatte Schmerzen.
Hatte sie Schmerzen gehabt? Ja, zweifellos. Aber die waren nicht mehr wichtig. Jenna sah sich um. Sie lag in einem mit weißen Laken überzogenen Bett, um sie herum bauschten sich Vorhänge in demselben strahlenden Weiß. Das Bett schien sich unter einem Baldachin zu befinden, der es von allen Seiten rings umgab. Licht fiel durch den dünnen, hellen Stoff und brachte ihn zum Leuchten. Winzige Staubkörnchen tanzten in diesem Licht.
Jenna betrachtete wie bezaubert die friedliche, gleichmäßige Bewegung der glitzernden Pünktchen. So fühlte es sich an, wenn man elf Jahre alt war und an einem Morgen in seiner Hütte am Strand von Khorinis nach eigenem Belieben erwachen durfte. Man lag mit offenen Augen da und sah nichts als den Tanz der Staubkörner in den schmalen Streifen des Lichts, das durch die Spalten in den Fensterläden in das Zimmer fiel.
Irgendetwas, das auf seine Gelegenheit - vielleicht seine einzige - gewartet hatte, bekam den äußersten Saum von Jennas Verstand zu fassen und schlug seine kleinen, spitzen Zähnchen hinein.
Jenna verspürte den Anflug eines Gefühls, das sie nicht einordnen konnte. Dieser winzige Moment der Beunruhigung reichte aus, um den Bann der Staubkörnchen zu brechen. Der Raum war hell, strahlend hell, doch ihr schien es plötzlich, als würde sie alles wie durch ein Glas sehen oder durch einen Spiegel mit geschwärzter Silberfolie. Plötzlich musste sie an ein Stück Fensterglas denken, in einen Holzrahmen gefasst, damit sie sich nicht an den Kanten schnitt und mit Kohle aus dem Kamin geschwärzt. Sie hatte so etwas einmal besessen. Wozu? Sie versuchte angestrengt, sich daran zu erinnern, doch immer, wenn sie einen Fetzen dieser Erinnerung erwischte, löste er sich in ihren Händen auf wie eine Schneeflocke im März.
Jenna sah an sich herunter.
Sie war bis zur Brust mit einem weißen Laken zugedeckt, an den Gelenken ihrer Hände, die ihr jemand sorgsam auf Höhe der Rippen gefaltet hatte, leuchteten blütenweiße Verbände. Man hatte ihr ein schlichtes, weißes Leinenhemd angezogen. In all diesem Weiß fiel Jennas Haar wie Ströme geschmolzenen Kupfers über die Laken. Wieder schlugen warme Wogen heiterer Ruhe über ihr zusammen und luden sie ein, sich treiben zu lassen.
Jenna…
Jenna schreckte hoch. Diese Stimme… Die Worte waren leise, aber deutlich vernehmbar gewesen, auch über das gedämpfte Murmeln jenseits der Vorhänge hinweg. Näher, viel näher. Sie sah sich um, konnte aber nichts erkennen als die dichten, weißen Schleier rings herum.
Sei ganz still.
Die Stimme kicherte leise. Es war kein hämischer, verletzender Laut, es klang heiter wie das mühsam unterdrückte Lachen eines kleinen Mädchens mit einem wunderschönen Geheimnis.
Es klang wie das Lachen Cassias.
„Cassia?“, flüsterte Jenna so leise sie konnte. Sie fror plötzlich. Der Gedanke, Cassia könnte hier sein, womöglich unter Jennas Bett, war absurd. Und selbst wenn Cassia hier wäre, dann wäre sie kein kleines Mädchen mehr, sondern ebenso eine erwachsene Frau wie sie.
Die Stimme kicherte wieder.
„Wo bist du?“, wisperte Jenna, ohne eine Antwort zu erwarten. Es war völlig unmöglich, dass…
Ich bin bei dir.
Jenna keuchte leise auf. Die Stimme war ganz nah gewesen, so als…als sei sie in ihrem Kopf.
Vielleicht bin ich das.
Dann, mit plötzlicher Hast:
Hör zu, du musst…
„Was? Was muss ich?“ hauchte Jenna in die strahlend weiße Stille.
Stille?
Die Stimmen außerhalb des Baldachins waren plötzlich verstummt. Noch bevor Jenna die Gelegenheit hatte, darüber nachzudenken, wurde der Vorhang zur Seite gezogen und eine Gestalt schob sich wie ein schwarzroter Fremdkörper durch die weißen Stoffbahnen.
Jennas Augen weiteten sich vor Entsetzen.
Es war der Milizionär, der sie vor einigen Tagen in den Wachturm geführt, angekettet und dort einfach vergessen hatte. Doch…etwas war mit ihm geschehen. Etwas wirklich Schlimmes.
In der schmutzigen Rüstung der Stadtmiliz steckte ein Leichnam. Dessen war sich Jenna sicher, denn nichts auf der Welt konnte so zerfressen sein und trotzdem noch leben. Die Haut auf der Stirn des Mannes war aufgeplatzt und gab den Blick auf weißen Knochen frei, der hier und da noch von einer rötlich schimmernden, schleimigen Masse bedeckt war. Die Nase war eine Brücke aus rohem Knorpel über zwei flammendroten Kanälen. Ein Auge funkelte in einem heiteren Blau, das andere schien nur noch aus braunschwarzem, schwammigem Gewebe zu bestehen. Seine Oberlippe fehlte völlig, so dass das Geschöpf wie eine tollwütige Ratte aussah. Nur das schwarze Haar erinnerte noch an den Milizen, der sie in diese von allen Göttern verfluchten Ketten gelegt hatte. Zwischen den schwarzen Strähnen, die nun wirr uns struppig von dem entsetzlich veränderten Schädel abstanden, kroch irgendetwas herum.
Das Wesen streckte eine seine mit Geschwüren bedeckten Hände in einer merkwürdig höflich anmutenden Geste aus, als würde es sie galant zum Tanz auffordern. Jenna drückte sich wimmernd in das Kissen. Ihr Besucher wiederholte die Geste etwas nachdrücklicher, und mit albtraumhaften Entsetzen bemerkte Jenna, dass sie der Aufforderung Folge leistete, obwohl ihr Verstand hysterisch dagegen protestierte. Doch schon im nächsten Moment berührten ihre nackten Füße den warmen Holzboden des Raums und sie sah, wie sich ihre eigene, mit weißen Binden umwickelte Hand den bläulichen Fingern des Milizen näherten.
Wenn ich ihn berühre, werde ich sterben. Ich werde genauso verfaulen wie er. Ich werde…
Doch als sich ihre Hände trafen, geschah nichts. Die Finger des Wesens waren warm und lebendig, während ihre eigenen kalt wie Eis waren.
Das Geschöpf führte sie durch die weißen Schleier des Baldachins hindurch. Das Sonnenlicht zauberte ein Rillenmuster auf sein Gesicht, das von den Gittern vor dem Fenster stammte. Jenna bewegte sich mit traumwandlerischer Sicherheit durch die Wärme des sonnendurchfluteten Raums. Helligkeit umgab sie, und sie nahm die Farben in ihrer Umgebung in einer nie gekannten Intensität wahr: Alles leuchtete ihr entgegen, so heiter und so einladend. Und dennoch… Das kleine Ding, das sich am äußersten Zipfel ihres Bewusstseins festgebissen hatte, begann wild zu toben.
Ein dunkles Bild, so als ob man durch geschwärztes Glas schaut.
Dann wogten Licht und Wärme über Jenna hinweg und spülten das kleine, kreischende Etwas mit den weißen, spitzen Zähnchen fort. Sie hatte keine Angst, sie empfand nichts außer dieser Wärme. Ein weiterer toter Milize stand nahe der schweren Holztür und starrte sie an. Als sie an ihm vorüberging, nahm sie seinen Geruch wahr. Faulendes Herbstlaub unter einer Veranda. Der aufgeblähte Leib einer toten Katze, in deren Augen bereits Würmer umher krochen.
Das Wesen führte sie an seinem verrottenden Kameraden vorbei in einen weiteren Raum. Als sich Jennas Fingerspitzen von denen des Milizen lösten und sich das Geschöpf zum Gehen wandte, fühlte Jenna, wie die Wärme und das Licht aus ihr herauszuströmen schienen. Hier war es dunkler. Die hypnotische Ruhe fiel, Stück für Stück, von ihr ab und die Angst legte sanft ihre kalte Hand auf Jennas Schläfen, liebkoste sie…und packte zu. In plötzlicher Panik sah sie sich um. Sie befand sich in einem großen, weitläufigen Raum mit Holzbänken, die an den Wänden standen. Eine weitere Tür lag der, durch die sie eingetreten war, gegenüber. Durch ein kleines Fenster fiel gerade so viel Sonnenlicht, dass Jenna zunächst vor den Schatten, die sich gierig in den Ecken des Raumes drängten, in Sicherheit war. Sie versuchte, ihre Lage einzuschätzen, doch sie musste immer wieder zur Tür am anderen Ende des Zimmers sehen. Sie hatte das unbestimmte Gefühl, dass sich diese Tür bald, sehr bald öffnen würde. Sie wusste nicht, was dann geschehen würde, aber es lag auf der Hand, dass hinter dieser Tür Antworten lauerten. Mit rasch klopfendem Herzen ging Jenna zu dem Fenster und blickte hinaus. Ein Kastanienbaum leuchtete grün im weichen Licht der Nachmittagssonne. Er stand inmitten eines kleinen, gepflegten Parks, der von einem hübschen, schmiedeeisernen Zaun umgeben war. Es war keine Menschenseele zu sehen. Wieder blickte Jenna zu der Tür, doch auch hier war nichts zu sehen.
„Cassia?“, flüsterte Jenna.
Keine Antwort. Sie war allein. Sie konnte nichts tun als warten. Durch das Fenster konnte sie beobachten, wie sich das Blau des Himmels über Khorinis ganz allmählich in samtiges Dunkelviolett verwandelte. Es war, als…
Lass es. Hör auf. Hör einfach auf, daran zu denken.
Cassia klang plötzlich gar nicht mehr wie das heitere kleine Mädchen, das sie zu sein vorgab. Jenna wusste natürlich, dass Cassia Recht hatte. Cassia hatte am Schluss immer Recht behalten, war es nicht so? War sie es nicht gewesen, die ihr am Morgen des…
Hör verdammt noch mal auf!
Jenna hätte alles darum gegeben, einfach aufhören zu können, doch die Decke hatte schon zu viele Löcher bekommen. Viel zu viele. Und durch einen dieser Risse im Gewebe sah Jenna den Abendstern leuchten, diesen verdammten Abendstern, der immer noch so milde und gleichgültig zu lächeln schien wie damals, damals, und sie konnte nicht mehr aufhören, konnte nicht aufhören, daran zu denken, sich zu erinnern und dann sah Jenna…
-
XII. Jenna. Kein großer Verlust.
...den Abendstern schwach am dunkler werdenden Himmel leuchten. Sie saß mit einem Buch in der Hand hinter der Hütte, die sie mit ihrer Mutter und Cassia bewohnte. Was aus ihrem Vater geworden sein mochte, wusste nur Adanos…oder Beliar.
Jenna hatte gesagt, dass sie vor Sonnenuntergang noch einige Zeilen lesen wollte und hier, hinter der Hütte, war das Licht dafür am günstigsten. Ihre Mutter hatte nur geistesabwesend genickt und sich ihrem Schwager zugewandt. Ezechiel hatte heute Abend mit ihnen gegessen, und Jenna wusste, dass nun der Zeitpunkt gekommen war. Hätte jemand das Mädchen beobachtet, das auf der mit weißen Leinenkissen gepolsterten Bank in einem kleiner und kleiner werdenden Rechteck aus Sonnenlicht saß, hätte er sich vielleicht über ihre angespannte Haltung gewundert. Hätte er einen zweiten Blick auf das Kind geworfen und sich nicht vom verwirrenden Spiel der Abendsonne in dessen rotleuchtenden Locken verzaubern lassen, wäre ihm vielleicht aufgefallen, dass er den Titel des Buchs in der Hand des Mädchens nicht lesen konnte. Wie auch? Das Kind hielt das Buch verkehrt herum.
Jennas Absichten an diesem Abend waren tatsächlich nicht literarischer Natur. Sie hätte jede Zeile des kleinen Büchleins auswendig aufsagen können, aber hätte man sie in diesem Augenblick danach gefragt, hätte sie verwirrt und ratlos von den zerlesenen Seiten aufgeblickt und irgendetwas gestammelt.
Nein, zum Lesen war sie wirklich nicht hierher gekommen: Sie wollte hören, wie Ezechiel seinen
ihren
Vorschlag unterbreitete und ihn mit all ihrer Kraft stumm anfeuern. Sie und Cassia hatten schon vor Jahren festgestellt, dass die verhältnismäßig hohe Giebeldecke der Hütte eine eigenwillige Wirkung auf den Schall hatte. Was im Esszimmer gesprochen wurde, konnte man hier so gut verstehen, als wäre man hinter dem Geschirrschrank versteckt. Alle wichtigen Entscheidungen der Erwachsenen waren Jenna und Cassia meist schon bekannt, bevor die Marschbefehle vom Stabshauptquartier ergingen.
Jenna kicherte leise. Weder ihre Mutter noch Ezechiel konnten ahnen, dass sie wie ein richtiger Kundschafter der königlichen Armee auf der Lauer lag. Anfangs hatte sie ein wenig Scham empfunden,
Horchen darf man nicht
aber nicht so sehr, dass sie es unterlassen hätte. Außerdem stand sie doch immer noch auf der richtigen Seite dieser dünnen moralischen Linie. Schließlich war es nicht so, dass sie sich wirklich hinter dem Geschirrschrank versteckte. Sie saß für alle gut sichtbar hier draußen im warmen Schein der untergehenden Sonne. War es ihre Schuld, dass ihre Mutter dem bedauerlichen Irrtum erlag, niemand könne sie hören, nur weil sie drinnen am Tisch saß? Sollte sie etwa hineingehen und es ihr sagen?
Jenna schlug die Hände über ein Grinsen, das ihr albern und kindisch vorkam. Dabei fiel die Ausgabe der Geschichte um das kleine Mädchen mit dem weißen Kaninchen zu Boden.
Hastig bückte sie sich und hob das Buch auf. Diesmal hielt sie es richtig herum und las sogar die erste Zeile auf der Seite, die sie wahllos aufgeschlagen hatte:
„Wollen Sie mir gütigst sagen“, fragte sie die Herzogin etwas furchtsam, denn sie wusste nicht recht, ob es sich für sie schicke zuerst zu sprechen, „warum Ihre Katze so grinst?“
Ihre Wangen röteten sich leicht vor Scham, doch bevor sie weiter darüber nachdenken konnte, hörte sie Ezechiels Stimme von drinnen:
„Ich glaube nicht, dass es ihr schaden würde, morgen hier bei mir zu bleiben, du etwa?“
Jenna freute sich über den belustigten, einnehmenden Unterton, der in seiner Stimme lag.
„Selbstverständlich nicht, aber es würde ihr auch nicht schaden, wenn sie diesen Sommer einmal nicht vergessen würde, wessen Tochter sie ist und den Tag mit Cassia und mir verbringen würde.“
Die Antwort ihrer Mutter klang eisiger, als Jenna es erwartet hatte.
„Liebes, vergangene Woche war sie doch mit euch im Marionettentheater, und du hast mir selbst gesagt, dass sie Cassia von ihrem eigenen Geld Bonbons gekauft hat…“
Grimmig fuhr ihre Mutter dazwischen:
„Das war ja auch kein Opfer für sie.“
Nach einem kurzen Schweigen wieder Ezechiels Stimme, verblüfft:
„Was meinst du denn damit?“
„Ich meine, dass sie mit uns ins Marionettentheater gegangen ist, weil sie Lust dazu hatte und genauso hat sie sich um Cassia gekümmert: Weil sie Lust dazu hatte.“
Die Grimmigkeit war einem anderen, völlig unvermuteten Tonfall gewichen: hilflose Verzweiflung.
„Ist es denn ein Grund zur Besorgnis, wenn sie etwas macht, weil sie Lust dazu hat?“, fragte
Ezechiel mit freundlichem Spott. „Willst du sie deshalb etwa in das Heim der Innosliebenden Schwestern der letzten Tage für schwer erziehbare Mädchen stecken?“
„Mach dich nicht über mich lustig, Ezechiel. Du weißt, was ich meine.“
Wieder lachte Ezechiel gutmütig.
„Nein, meine Liebe, ich weiß es nicht. Morgen ist ein Feiertag zu Ehren unseres Herrn Innos, dem es gefällt, uns mit einem Schauspiel zu erfreuen, das seinesgleichen sucht. Ich bin nur ein einfacher Mann, und ich habe immer gedacht, dass man an Feiertagen tun und lassen darf, wozu man Lust hat, solange es Ihm nicht missfällt.“
Jenna lächelte, weil sie wusste, dass es beinahe geschafft war. Sie war noch keine zwölf Jahre alt, aber sie wusste, auf welchen Bahnen die Gespräche zwischen Erwachsenen mäanderten. Wenn der Schatten des Mondes das feurige Antlitz der Sonne morgen bedeckte, würde sie hier sein. Mit Ezechiel, und nicht mit Mutter und Cassia bei der dummen, alten Marta.
Er hat ihr regelrecht das Fell über die Ohren gezogen.
„Du könntest doch mit zu Marta kommen, Ezechiel. Es würde ihr sicher nichts ausmachen. Jenna würde mitgehen, wenn du mitgehen würdest.“
Jenna sog scharf Luft ein. Jetzt war es gefährlich. Sie hatte ihre Mutter unterschätzt.
„Das geht nicht, Liebes. Ich will ehrlich zu dir sein: Ich mag diese alte Kräuterhexe nicht, die mit ihrer Rute schneller ist als mit ihren Gedanken.“
„Ezechiel!“
„Keine Sorge. Wer soll uns denn hören? Cassia ist bei Zuris und hilft im Laden, und Jenna? Sie sitzt da draußen und liest. Sieh doch!“
In diesem Augenblick war Jenna überzeugt, dass er es wusste. Er wusste, dass seine Nichte jedes Wort der Unterhaltung mit anhörte. Und ein weiterer Gedanke beschlich sie:
Er will, dass ich jedes Wort mit anhöre.
Ein warmes Kribbeln lief ihr den Rücken hinab.
„Ich hätte es wissen müssen, Ezechiel.“ Jennas Mutter lachte höhnisch auf. „Du solltest langsam einsehen, dass Marta eine einsame, alte Frau ist, die Jenna vor fünf Jahren aus Versehen mit der Weidenrute erwischt hat! Sie hat es nicht einmal böse gemeint.“
Das Lachen ihrer Mutter hörte sich jetzt wie ein Schluchzen an.
Jenna biss sich auf die Unterlippe, um einen Laut der Empörung zu unterdrücken. Die alte Marta hatte es böse gemeint. Auch wenn die Angst vor dieser alten Hexe schon lange auf und davon geflogen war wie ein Star beim ersten Frost, so war sie sich ganz sicher, dass der Schlag damals absichtlich geschehen war. Jenna fragte sich nicht zum ersten Mal, ob es nicht eher eine Strafe Innos’ als eine Gnade war, erwachsen zu werden. Wie konnte ihre Mutter das glauben? Konnte sie so dumm sein? Die Antwort lag auf der Hand: natürlich nicht. Aber ihre Mutter zog es vor, einer alten Kräuterhexe mehr zu glauben als ihrer eigenen Tochter.
Weil er zu mir hält, deshalb.
Jenna sah zum Himmel. Der Abendstern leuchtete sanft und mild, und auch die letzten, verirrten Strahlen der Abendsonne waren erloschen. Sie formte die Hand zu einem Guckrohr und betrachtete den Stern.
Die Zeit vergeht schnell, wenn man Unterhaltungen über sich selbst belauscht.
Das nächste, was Ezechiel sagte, konnte sie nicht verstehen. Sie hörte nur seinen Tonfall: sanft, leise, tödlich.
Dann ihre Mutter, die aufschrie:
„Hör auf mit diesem Kreuzverhör! Ich habe es satt.“
Jenna hörte, dass sie weinte oder zumindest im Begriff dazu war. Doch die Tränen ihrer Mutter lösten an diesem Abend nicht den Drang aus, selbst in Tränen auszubrechen, wie sie es als kleines Mädchen immer getan hatte. Stattdessen empfand sie eine seltsame, steinerne Befriedigung.
Sie war gerade dabei, sich von den weißen Kissen zu erheben, um ins Haus zu gehen, als sie noch einmal die Stimme ihrer Mutter hörte, ein trockenes Zischen, wie wenn man ein Streichholz anreißt.
„So ist das mit unserer Jenna. Sie ist nie zufrieden, wenn sie nicht das letzte Wort hat. Nie zufrieden mit den Plänen von anderen. Nie imstande, sich überhaupt mit etwas zufrieden zu geben, wenn es nicht von ihr selbst kommt. Weißt du was? Soll sie doch hier bei dir bleiben. Es wäre ohnehin kein großer Verlust, sie nicht dabei zu haben.“
Mit Bestürzung stellte Jenna fest, dass in der Stimme ihrer Mutter so etwas wie Hass lag.
Geändert von El Toro (02.08.2013 um 09:35 Uhr)
-
XIII. Sieben fette Jahre, sieben magere Jahre
Daron saß im flackernden Licht der Kerze an seinem Schreibtisch. Das Kratzen seiner Feder war das einzige Geräusch in dieser mondlosen Nacht.
Sieben Jahre…
Schweißtropfen liefen an seiner Stirn hinab, obwohl es kühl war im Gemach des Hochmagiers. Er war so vertieft in seine eigene Geschichte, dass er das qualvolle Jucken auf seiner Brust kaum noch wahrnahm, das ihn seit einigen Nächten wach hielt. Es war, als kröchen Insekten mit winzigen Widerhaken an ihren Beinen über sein Fleisch und bohrten sich hinein. Doch Daron wusste, dass es genau andersherum war.
Sieben Jahre…
Ein Schweißtropfen landete auf dem Papier, das Daron mit engen Buchstaben füllte. Es war ein Brief an Altus, den einzigen Mann, der ihm jetzt vielleicht noch helfen konnte. Doch Altus weilte in Nordmar, und der Brief würde lange Zeit brauchen, den Herrn des Innosklosters zu erreichen. Daron seufzte und kratzte sich mit seinem linken Haken an der Brust. Ein rasender Schmerz fuhr durch seinen Körper. Daron stöhnte, biss die Zähne zusammen und schrieb weiter. Die Feder klemmte in einer Vorrichtung, die an seinem rechten Haken angebracht war.
Seit vierzehn Jahren war er Leiter und einziger Hochmagier des Klosters von Khorinis, und seit sieben Jahren endeten seine Arme in Stümpfen.
Sieben fette Jahre, sieben magere Jahre…
„Nachdem Pyrokar und Ulthar tot und Serpentes wahnsinnig geworden war, mussten wir alle unsere Kräfte aufbieten, unser schreckliches Geheimnis unter Verschluss zu halten…“
Daron griff nach einem Schwämmchen, tränkte es mit einer klaren Flüssigkeit und wischte die gerade geschriebenen Worte vom Papier. Er ließ es einen Moment lang trocknen und setzte von Neuem an:
„Erinnert Ihr Euch an die Sonnenfinsternis vor vierzehn Jahren, Meister Altus?“
Daron schrieb und schrieb, bis rechter Armstumpf schmerzte. Draußen hatte es zu dämmern begonnen, und der Himmel hatte ein hässliches Violett angenommen.
„Es war ein Irrweg. Serpentes war fehlgeleitet worden von trügerischen Visionen. Er glaubte bis zuletzt, Innos selbst habe zu ihm gesprochen. Ihn trifft keine größere Schuld als uns alle, die wir dem Ritual beiwohnten. Wir taten es für Innos, unseren Herrn.“
Sieben Jahre lang hatte Daron das Kloster geleitet und den Mantel des Schweigens über die grässlichen Vorfälle während der Sonnenfinsternis gebreitet, als das Jucken begann. Es hatte sich zunächst angefühlt, als ob tiefe Schnittwunden an seinen Fingern verheilten – nur, dass er gar keine Wunden dort hatte. Und eines Abends…
„Im trüben Licht der Öllampe betrachtete ich lange meine Hände. Zuerst dachte ich, ich hätte unachtsam eine giftige Pflanze berührt. Die Fingerspitzen waren rot, und ich sah wie mit dem Zirkel gezogene winzige rote Kreise oberhalb der Fingerkuppen. Auch zwischen dem ersten und zweiten Glied entdeckte ich diese Kreise. Ich hob die Finger der rechten Hand an die Lippen, und mich packte dumpfes Entsetzen. Die Stellen mit den roten Flecken fühlten sich heiß an, fiebrig sogar, aber die übrige Haut war weich und kalt wie die eines verrotteten Apfels. Meine Kehle war wie zugeschnürt…“
Daron erinnerte sich daran, wie er versucht hatte sich einzureden, dass er tatsächlich irgendeine giftige Pflanze berührt hätte. Dann war ihm ein entsetzlicher Gedanke gekommen und hatte sich mit aller Macht in seinem Verstand festgebissen. Der Gedanke hieß Tante Violet. Tante Violet hatte die letzten zehn Jahre ihres Lebens völlig allein in einer Kammer im Obergeschoss seines Elternhauses gelebt. Darons Mutter hatte ihr täglich das Essen hinaufgebracht, und ihr Name durfte nicht erwähnt werden. Später, sehr viel später, hatte Daron erfahren, dass Tante Violet an einer Krankheit litt, die Lepra hieß.
„Das Jucken wurde immer schlimmer. Ich zog medizinische Lexika zu Rate, aber ich fand keine Erklärung für meine Symptome. Alles zu vage. Ich bandagierte meine Hände und gab vor, eine Verbrennung erlitten zu haben.“
Drei Wochen hatte Daron gehofft, dass die Beschwerden von alleine verschwinden würden, oder dass er eines Morgens wie aus einem Alptraum aufwachen würde und alles wäre vorbei. Er hätte sich an Neoras oder einen anderen Magier gewandt, wenn…
Lepra
…wenn er nicht dauernd an Tante Violet hätte denken müssen, die man gefangen gehalten hatte und die bei lebendigem Leibe verfault war. Außerdem hatte man im Kloster nun seit sieben Jahren ein Geheimnis, eine eigene Tante Violet, die eingesperrt werden musste und deren Namen nicht erwähnt werden dufte. Man hatte sich daran gewöhnt, Dinge für sich zu behalten.
„Eines Abends hatte ich die Bandagen abgenommen, um eine neue Salbe zu versuchen, die ich mir von einem Kräuterweib hatte beschaffen lassen. Ich lehnte mich in meinen Sessel zurück, schloss die Augen und drehte den irdenen Salbentopf in den Händen. Ich starrte noch immer auf den Salbentopf in meinen Händen. Ich hatte die Augen geschlossen und sah den Topf in meinen Händen. Was ich sah, war verschwommen und monströs, ein verzerrtes und abscheuliches Abbild eines Salbentopfes, aber als solcher zu erkennen.
Und ich war nicht der einzige Betrachter.
Ich riss die Augen auf und spürte, wie sich mein Herz zusammenzog. Ich betrachtete den Topf und sah mit eigenen Augen die braune, raue Oberfläche, das Etikett mit der krakeligen Schrift des Kräuterweibes, und gleichzeitig sah ich alles von unten, in einem anderen Winkel und aus anderen Augen. Ich sah keinen Topf mit Salbe mehr, sondern etwas Schauriges, Fremdartiges. Ich schlug die Hände vor die Augen. Der Topf fiel zu Boden und zersprang, doch das nahm ich kaum wahr. Ich sah mein Zimmer als Vision des Grauens, und ich schrie. Durch die Risse in meinem Fleisch schauten goldene Augen mich an. Aber deshalb schrie ich nicht. Ich hatte mir selbst ins Gesicht gesehen und ein Ungeheuer erblickt.“
Daron atmete schwer. Seine Brust juckte fast unerträglich. Er fragte sich nicht zum ersten Mal, ob man das Schlimmste nicht hätte verhindern können, wenn man Altus oder einen anderen Hochmagier aus Nordmar zu Rate gezogen hätte. Er dachte an Gorax’ Worte nach dem Vorfall während der Sonnenfinsternis vor vierzehn Jahren.
Wenn ihr nach Hause kommt und findet euren Vater überfallen und eure Mutter geschändet vor, was tut ihr dann? Ihr bedeckt zuerst ihre Blöße, und erst dann überlegt ihr, wem ihr von dieser grässlichen Tat berichtet. Die Kirche Innos ist uns Vater und Mutter zugleich, und es ist unsere heilige Pflicht, ihre Blöße zu bedecken, damit sie nicht dem Spott der Welt anheimfallen!
Sie hatten alle zugestimmt. Tante Violet wurde eingesperrt und ihre Tür versiegelt.
„Ich sollte sein Tor sein. Er versuchte, es mit Gewalt zu öffnen. Hundertmal am Tag sah ich etwas Vertrautes, und die Augen zwangen mich, es ihnen zu zeigen. Ich streckte die Hände aus und sah etwas Verborgenes, etwas Obszönes. Ich war sein Fenster zur Welt, ich empfand seinen Ekel und sein Entsetzen und wusste, dass seine Welt zutiefst verschieden sein musste. Sein Fleisch steckte in meinem, und ich fühlte seinen blinden Hass.“
Daron brachte es nicht über sich, Altus zu schildern, wozu ihn die Augen hatten bringen wollen. Er brachte es auch nicht über sich, von jener Nacht zu berichten, als er das Fass mit Reisschnaps aus der Vorratskammer geholt und seine Hände mit der kühlen, klaren Flüssigkeit überschüttet hatte. Wie hatten die Augen geschrieen! Der Schmerz war unbeschreiblich gewesen. Daron hatte damals nicht geglaubt, dass er den Weg bis zum Heiligen Feuer Innos’ noch schaffen würde. Aber er hatte ihn geschafft.
Das alles lag sieben Jahre zurück. Man hatte ihn viele Wochen behandelt, und schließlich hatten sie ihm diese Haken geschmiedet. Ein Jahr lang hatte er entsetzliche Schmerzen gehabt, aber es war vorbei gewesen.
Darons Brust juckte unerträglich. Er öffnete seine Robe und sah, dass es zu spät war. Altus würde nichts mehr tun können. Der Brief würde ihn nie erreichen. In einem perfekten Kreis wuchs ein großes goldenes Auge aus Darons Brust.
Geändert von El Toro (05.08.2013 um 08:41 Uhr)
-
XIV. Morgan. Kammerspiel.
Morgan sah in das dunkle Halbrund des Tunnels. Das Tageslicht schien bereits nach wenigen Schritten in den feuchten, moosbewachsenen Wänden zu versickern. Keine Fackeln. Hallo Dunkelheit, alte Freundin, dachte er, nicht zum ersten Mal. Während er in die gähnende Öffnung des Abflussrohres blickte und abzuschätzen versuchte, in welche Richtung es ihn führen würde, waren alle übrigen Sinne unablässig damit beschäftigt, die mit Kopfstein gepflasterte Gasse, in der er sich befand, auf … Veränderungen zu überprüfen.
Auf Feindbewegungen.
Die Geräusche, die er wahrnahm, schienen in Ordnung zu sein: Verblichene Wäsche, die im leichten Seewind auf schäbigen Leinen flatterte. Das leise, rhythmische Klappern eines hölzernen Fensterladens. Ein Windspiel, weit entfernt. Über allem lagen das gleichgültige Rauschen des Meeres und das Gluckern von Wasser in Kupferrohren, das wie ein dumpfes, wässriges Kichern klang. Kein Surren von kleinen, lederartigen Flügeln. Kein Geräusch von staubigen Stiefelabsätzen auf dem unregelmäßigen Pflaster der Gasse.
Irgendwo über ihm krächzte eine Möwe, und Morgan fuhr zusammen. Eine Möwe, du elender Feigling. Nur eine Möwe. Keines von diesen kleinen Biestern, die… Morgan schauderte unwillkürlich und musste die Finger seiner linken Hand mit all seiner Kraft daran hindern, wieder das seltsam schmerzlose Loch zu betasten, das eines dieser geflügelten Dinger in seinem rechten Oberarm hinterlassen hatte. Er durfte jetzt keine Zeit vergeuden, sich damit zu befassen. Er stand vor einer Entscheidung, die eigentlich keine war, aber indem sein Verstand es „Entscheidung“ nannte, konnte er vielleicht noch einige kostbare Augenblicke im Tageslicht herausschlagen, bevor er sich in die finsteren Eingeweide der städtischen Kanalisation begeben musste. Es war ein Wunder, dass er es überhaupt soweit geschafft hatte. Ein Wunder Innos’.
Morgan lag auf dem Wagen, mit dem man ihn durch die Stadt transportiert hatte. Er war zum Stehen gekommen. Jemand zog die bewusstlose Frau mit dem roten Haar vom Wagen hinunter, und Morgan hörte, wie ihr Körper auf trockenem Gras aufschlug. Dann spürte er Hände an seinem eigenen Körper, weich wie Fisch, der in der Sonne gelegen hatte, aber mit stählerner Härte darunter und er nahm mit wachsendem Grauen wahr, wie er langsam über den Holzboden des Karrens gezogen wurde.
Ein Flüstern, nass und rau:
„Morgan?“
In diesem Augenblick verließ ihn seine mit aller Kraft aufrecht erhaltene Beherrschung. Sie bröckelte nicht langsam wie eine alte Steinmauer auseinander oder gab der Panik widerwillig, wie morsches Holz ächzend nach. Sie zerbarst einfach in winzige Splitter.
Morgan riss die Augen auf. Ein missgestalteter Kopf schwebte über ihm wie ein entsetzlicher Vollmond. Der Schädel schien von einer unvorstellbaren Kraft nach hinten gedrückt worden zu sein, so dass die Gesichtszüge völlig aus den Fugen geraten waren. Das Ding mit dem eingedrückten Schädel sah ihn an, und es war unmöglich zu sagen, welcher Ausdruck auf seinem deformierten Antlitz lag. An seiner Stirn klebte grüner Tang. Morgan stöhnte. Zum Schreien fehlte ihm die Luft. Graue Wellen der Panik rollten über ihn hinweg, und einen Moment lang hatte er das Gefühl zu schweben, wie in einem schlimmen Albtraum. Aber es war kein Traum. Die weiße Hand an seinem Oberarm war klein wie die eines Jungen, aber unerbittlich. Die eingesunkenen Augen in dem Gesicht über ihm waren goldene Kerzenlichter.
Morgan rieb sich die Schläfen. Ein verdammtes Wunder Innos’. Sein Verstand war gelähmt gewesen vor Entsetzen… nein, nicht Entsetzen. Nicht nur Entsetzen. Entsetzen gehörte zweifelsohne zu dem düsteren Strauß von Empfindungen, die ihn überschwemmt hatten, aber das Gefühl, an das er sich nun am deutlichsten erinnerte, war Erkennen .
Er konnte nicht sagen, wie es ihm gelungen war, trotz seiner Verletzung mit einem Ruck die Füße hochzureißen und mit aller Kraft gegen die Brust des Dings über ihm zu treten. Es musste ein Wunder Innos’ gewesen sein. Er dachte daran, wie das Wesen einen Schritt nach hinten taumelte, und diesmal hatte Morgan den Ausdruck zuordnen können, der das entstellte Gesicht verzerrte: Überraschung und Wut. Irgendwie war es ihm gelungen, vom Wagen zu kriechen und sich aufzurappeln. Noch bevor er richtig auf den Beinen gewesen war, hatte er versucht zu rennen und gleichzeitig zurückzuschauen. Das Ding mit dem eingedrückten Schädel hatte sein Gleichgewicht wiedergefunden. Ein weiterer Mann, offensichtlich tot und im fortgeschritten Zustand der Verwesung, hatte sich auf halbem Weg zu dem Gebäude befunden, das inmitten des kleinen Parks lag. Er hatte den linken Knöchel der bewusstlosen Frau mit einer Hand umschlossen und sie gleichgültig hinter sich hergezerrt. Die roten Locken der Frau hatten trotz des Staubes auf dem sonnenbeschienenen Kiesweg geschimmert. Morgan hatte erkannt, dass dieses zweite tote Wesen keine unmittelbare Gefahr für ihn darstellte, jedenfalls nicht in diesem Augenblick. Es war bereits zu weit entfernt. Das andere Ding, dem er vor die Brust getreten hatte, hatte ihn angestarrt, und auf seinem Gesicht hatte eine Fassungslosigkeit gelegen, die Morgan überrascht hätte, wenn in diesem Moment Raum für einen anderen Gedanken als Flucht gewesen wäre.
Er drehte sich um und rannte. Seine Stiefel polterten auf dem unregelmäßigen Pflaster der Straße. In der erstickenden Hitze des Tages schien er entsetzlich langsam voranzukommen, viel zu langsam. Er wusste nicht, ob ihn das Wesen bereits verfolgte oder nicht, aber es war klüger, nicht daran zu zweifeln, dass es ihm bald auf den Fersen sein würde. Einen winzigen Augenblick lang dachte Morgan an die Frau, die das zweite Geschöpf achtlos hinter sich hergezerrt hatte, als zöge er einen Sack Lumpen.
Schwimm selbst oder geh unter, dachte er und versuchte, den Anblick der roten Locken, die im Staub des Kiesweges schleiften, zurückzudrängen.
Es konnte keine Zeit mit Gedanken darüber vergeuden, ob er ihr hätte helfen können,
müssen
er hatte wahrhaftig andere Sorgen. Er rannte und rannte, doch er war zu langsam. Er konnte hören, dass ihm jemand folgte. Wenn er sich jetzt umdrehte, würde er sehen können, wie das tote Ding mit dem eingedrückten Schädel eine bläulichweiße Hand nach ihm ausstreckte, an der drei Finger fehlten und auf der sich eine Kolonie Seepocken angesiedelt hatte. Er hörte Schritte hinter sich, Schritte, die klangen, als würde jemand in Stiefeln voller Wasser rennen, er hörte den entsetzlich blubbernden Atem. Er würde sich nicht umdrehen, bei Innos, er würde rennen, rennen, und er würde…
Es war der Geruch, der ihn dann doch zwang, sich umzudrehen. Er kam plötzlich und überwältigend über ihn, hüllte ihn ein und nahm ihm den Atem. Ein Haufen Fische, den man in der Sommerhitze hatte liegen lassen.
Er drehte sich um. Die Straße hinter ihm war leer.
Morgan leckte sich die Lippen und konzentrierte sich auf den Tunnel. Das Tageslicht erhellte das mannshohe Abflussrohr, aus dem ein dünnes Rinnsal Wasser tröpfelte, etwa sechs oder sieben Schritt weit. Dieser Teil der Kanalisation war schon vor Jahren stillgelegt worden, doch aus dem Rohr stieg immer noch ein kühler, unangenehmer Geruch auf, der Morgan an überreife Früchte erinnerte.
Es gab keinen anderen Weg. Er hatte die Verfolger abgeschüttelt, doch wie lange würden sie brauchen - sie und diese surrenden Biester mit dem einzelnen runden Auge in ihrem kleinen Kopf und dem stumpfen Hornschnabel -, um ihn wieder aufzuspüren? Khorinis war jetzt ihr Revier. Morgan ertappte sich dabei, dass er doch wieder das perfekte Dreieck der Wunde betastete, das der Schnabel des fliegenden Dings hinterlassen hatte. Sie war tief, sehr tief sogar, aber nur so groß wie eine Goldmünze. Sie blutete nicht mehr und die Ränder begannen bereits zu verschorfen. Eine so tiefe Wunde hätte in jedem Fall Schmerzen verursachen müssen, doch sein Arm fühlte sich merkwürdig taub und unbeteiligt an, so als weigerte er sich immer noch, die Verletzung zur Kenntnis zu nehmen. Morgan dachte daran, wie die Biester im Halbdunkel der Hafenkneipe an den Wänden und an der Unterseite der Tische gehangen hatten. Sie hatten sich leicht bewegt, als ob sie in einer sanften Brise schaukeln würden. Über den Tresen war der Leichnam eines Mannes ausgebreitet, und auch der war bedeckt gewesen mit denselben weißlichgelben Dingern. Morgan hatte die Stirn gerunzelt und einen Augenblick überlegt, ob er sich das genauer ansehen sollte - was für ein entsetzlich dummer Fehler! -, als eines der Geschöpfe plötzlich ein Paar lederartiger Flügel entfaltete. Morgan war so überrascht - eine weitere entsetzliche Dummheit! -, dass er nicht schnell genug reagierte.
Ich habe überhaupt nicht reagiert, dachte Morgan, ich habe einfach dabei zugesehen, wie sich das Ding auf meinem Arm niedergelassen und seinen Schnabel…seinen Rüssel hineingebohrt hat.
Es hatte nicht wehgetan, und Morgan hatte - sein dritter Fehler in den wenigen Sekunden, die das geschehen andauerte - entsetzt auf den weißlichen Leib des Geschöpfes gestarrt, der sich erst rosa, dann rot verfärbt und auf die Größe eines Goblinschädels aufgequollen war. Dann hatte er nach dem Ding geschlagen, zweimal, dreimal. Beim dritten Schlag war es geplatzt, und Blut - Morgans Blut - war über seinen Unterarm gespritzt. Der durchscheinende Kopf des Wesens aber hatte noch in seinem Oberarm gesteckt, denn der flache, stumpfe und hornartige Rüssel hatte sich tief in sein Fleisch gebohrt. Morgan hatte das zerplatzte Geschöpf, das sich immer noch schwach unter seinen Fingern wand, aus seinem Arm herausgezogen. Aus dem Loch, das es dort gebohrt hatte, war eine Mischung von Blut und einer gelblichweißen Flüssigkeit gesickert. Er hatte das kleine, dreieckige Loch verblüfft angestarrt, und wäre er kein Krieger gewesen, dann hätte er gar nicht wahrgenommen, dass sich ein ganzer Schwarm der kleinen Biester mit leisem Surren in die Luft erhoben hatte.
Hätte er sich eine vierte Dummheit erlaubt - etwa die Traube von weißlichgelben Körpern, durchscheinenden, augenlosen Köpfen und lederartigen Flügeln gebannt anzustarren, die für den Moment noch träge in der Luft hing -, hätte er sein Ende in einer heruntergekommenen Hafenkneipe in Gesellschaft eines toten Mannes in schmutzigweißer Schürze gefunden. Der Schwarm wäre über ihn hergefallen und auf seinen Händen, seinen Armen, seinem Hals gelandet. Morgan stellte sich vor, wie eines der Dinger sich auf seine Stirn setzte, nahe der rechten Schläfe und wie er die Hand hob, um es zu erschlagen. Das Bild, das er vor seinem inneren Auge sah, war kristallklar wie eine frische Erinnerung. Er sah sich selbst, wie er die Hand hob, und an dieser hand hingen vier oder fünf der Geschöpfe, die Leiber bereits rosa verfärbt und zu doppelter Größe angeschwollen. Er hörte das Surren der Flügel und spürte das schreckliche, schmerzlose Saugen, er sah sich schreiend am Boden und wie eines der Biester in seinen geöffneten Mund flog und sich an seiner Zunge festsaugte, während sein ganzer Körper mit aufgequollenen geflügelten Wesen bedeckt war, die über ihr Fassungsvermögen hinaus tranken, platzten und sein Blut über die Dielen der Taverne verspritzten, er spürte, wie das Ding in seinem Mund anschwoll und seine Kiefer auseinanderstemmte, bis auch dieses Geschöpf platzte und…
Morgan schüttelte sich. Ihm blieb keine Zeit, sich damit zu befassen, was seine Dummheit alles hätte anrichten können. Er war entkommen und lebte; das war das einzige, was zählte. Der gasige Geruch verfaulender Früchte, der aus dem Abflussrohr wehte, schien auf einmal stärker zu werden, das Licht heller, die Farben klarer und intensiver. Gefahr war im Anzug. Morgan konnte noch keine schlurfenden Schritte auf dem Kopfsteinpflaster oder das nasse Gluckern toter Stimmen hören, aber er spürte ganz deutlich, dass sie in der Nähe waren.
Sie kreisen mich ein, dachte er und fühlte, wie kleine Luftbläschen der Panik an die Oberfläche seines Verstandes aufstiegen und dort zerplatzten. Noch einmal würden sie ihn nicht entwischen lassen. Sie wissen, wer ich bin und was ich getan habe , dachte er zusammenhangslos und trat in das Abflussrohr. Hallo Dunkelheit, alte Freundin.
Drinnen war es noch finsterer, als er gedacht hatte. Zuerst ließ die Öffnung hinter ihm noch spärliches, weißes Licht hinein, und er konnte in die Wand eingelassene Gitter und einen Stapel alter, morscher Kisten sehen. Auf der rechten Seite sah er eine Art in die Wand eingelassenes Geländer, das sich im Dunkel verlor, links standen in regelmäßigen Abständen gemauerte Stützpfeiler. Als er die erste sanft nach rechts geneigte Kurve hinter sich gelassen hatte, wurde das Licht trüber, bis er nur noch vereinzelte Reflexe in den kleinen Wasserpfützen am Boden des Tunnels aufblinken sah. Danach hörte das Licht einfach auf zu existieren.
Morgan stand in völliger Schwärze und lauschte. Alles ruhig. Dann holte er einen kleinen Lederbeutel aus seiner Tasche. Sechs Streichhölzer waren darin. Morgan entzündete eines von ihnen. Das Licht, das es erzeugte, war jämmerlich klein und machte sein Unbehagen eher schlimmer. Stapel von Kisten und Fässern, ein Handkarren mit gebrochenem Rad, in den Boden eingelassene Gitter. Der Tunnel verlief nun nach Süden. Das Streichholz erlosch. Morgan ging weiter. Hier drinnen gab es ein Echo, und das gefiel ihm noch weniger als die Dunkelheit. Es hörte sich an, als wäre jemand hinter ihm…als würde er verfolgt. Er blieb einige Male mit schiefgelegtem Kopf und blinden Augen stehen und wartete, bis das Echo verstummt war. Nur zur Sicherheit. Er strich sich mit der Hand übers Gesicht und kämpfte die aufsteigende Panik nieder. Hier unten war es mit Sicherheit ungefährlicher als auf den sonnenbeschienenen Straßen mit ihren verwelkenden Blumengebinden. Er musste einfach nur ruhig bleiben und dem Drang widerstehen, einfach blind loszustürmen.
Morgan hatte sich bereits um eine weitere Kurve des Tunnels getastet, als er mit dem Fuß gegen etwas Steifes und Unnachgiebiges stieß. Er taumelte zwei Schritte rückwärts und zwang sich, ruhig zu bleiben. Er entzündete ein weiteres Streichholz, dessen Flamme in seinem zitternden Griff wie irrsinnig tanzte. Er war auf die Hand einer Frau getreten. Sie saß an die Tunnelwand gelehnt und streckte die Beine über das feuchte Kopfsteinpflaster aus. Ihr Kopf fehlte. Das Streichholz erlosch und hüllte Morgan und die Frau in tiefe Finsternis. Morgan leckte sich die Lippen und zwang sich weiterzugehen. Es muss schrecklich gewesen sein, hier zu sterben,
dachte er. Mit einem weit ausholenden Schritt stieg er über den Leichnam hinweg, und plötzlich überkam ihn eine alptraumhafte Gewissheit. Auf der undurchdringlichen Bühne der Dunkelheit inszenierte sein Verstand ein bedrückendes Kammerspiel. Er, Morgan, irrte durch die Dunkelheit, während grimmig blickende Milizionäre mit verfaulenden Gliedmaßen einen Kreis um ihn bildeten, der sich enger und enger zog; zwei der Geschöpfe krochen mit Messer zwischen den Zähnen auf ihn zu; eines spannte eine Drahtschlinge zwischen den toten Händen.
Morgan bohrte sich die Fingernägel in den Handrücken. Er durfte keine Zeit mit solchen Gedanken vergeuden. Er musste einen klaren, kühlen Kopf bewahren. Dann hatte er eine Chance, Khorinis…
Hinter ihm bewegte sich etwas in der Dunkelheit.
Geändert von El Toro (02.08.2013 um 09:47 Uhr)
-
XV. Jenna. Kommst du spielen, Jenna?
Der schwarze Umriss der Tür im Wartesaal sah in der zunehmenden Dunkelheit aus wie ein totes, stumpfes Auge. Das Auge starrte Jenna an. Jenna starrte zurück. Sie blickten einander lange an. Wenn man das Holz der Tür genau beobachtete, konnte man sehen, wie die Maserung des Holzes in Bewegung geriet und einwärts drehende Spiralen und Wirbel bildete. Jenna konnte ihren Blick kaum von der merkwürdigen Schönheit dieser harmonischen Bewegung lösen. Das dunkle Auge an der gegenüberliegenden Wand war erloschen, aber nicht endgültig. Vielleicht schlief es nur. Jenna vermutete jedoch, dass es abwartete. Die Zeit war auf seiner Seite, und es brauchte nichts zu tun als zu warten und Jenna träge wirbelnde Formen zu zeigen. Ein leichtes Spiel. Aber ein Spiel, das Jenna mit Zufriedenheit erfüllte. Sie hatte immer geahnt, dass es eines Tages passieren würde. Nicht, dass sie sich dessen bewusst gewesen wäre, aber nun kam es ihr vor, als habe sie all die Jahre nur auf diesen Moment hin gelebt. Alles, was sie je getan hatte, hatte sie in der Erwartung dessen getan, was passieren würde. Wie auch immer die Lichtung am Ende des Waldweges aussehen mochte, sie war beinahe erreicht. Warum sollte sie dagegen ankämpfen? Die Tür zeigte ihr Spiralen und wirbelnde Muster, und es lag auf der Hand, dass diese Formen dafür sorgen würden, dass es nicht allzu wehtat. Vielleicht würde es gar nicht wehtun, wenn sie sich nur genug konzentrierte.
Raus…
„Halt den Mund, Cassia“, sagte Jenna müde. Sie wollte den Windungen der Maserung zusehen, die sich in perfektem Einklang bewegten.
Du musst hier raus…
„Ich will nicht.“ Jennas Stimme klang fremd in ihren eigenen Ohren, träge und quengelnd. Warum konnte Cassia sie nicht einfach in Ruhe lassen?
Cassia schwieg, und Jenna starrte angestrengt auf das Holz der Tür. Die Bewegungen waren ins Stocken geraten, nicht sehr, aber so, dass es den harmonischen Gleichklang störte. Jenna spürte Verärgerung und …Angst. Es war merklich kühler geworden in dem Raum. Sie fror in ihrem dünnen weißen Leinenhemd. Das Spiel der Maserung zerfaserte, geriet an allen Enden aus dem Takt und erschien ihr auf einmal linkisch und ungeordnet. In die Stille hinein sagte Cassia:
Du willst ihn also sehen?
Jenna schwieg. Sie wollte nicht, aber Khorinis hatte nie danach gefragt, was sie wollte. Cassia fuhr mit einer koboldhaften Bösartigkeit fort:
Du solltest dir im Klaren darüber sein, dass er sein Sonnenfinsternisgesicht tragen wird.
Eine Hand aus Eis legte sich um Jennas Magen und drückte zu. Jenna hatte plötzlich den mineralischen Geschmack von Wasser im Mund, salzig und leicht metallisch. Die Maserung
des Auges
der Tür war in Aufruhr geraten und wirbelte durcheinander. Im Dämmerlicht schien sich das Holz nach außen zu wölben. Jenna sah fassungslos zu, wie sich winzige Splitter aus dem Holz lösten und zu Boden fielen. Sie konnte sogar hören, wie sie auf die steinernen Fliesen regneten.
Begreifst du es endlich? Du musst hier raus!
Entsetzen überflutete sie wie Eiswasser und nahm ihr für einige Augenblicke die Luft. Ihr schien es, als würde sie sich selbst von oben betrachten, eine Frau in einem weißen Nachthemd und mit langen, roten Locken, die reglos in einem dunkel werdenden Raum stand und eine Tür anstarrte, vielleicht schon seit Stunden. Die blasse Frau erinnerte Jenna mit ihren dunklen, angstgeweiteten Augen an ein Kaninchen, das, überwältigt vom Schrecken eines plötzlich auflodernden Lichts, erstarrt war und in todbringender Lähmung verharrte.
Endlich wurde der Wunsch, hier wegzukommen, so übermächtig, dass sie beinahe blind durch den Raum taumelte und fast gestürzt wäre. Sie versuchte verzweifelt, die Lage zu erfassen, aber ihr Verstand konnte die Wortfetzen, die ihre Augen und ihr Gedächtnis wild durcheinander riefen, nicht miteinander in Einklang bringen. Jenna spürte, wie sie wieder zu einem Kaninchen zu werden drohte, das starr vor Schreck in ein hell aufleuchtendes Licht sah.
Du kannst nicht durch die Tür zurück, durch die du gekommen bist.
Cassia hatte Recht. Dort hielten die Milizionäre Wache … oder das, was von ihnen übrig war. Jennas Blick huschte zum Fenster. Es war vergittert, und sie kannte sich gut genug mit Gittern und Schlössern aus, um zu erkennen, dass dieses Gitter nicht nachgeben würde.
Die Tür am anderen Ende des Raumes…
„Nein!“ Es war völlig unmöglich, durch diese Tür zu gehen, ausgeschlossen, man durfte nicht einmal daran denken. Man konnte sich diesem schwarzen, leeren Auge nicht einmal nähern ohne den Verstand zu verlieren.
Es ist nichts als eine Tür, Jenna.
Cassias Stimme klang ruhig, aber Jenna kannte ihre Schwester gut genug, um die fast perfekt beherrschte Panik darin wahrzunehmen.
Jenna sah zu dem bedrohlichen Umriss an der gegenüberliegenden Wand hinüber. Glattes, dunkles Holz. Keine Wirbel, keine Spiralen. Eine Tür, nichts als eine Tür.
Es spielt keine Rolle, was durch diese Tür zu dir hineinkommen will.
Jenna zögerte. Sie wusste, dass das stimmte. Es lauerte nicht hinter der Tür, es lauerte an einem ganz anderen Ort. Aber es würde diese Tür benutzen, um zu ihr zu kommen. Jenna hatte entsetzliche Angst, sie könnte in dem Moment hindurchgehen, in dem es zu dem Schluss gekommen war, dass es lange genug gewartet hatte.
Jenna, beeil dich. Wir haben nicht mehr viel Zeit.
Die Angst, die Cassias Stimme spröde werden ließ, riss Jenna aus ihrem Zögern. Sie hörte das leise Geräusch ihrer eigenen nackten Füße auf dem Steinboden noch bevor sie sich überhaupt bewusste wurde, dass sie sich in Bewegung gesetzt hatte. Hinter der Tür befand sich ein kleiner Raum, der nur mit einem Schreibtisch möbliert war. Er war leer bis auf einen ordentlich zusammengelegten Stapel Kleider. Jennas Kleider, die sie getragen hatte, als die Miliz sie in diesen Turm gesperrt und dann einfach vergessen hatte. Zum ersten Mal kam ihr der Gedanke, dass das vielleicht ihr Glück gewesen war. Was immer den Milizionären zugestoßen war - ganz zu schweigen von dem Ding aus Mondlicht, dem Ding mit den Goldzähnen, das sie in ihrer Zelle besucht hatte -, es hatte weit schlimmere Auswirkungen gehabt als zwei oder drei Tage im Kerker.
Jenna berührte das zerrissene Kleid und der kalte Finger des Grauens strich ihr über den Ansatz der Wirbelsäule, trommelte eine schnelle, hektische Melodie und riet ihr, von hier zu verschwinden, und zwar schnell, bevor jemand…etwas dazwischen kam. Das Zimmer kam ihr plötzlich sehr klein vor und schien sich immer enger zusammenzuziehen, bis es auf die Größe einer Gefängniszelle geschrumpft war. Im nächsten Moment auf die eines Sarges.
Am anderen Ende des kleinen Arbeitszimmers befand sich eine weitere Tür, dahinter lag ein vom gedämpften Licht zweier Öllampen erhellter Gang, der auf eine Treppe zulief. Auf halbem Weg zur Treppe stand ein leerer Servierwagen. Als Jenna den Wagen erreicht hatte, drehte sie sich um und sah zurück, weil die Stille sie misstrauisch machte. Sie rechnete damit, in die toten schwarzen Augen einer der Stadtwachen zu sehen, die hinter ihr herschlich, um ihren letzten Befehl auszuführen, doch der Gang und das Zimmer mit dem Schreibtisch waren leer und verlassen. Das Echo ihrer Schritte im halbdunklen Korridor weckte Gedanken an makabere Gesellschaft. Kommst du spielen, Jenna?
Sie kam an einem Bild vorüber, das einen Zinnteller mit gelbem und rotem Obst zeigte. Obwohl der Gang in mildes Dämmerlicht getaucht war, erschienen ihr die Farben des Bildes fiebrig, als seien die Früchte im gelborangen Licht einer erstickend heißen Wüstensonne gemalt worden. Das Stillleben hing ein wenig schief. Jenna verspürte den übermächtigen Drang, es gerade zu rücken. Das Bild so nach rechts geneigt zu sehen weckte in ihr leichte Übelkeit. Auf der schützenden Verglasung des Gemäldes lag Staub. Sie fuhr mit den Fingern über das Glas und hinterließ zwei schmale, parallel verlaufende Spuren. Der Staub fühlte sich glatt und ölig an, wie alte Seide kurz vor dem Verrotten.
Würde ich das Bild von der Wand nehmen, könnte ich auf der Wand dahinter einen hellen Fleck sehen. Oder Würmer, die sich darunter hervorwinden, als hätte ich einen Felsbrocken weggewälzt.
Jenna starrte die fiebrigen Früchte auf ihrem Zinnteller noch einen Augenblick lang an, dann lief sie so schnell sie konnte auf die Treppe zu, begleitet von der lebhaften Vorstellung, wie blindes, weißes Gewürm aus der Tapete hervorquoll und sich auf den Steinboden ergoss.
Über die Treppe gelangte Jenna in einen weiteren Korridor. Türen mit Ornamentglasscheiben säumten den Weg und erzählten ihre eigene Geschichte. AKTEN UND ABSCHRIFTEN. REGISTRATUR. BIBLIOTHEK. Schon von weitem konnte Jenna etwas am Boden sehen. Es lag, halb an die Wand gelehnt, da wie ein Tier, das an eine steile Küste gespült worden war. Der Leichnam des Mannes in der vornehmen Kleidung eines Bürgers starrte Jenna aus glasigen Augen an. Er schien zu grinsen, weil die Lippen bereits von den Zähnen gefault waren. In seinem Hals steckte ein Messer.
Linker Hand teilte sich ein weiterer Gang vom Hauptkorridor ab. Jenna verlor langsam die Übersicht. Das Gebäude, in das man sie gebracht hatte, war viel größer, als sie sich vorgestellt hatte. Sie bekam es mit der Angst zu tun. Es war nicht das betäubende Entsetzen, das sie angesichts der grässlichen Kreaturen in den Uniformen der Miliz erfasst hatte, sondern eine wilde, lebendige Angst, sich in den weitläufigen Gängen zu verirren, wo ihre Schritte hallten und ein dumpfes Echo erzeugten. Sie würde durch die dunklen Korridore irren und hin und wieder über einen Leichnam stolpern. Vielleicht hatte sie sich bereits verirrt. Und Cassia schien auch verschwunden zu sein. Das war schlimm. Das war so schlimm.
„Ich habe mich nicht verirrt“, sagte sie, und ihre Worte hallten fremd und tonlos wider. Sie wünschte sich, sie nicht laut ausgesprochen zu haben, denn das machte alles noch schlimmer. Jenna ging weiter geradeaus, ließ den Gang zur Linken hinter sich und ging an weiteren Verwaltungsräumen vorbei. Immer öfter sah sie sich um und vergewisserte sich, dass ihr niemand folgte. Schließlich bog der Korridor nach rechts ab und endete an einer Tür mit der Aufschrift SCHRIFTGUTKATALOGE. Am Türknauf war ein handgeschriebenes Schild angebracht: BIS AUF WEITERES GESCHLOSSEN. GEZ. LOTHAR.
Jenna ging zurück und spähte um die Ecke in die Richtung, aus der sie gekommen war. Aus der Entfernung sah der Leichnam des Mannes winzig aus, ein hell schimmernder Fleck im Halbdunkel. Wieder ging sie an dem Toten vorbei und ihr wurde bewusst, dass er hier unveränderlich und bis in alle Ewigkeit liegen bleiben würde. Wer sollte kommen und ihn begraben?
Jenna betrat den Gang, der vom Hauptkorridor abzweigte. Das Echo ihrer Schritte verfolgte sie, und in ihr wurde die entsetzliche Gewissheit übermächtig, dass es überhaupt keinen Ausgang gab, jedenfalls nicht auf dieser Ebene des Gebäudes. Sie begann wieder zu laufen, das dünne weiße Hemd flatterte um ihre Beine und sie spürte, dass ihr Haar im Nacken schweißnass war. Keuchend bog sie um eine Ecke und sah, dass auch dieser Gang eine Sackgasse war. Er endete an einer Tür, die einen Spalt weit offen stand. ENTSORGUNG / ORTSKANALISATION war in das Ornamentglas geprägt.
Die Kanalisation.
Jenna stockte der Atem. Die alte Stadtkanalisation war vor einigen Jahren stillgelegt worden. Doch sie erinnerte sich, wie sie sich als Kinder durch die niedrigen Lorbeerbüsche gezwängt hatten, die in der Bucht nördlich des Hafens wuchsen, und einen der gewaltigen Zementzylinder bestaunt hatten, die in die Kanalisation hinabführten. Der Zugang war mit einer runden Metallscheibe verschlossen gewesen, die mit zahlreichen Belüftungslöchern versehen war. Aus der Tiefe war ein eintöniges, stetes Summen zu hören gewesen. Jenna hatte ein Auge an eines der Luftlöcher gepresst, aber in der Dunkelheit nichts erkennen können. Nur das Summen war lauter an ihr Ohr gedrungen, außerdem das Tröpfeln von Wasser. Obwohl sie gewusst hatte, dass dieser Zugang ein Teil der städtischen Kanalisation war, hatte sie sich gefürchtet. Die Form des Zylinders und sein durchlöcherter Eisendeckel hatten sie an eine Geschichte erinnert, die sie einmal gelesen hatte. Sie war sich plötzlich sicher gewesen, dass dies nicht nur der Zugang zum Abwassernetz war, sondern einer der Brunnen, die in das Land der schrecklichen Fabelwesen führten, die in unterirdischen Höhlen hausten und in mondlosen Nächten an die Oberfläche kamen, um ihren Hunger zu stillen.
Das leise, ferne Rauschen von Wasser war zu hören, als Jenna den Raum betrat. Sie ging vier steinerne Stufen zu einer eisenbeschlagenen Tür hinab, die verriegelt war. WARTUNG. Rechts vom Treppenabsatz führten weitere Stufen in die dichte Dunkelheit hinab. Jenna stand am Fuß der Treppe und starrte nach unten. Sie war sich sicher, dass im nächsten Augenblick eine Hand aus der Finsternis hervorschnellen und ihren nackten Knöchel umschließen würde. Sie würde erstarren, ihr Magen eine treibende Eisscholle im Meer des Entsetzens, und in ein verfaulendes, grinsendes Gesicht sehen, das aus der Tiefe hervorblickte. Es würde mit sterbender, gebrochener Stimme unverständliche, wässrige Laute ausstoßen und aus seinen Mundwinkeln würde Blut tropfen und über das Kinn laufen und…
Schritte kamen den Korridor entlang, schleppend, aber zielstrebig. Schweiß brach ihr am ganzen Körper aus. Wieder schaute sie ins Dunkel hinab und nahm den leisen Geruch wahr, der aus der Tiefe aufstieg, ein Geruch von verrottenden Früchten, nass, süß und auf widerliche Weise warm.
Die Schritte auf dem Gang kamen näher, und Jenna hörte das gedämpfte Murmeln von Stimmen, die von Meerwasser zu triefen schienen.
Sie setzte einen Fuß auf die oberste Stufe, die sich unter ihrer nackten Sohle kalt und glitschig anfühlte, und stieg in die Dunkelheit der Kanalisation hinab.
-
XV. Im Hafen von Khorinis
Die Barthaare der großen, schlanken Ratte erzitterten leicht, als sie den Kopf hob und die verführerische Witterung aufnahm. Sie schob sich aus ihrem Versteck zwischen den vorspringenden Steinen von Haldors Haus und folgte dem Duft. Wind war aufgekommen, und feine Sandkörner wehten über den gepflasterten Kai und bildeten einen durchsichtigen Schleier, durch den der Hafen wie ein Geisterbild erschien. Das Türschild der Roten Laterne war heruntergefallen und lag auf den Pflastersteinen. Eine feine Schicht von hellem Sand hatte sich darauf gelegt. Die Ratte lief flink über das Schild hinüber und hinterließ winzige Fußspuren auf der sandigen Oberfläche.
Irgendwo im Hafenviertel brachte der Wind ein Glockenspiel zum Erklingen, dessen sanfter Klang den Zikadengesang begleitete. Ein Wagen stand verlassen mitten auf der Straße. Verwelkte, in der Hitze faulende Blumen waren an der Deichsel befestigt worden. Auf dem Wagen selbst standen mehrere leere Kisten, die einmal Gemüse oder Früchte enthalten haben mochten. In einer dieser Holzkisten hatte sich eine Eichhörnchenfamilie häuslich eingerichtet. Die Ratte glitt geschmeidig zwischen den hölzernen Speichen des Hinterrades hindurch.
Von der Oberstadt war ein leises Poltern zu vernehmen. Die Ratte hielt einen Moment inne, setzte sich, den glatten, rosa Schwanz um den Leib geringelt, auf ihre Hinterbeine und lauschte. Als sie zu dem Schluss gekommen war, dass keine Gefahr für sie drohte, setzte sie ihren Weg fort.
Vor Kardiffs Taverne lagen zwei Hunde tot in der Gosse, in der Taverne selbst hing ein Mann, möglicherweise Kardiff selbst, mit schlaff herabhängenden Armen über der Theke. Einer der Hunde, die jetzt tot im Rinnstein lagen, hatte sich dem Gesicht des Mannes gewidmet, bevor er den Appetit verloren oder ihn jemand bei seinem Mahl gestört hatte. Den Hunden schenkte die Ratte keinerlei Beachtung, sie interessierte sich für das, was von Kardiff übrig war.
Wie ein grauer Schatten glitt sie in das Dunkel der Taverne, verharrte einen Augenblick und schätzte die Lage ab. Nichts außer dem süßen Geruch toten Fleisches lag in der Luft. Kardiffs Hosenbein war ein Stück nach oben gerutscht und entblößte einen Knöchel, der im spärlichen Licht, das durch das Tavernenfenster drang, hell schimmerte. Die Ratte gab der duftenden Verlockung nach und begann, sich an Kardiffs Bein gütlich zu tun. Sie war so vertieft in ihre üppige Mahlzeit, dass sie die unendlich langsame Bewegung in der Dunkelheit nicht wahrnahm. Eine Hand - oder vielmehr die Reste einer Hand - hoben langsam, unerträglich langsam ein Tischbein, das aus einem der Tavernentische herausgerissen worden war. Tote, glanzlose Augen, die wie staubige Murmeln in tiefen Höhlen lagen, schätzten die Entfernung zwischen Ratte und Tischbein ab. Die Ratte riss gerade einen langen Streifen fahler, lockerer Haut von Kardiffs Knöchel, als das Tischbein ihr mit voller Wucht das Rückgrat brach. Sie fiel betäubt auf die Seite und atmete nur noch schwach. In ihren Barthaaren hingen feine Blutströpfchen und ihre Hinterbeine bewegten sich, so als würde ihr Rattenverstand ihnen den verspäteten Rat geben wegzulaufen.
Das Wesen mit dem Tischbein stieß ein wässriges Gluckern aus und schlug noch einmal zu.
Von draußen drang der Klang eines Windspiels herein.
Geändert von El Toro (02.08.2013 um 09:56 Uhr)
-
XVII. Jenna. Von Angesicht zu Angesicht.
Hier unten herrschte völlige Dunkelheit. Jenna tastete sich an den feuchten Wänden der Kanalisation entlang. Der Boden unter ihren nackten Füßen war kalt und mit Moos bewachsen. Sie fror in ihrem dünnen Nachthemd. In der Finsternis und Stille unter der Stadt waren ihre Sinneswahrnehmungen auf Geruch und Tastsinn beschränkt, und keiner der beiden vermittelte ihr tröstliche Botschaften. Sie roch feuchten Schimmel und Verfall, und je länger sie hier unten herumirrte, desto häufiger stahl sich Panik mit ausgebreitetem Mantel über sie und hüllte sie so unvermittelt ein, dass sie kaum noch atmen konnte. Sie musste seit Stunden blind durch die Tunnel irren. Die Zeit dehnte sich ins Unendliche. Vielleicht lief Jenna ja im Kreis herum, vielleicht befand sie sich bereits wieder direkt unter dem Palast, aus dem sie geflüchtet war. Je mehr Zeit verging, desto mehr wuchs in ihr die Überzeugung, dass sie nicht allein hier unten war.
Der Dämon, der am Feuer kauerte…
Im schwarzen Herzen der Dunkelheit spürte sie ganz deutlich, dass er da war…dass er sie beobachtete. Und wartete. Im richtigen Moment würde er sie berühren, und dann…
Hier gibt es keine Dämonen. Geh einfach weiter.
Jenna nickte. Sie musste Cassia nicht antworten, Cassia wusste auch so Bescheid. Sie wusste, dass Jenna möglicherweise doch Recht hatte.
Er kann mich sehen.
Sie war sicher, dass er das konnte, denn er hatte ein goldenes Auge, das im Dunkeln sehen konnte. Er kam schließlich aus der Dunkelheit. Der Dämon konnte damit Farbtöne des Spektrums sehen, die dem menschlichen Auge verborgen waren. Einen Moment lang schien es Jenna, als könne sie sich selbst durch die Augen der Kreatur sehen, die damals am Feuer gesessen und ihr mit einer unförmigen Klaue zugewinkt hatte.
Es war ein Handschuh. Der Dämon hatte seine Klaue in einem Handschuh versteckt, damit sie wie eine Hand aussah.
Sie sah sich selbst durch seine Augen. Für ihn lief alles langsam, sehr langsam ab, in roter Farbe, als wäre die ganze Welt in Blut getaucht. Eine Frau mit rotem Haar und scharlachrotem Hemd, die sich unendlich langsam an einer Wand entlangtastete.
Hirngespinste. Es waren auch damals schon Hirngespinste. Du hast diesen Dämon niemals gesehen.
Jenna nickte wieder, aber sie konnte den Atem des Wesens im Nacken spüren. Vielleicht würde es sich auch dieses Mal wieder verkleiden, vielleicht würde es in die verrottende Hülle Ezechiels schlüpfen und ihr zeigen, wie sich die Sonne verdunkelte. Dieses Mal würde sie kein dunkles Glas haben, das ihn verriet. Aber vielleicht würde das keinen Unterschied machen, denn damals hatte sie durch einen Spiegel ein dunkles Bild gesehen, heute aber würde sie ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen.
Es war kein Dämon. Er war Ezechiel. Ich weiß, dass du das nicht hören willst, aber es war dein geliebter Onkel. Er selbst. Keiner, der sich als Ezechiel verkleidet hatte. Und ganz sicher kein Dämon. Sieh es ein. Sieh es endlich ein.
Cassia klang ungehalten, und in einem Punkt hatte sie Recht: Jenna wollte das tatsächlich nicht hören. Sie kniff die Augen zusammen und versuchte, Cassia auszusperren, aber die Stimme ihrer Schwester lachte höhnisch auf. Es schien ihr zu gefallen, Jenna zu peinigen, denn in ihren Worten lag eine boshafte Zufriedenheit.
Ezechiel selbst. Er trug vielleicht sein Sonnenfinsternisgesicht, aber es war kein Dämon. Es war dein Onkel.
Jenna setzte sich auf den kalten, feuchten Steinboden und presste sich die Hände auf die Ohren. Konnte Cassia denn nicht einfach aufhören und verschwinden? Cassia war doch damals gar nicht dabei gewesen, wie konnte sie sich anmaßen, an Jennas Erinnerung zu zweifeln?
Dir sollten langsam ein paar Einsichten kommen, die eigentlich auf der Hand liegen, meine liebe Jenna. Es war Ezechiel, und er wollte dich…
„Hör auf! Halt deinen Mund und hör auf!“ schrie Jenna in die dunkle Stille der Kanalisation und hielt sich die Ohren noch fester zu.
Und vielleicht will er das ja immer noch, fuhr Cassia kühl fort, als habe Jenna sie nie unterbrochen.
Dann verschwand sie. Jenna konnte förmlich spüren, wie sich Cassia aus ihr herauslöste. Ein schmerzliches Ziehen, dann ein Gefühl von dumpfer Leere. Dort, wo Cassia gewesen war, klaffte nun ein Loch.
Als hätte man mir einen Zahn gezogen, dachte Jenna verblüfft.
Sie dachte an die Sonne, die hell und strahlend an einem blauen Himmel hing, um in der Dunkelheit nicht den Verstand zu verlieren. Sie musste einen Weg hier herausfinden, sonst war sie verloren. Gleich würde sie weitergehen, sie brauchte nur einen winzigen Augenblick Ruhe. Einen Augenblick, in dem sie an helles, warmes Licht denken konnte. Gleich würde sie weitergehen. Gleich…gleich…
Geändert von El Toro (02.08.2013 um 10:00 Uhr)
-
XVIII. Jenna. Dämon am Feuer
Die Sonne hing wie ein feuriger Ball am blauen Himmel über der Hafenstadt. Jenna fand Ezechiel auf der Südseite des Hauses. Er kauerte über einem kleinen, qualmenden Feuer aus grünen Zweigen und wandte Jenna den Rücken zu. Seine linke Hand steckte in einem großen, gesteppten Handschuh aus dickem, grünem Stoff. Mehrere Glasscheiben, die er sorgfältig aus dem bröckelnden Kitt des alten Schuppenfensters gebrochen hatte, waren neben ihm aufgestapelt. Eine davon hatte er mit einer Zange gepackt und hielt sie in den Qualm des Feuers. Jenna stellte sich vor, wie er ihr diese Glasstücke als besondere Lagerfeuerköstlichkeit anbieten würde, vielleicht mit etwas Fleischwanzenragout auf einem Teller angerichtet, und wie er sagen würde: „Eine besonderrre Spezialität vom Hofe Zubens von Varrrant, oh Tochter des Liebrrreiz!“ und dabei mit der Hand in dem dicken, grünen Handschuh galant winken würde.
Sie prustete vor Lachen, worauf er sich zu ihr umdrehte und ebenfalls grinste. Ein kleiner, stämmiger Mann mit Schweißperlen auf der Stirn und Spuren von Ruß auf der rechten Wange. Sein Oberkörper war nackt, und ein Tropfen Schweiß rollte langsam an seinem Hals hinab, tropfte auf seine Leinenhose und hinterließ dort einen winzigen, dunklen Fleck. Obwohl Ezechiel seine Augen wegen des starken Rauchs zusammengekniffen hatte, war Jenna von ihrem strahlenden Grau überwältigt, leuchtend und klar wie ein Tagesanbruch über der winterlichen myrtanischen See. Während sie ihn betrachtete, wurde ihr plötzlich mit silberheller Klarheit bewusst, dass auch er sie ansah. Sie musste schlucken. Ihr Hals war auf einmal trocken. Möglicherweise lag das am beißenden Rauch des kleinen Feuers. Schnell senkte sie ihren Blick und zupfte am Saum ihres Sommerkleides herum, das ihr letztes Jahr gepasst hatte, aber nun viel zu kurz und über der Brust rätselhafterweise zu eng wurde.
Er findet mich darin schön wie eine Prinzessin!
„Jenna! Wie schön, dass du schon da bist.“, rief Ezechiel ihr zu.
„Was machst du denn da?“, fragte Jenna leise. Sie hielt den Kopf dabei ein wenig gesenkt, so dass das lange rote Haar ihre glühenden Wangen verdeckte.
„Das sind Sonnenfinsternisgläser“, erwiderte er, „Wenn du zwei oder drei übereinander legst, kannst du die ganze Sonnenfinsternis betrachten, ohne dass die Sonne deinen Augen schadet. Die Feuermagier haben davor gewarnt, ohne Scheu und Ehrfurcht ins Antlitz Innos’ zu schauen, auch wenn es Ihm gefällt, sein Licht für einen Moment zu verdunkeln. Daron hat gestern verkündet, dass ein einziger Blick in die Sonne die Augen verbrennen kann. Es tue nicht weh und man merke es daher erst viel zu spät. Kein Sterblicher solle es wagen, Innos zu versuchen, indem er ohne Schutz in sein Antlitz sieht.“
Jenna schauderte trotz der Wärme. Der Gedanke, sich zu verbrennen, ohne es zu merken, bevor es zu spät war, kam ihr unwahrscheinlich schlimm vor.
„Darf ich jetzt schon durch ein Glas schauen? Bitte.“
„Hier, aber sei vorsichtig.“ Ezechiel reichte ihr das Glas, das er eben über dem Feuer geschwärzt hatte. „Wenn du dein hübsches Kleid schmutzig machst, wird deine Mutter sehr, sehr böse sein.“ Er lächelte und zwinkerte ihr verschwörerisch zu. „Wir wollen ja nicht, dass deine Mutter böse wird, oder?“
Jenna lachte und nahm das Glas entgegen. „Ich bin ganz vorsichtig, großes Paladinehrenwort.“
Sie hielt die rußgeschwärzte Scheibe vorsichtig am unteren Rand fest. Sie kam ihr merkwürdig schwer vor. Jenna verspürte plötzlich einen so starken Widerwillen, dass sie das Glas am liebsten in Gras hätte fallen lassen. Das stumpfe, unregelmäßige Schwarz sah falsch aus, wie die Oberfläche eines sumpfigen Gewässers. Unbewegt und seltsam flach, aber wer konnte sagen, was in der Tiefe lauerte? Sie sah zu Ezechiel hinüber. Er lächelte ihr aufmunternd zu. Sie wollte ihn nicht enttäuschen, also wandte sie sich zum Meer und hob die Scheibe mit beiden Händen vor das Gesicht. Die Welt um sie herum wurde dunkel. Nein, es war…anders. Es war, als würde sie durch das schwarze Glas nicht mehr die Wirklichkeit sehen, sondern ein Bild, ein dunkles Bild, ein Bild, das aussah wie die Wirklichkeit, wenn man sich mit einem oberflächlichen Blick zufrieden gab. Es kam ihr vor, als wolle die Dunkelheit sie nur täuschen. Etwas versteckte sich nämlich darunter. Jenna wollte das grau schäumende Wasser des Meeres nicht länger ansehen. Sie drehte sich zu Ezechiel um, die geschwärzte Scheibe immer noch vor dem Gesicht. Durch das dunkle Glas sah sie Ezechiel am Feuer kauern. Jenna erschrak. Das, was dort am Feuer saß, mochte aussehen wie Ezechiel. Es hatte sich verkleidet, damit sie glaubte, es sei Ezechiel. Es kauerte am Boden und wartete, die Glieder bereit zum Sprung, zitternd vor unterdrückter Gier. Es bemerkte ihren Blick durch das dunkle Glas hindurch, fletschte die Zähne zu einem Grinsen und winkte ihr mit einer Klaue zu, die es in einen riesigen schwarzen Handschuh gesteckt hatte, damit Jenna sie für eine Hand hielt. Inmitten seines dunklen Gesichts schwebte ein gewaltiges, goldenes Auge. Jenna spürte, wie ihre Hände kraftlos wurden. Die Glasscheibe glitt aus ihrem Griff und fiel mit einem dumpfen Laut ins Gras.
Ezechiel ließ die Hand sinken und sah Jenna besorgt an.
„Ist alles in Ordnung? Ist dir nicht gut?“
Jenna starrte Ezechiel an. Der Dämon, der dort am Feuer gekauert hatte, war verschwunden.
Nicht verschwunden. Er war nie da.
Sie lächelte unsicher. Nur kleine Kinder sahen in der Dunkelheit Gespenster.
Ich habe sein Sonnenfinsternisgesicht gesehen.
„Mir ist ein bisschen schwindelig geworden.“
Ezechiel sah sie einen Augenblick lang zweifelnd an. Doch dann wich die Verunsicherung einem Ausdruck väterlicher Sorge, der Jenna fast schon wieder zum Lächeln brachte.
„Es ist sehr schwül heute. Komm, setz dich, ich hole dir ein Glas Wasser.“
Er erhob sich und verschwand in seiner Hütte.
Jenna bückte sich und hob die Glasscheibe auf. Das Gras hatte den Aufprall gedämpft, so dass sie nicht zerbrochen war. Jenna verspürte einen Moment lang den fast unwiderstehlichen Drang, das schwarze Glas mit aller Kraft auf den Boden zu schleudern, damit sein blindes, dumpfes Starren in tausend winzige Splitter zerbarst. Aber sie war schließlich kein kleines Kind mehr. Sie hing zum Feuer hinüber und legte die Scheibe sorgfältig auf den Stapel und unterdrückte den Impuls, sich die Hand an ihrem Kleid abzuwischen. Dann dachte sie daran, was Ezechiel ihr aufgetragen hatte und setze sich ins Gras. Sie musste ihr Kleid dabei ein ganzes Stück raffen, wenn sie nicht wollte, dass sie am Abend Ärger wegen der Grasflecken bekommen würde. Jenna vermutete, dass ihr in jedem Fall Ärger bevorstand, doch sie hatte nicht vor, ihrer Mutter auch noch einen Grund dafür zu liefern.
Ein kleiner blauer Schmetterling landete auf ihrem Knie. Jenna sah fasziniert zu, wie die Flügel des Tieres leicht bewegten, wie der Rhythmus eines Herzschlages. Die winzigen Schuppen schillerten metallisch im Sonnenlicht. Der Schmetterling krabbelte ein Stück an ihrem Bein hinauf, hielt wieder inne und betastete seine Umgebung. Die Berührung war so leicht, dass Jenna sie kaum wahrnehmen konnte. Der Schmetterling entschied, dass es Zeit zum Weiterreisen war und flatterte davon. Als Jenna ihm nachsah, bemerkte sie einen Schatten im Augenwinkel. Sie drehte sich um. Ezechiel war aus dem Haus gekommen, ein Glas Wasser in der Hand. Er sah sie an, und sie wusste, dass er sie die ganze Zeit über angesehen hatte. Eine Woge von Verlegenheit schwappte über Jenna hinweg.
„Geht es dir besser?“ Ezechiels Stimme klang belegt. Er räusperte sich und fuhr fort: „Ich will auf keinen Fall, dass deine Mutter nachhause kommt und einen Zettel findet, auf dem steht, dass ich dich zur Heilerin bringen musste.“ Er zwinkerte ihr scherzhaft zu.
„Mama war nicht begeistert von der Idee, dass ich heute bei dir bleibe, oder?“, fragte sie leise.
Ezechiel setzte sich neben Jenna ins Gras und legte seinen Arm um ihre Schulter. „Nein“, sagte er langsam, „aber ich. Ich war begeistert genug für uns beide.“ Er lächelte sie so strahlend an, dass sie einfach zurücklächeln musste.
„Jenna?“
Sie sah fragend zu ihm hinauf. Da erhob sich Ezechiel mit einer abrupten Bewegung und entfernte sich einige Schritte vom Feuer. Jenna war verwirrt. Ezechiel sagte nichts, sondern sah sie nur an, während ihm Schweißperlen langsam über Stirn und Wangen rannen, und Jenna bekam es plötzlich mit der Angst zu tun.
Er weiß, dass ich sein Sonnenfinsternisgesicht gesehen habe.
Dann lächelte er wieder, und alles war gut.
„Du siehst heute sehr hübsch aus, Jenna.“ Ezechiel senkte die Stimme, deutete eine galante Verbeugung an und fuhr fort: „O Tochterr des Liebrreiz, Ihrr seht wun-derr-schön aus heute.“
Jenna lachte laut auf, aber ihr Herz schlug auf einmal sehr schnell und sehr fest gegen ihre Rippen.
Geändert von El Toro (03.08.2013 um 14:48 Uhr)
-
XIX. Jenna. Keine Zeit verlieren.
Jenna schrak hoch und riss die Augen auf. Tiefe Dunkelheit um sie herum. Die Sonne musste sich mittlerweile völlig verdunkelt haben und sie hatte…
Die Kanalisation. Ich bin in der Kanalisation.
Sie musste eingeschlafen sein, dabei hatte sie keine Zeit zu verlieren. Sie stand abrupt auf, und ihr Leinenhemd raschelte in der Dunkelheit.
„Wer ist da?“, fragte eine Stimme direkt vor ihr.
-
XX. Morgan. Augen.
„Wer ist da?“
Das Geräusch verstummte, aber Morgan war sich sicher, ein leises Atmen in der Dunkelheit zu hören. Er starrte in den Tunnel vor ihm. In der Ferne ein leises Tropfen von Wasser, tief unter ihm das beständige, gleichgültige Rauschen des Meeres. Die Sekunden dehnten sich zu Ewigkeiten.
So leise, wie er konnte, begann der wieder zu atmen. Er musste sich getäuscht haben. Er richtete sich auf und versuchte, in der Finsternis etwas zu erkennen, die sich vor ihm ins Endlose erstreckte.
Ein leiser, unsicherer Schritt, irgendwo in seiner Nähe. Es war unmöglich zu sagen, wie nahe. Eine kalte Hand zog sich in seiner Brust zusammen.
Ruhig bleiben.
Wieder hielt er die Luft an, duckte sich und lauschte. Das Geräusch von bloßen Füßen auf Stein.
Sie haben mich gefunden.
Morgans Verstand erschuf grässliche, verfaulende Wesen, die mit blinden Augen durch die Dunkelheit schlichen, seinem Geruch folgten und ihn einkreisten. Oh, sie hatten sich Zeit gelassen, die Schlinge zuzuziehen, aber jetzt begannen sie, die Freude an ihrem Spiel zu verlieren. Er konnte weiße, mit Seepocken bewachsene Hände sehen, die spielerisch nach ihm schlugen, ihn absichtlich um Zentimeter verfehlten, Hände wie bleiche Seesterne, nackte zerfressene Füße, die über den feuchten Stein glitten, und immer wieder blinde, tote Augen, die milchigtrüb ins Dunkel starrten. Sie schlichen auf ihn zu und jetzt wollten sie, dass er sie bemerkte, sie wollten, dass er wusste…
Wieder ein leiser, barfüßiger Schritt.
Obwohl er wusste, dass es eine Torheit war, die ihn zu einem leichten Ziel machte,
Sie sind doch blind, sie sehen in der Dunkelheit.
riss er den Beutel mit den Streichhölzern aus seiner Tasche. Er wollte nicht blind sterben. Er musste an den kopflosen Leichnam der Frau denken, die hier im Dunklen gestorben war. Es musste entsetzlich gewesen sein. Der Beutel verfing sich am Saum seiner Tasche, glitt ihm aus der Hand und fiel zu Boden. Ganz nah das leise Rascheln von Stoff.
„Kommt nicht näher. Ich werde nicht kampflos aufgeben.“ Morgan erschrak beim Klang seiner eigenen Worte. Das Echo antwortete ihm und verzerrte sich zu der gefährlich heiteren Stimme eines näher kommenden Wahnsinnigen.
„…los aufgeben … aufgeben…aufgeben…“
„Mein Gott“, flüsterte Morgan, und das Echo flüsterte: „…Gott…Gott…“
Er hörte nun ganz deutlich Atemzüge. Jemand versuchte mit aller Macht, flach und unhörbar zu atmen, aber es gelang ihm nicht. Morgan hörte die Angst in diesen Atemzügen, und obwohl er wusste, dass das ein Trick war, ein Trick sein musste, linderte das seine eigene Angst ein wenig. Er streckte seine Hand in die undurchdringliche Dunkelheit aus…und schrie auf. Er hatte etwas berührt, etwas, das vor ihm stand und das nun ebenfalls schrie. Es hörte sich an wie der Schrei einer Frau. Trick oder nicht, er musste schneller sein als das Wesen, das immer noch mit panischer, brüchiger Stimme schrie. Seine Hand schnellte wieder in die Dunkelheit und umfasste etwas, das ein Arm sein konnte. Er riss das schreiende Ding aus der Dunkelheit zu sich heran, packte mit der anderen Hand dessen Hals und drückte zu. Das Ding schien kleiner zu sein als er, leichter und offenbar in höchster Angst. Es zappelte in seinem Griff, wehrte sich und schlug um sich, jedoch unkontrolliert und ohne ihn zu treffen. Es schien allein zu sein, denn obwohl Morgan mit einem Angriff aus der Finsternis gerechnet hatte, geschah nichts. Das Geschöpf wand sich und versuchte verzweifelt, sich zu befreien, und ein nachtschwarzes Gefühl überflutete ihn, ein Gefühl von Erregung und Macht. Er drückte noch etwas fester zu.
„Was bist du? Was habt ihr mit Khorinis gemacht?“, flüsterte er.
Das Wesen wehrte sich immer noch, aber seine Bewegungen wurden kraftloser. Wenn er eine Antwort wollte, dann musste er seinen Griff lockern.
„Hör zu, ich lasse dich los, aber wenn du auch nur eine falsche Bewegung machst, dann drücke ich wieder zu. Verstanden?“
Er glaubte, dass das Wesen ihn verstanden hatte, denn es hörte auf, sich in seiner Umklammerung zu winden. Es schien sogar zu nicken. Morgan löste seine Hand vom Hals der Kreatur, die nun ein ersticktes Husten ausstieß. Er tastete nach dem anderen Arm, fand ihn und grub seine Hand in das weiche Fleisch. Es fühlte sich erstaunlich lebendig an. Das Geschöpf zitterte und hustete.
„Ich…tu mir nichts…bitte“, flüsterte das Wesen. Es war eine Frau, Morgan war sich nun ganz sicher. Das machte es jedoch nicht weniger gefährlich.
„Was bist du?“
„Ich bin Jenna…“ die Stimme der Frau ging in einem Hustenanfall unter.
Er riss die Frau grob herum und zischte: „Was zur Hölle bist du? Sag es mir, oder ich…“
„Jenna, ich bin Jenna!“ schrie die Frau, und ihre vor Angst schrille Stimme brach. „Tu mir nichts, ich will doch nur hier heraus.“
„Rühr dich nicht von der Stelle. Eine Bewegung, und ich breche dir das Genick.“ fuhr Morgan fort. Seine Lippen waren kalt und wächsern. Er ließ die Frau mit einer Hand los, ging leicht in die Knie und zog sie mit sich herunter. Sie folgte seiner Bewegung ohne den geringsten Widerstand. Mit der freien Hand tastete er nach dem Beutel mit den Streichhölzern. Seine Finger glitten über feuchtes Moos und glitschige Steine, bis sie schließlich das tröstliche Leder ertasteten. Morgan gelang es, ein Streichholz aus dem Beutel zu ziehen und zu entzünden.
Die kleine Flamme glomm zwischen ihnen auf wie eine düstere Sonne und tauchte den Tunnel um sie herum in orangegelbes Licht.
Sie ist keines von den toten Geschöpfen. Innos, sie ist wie ich.
Er blickte in das kalkweiße Gesicht einer Frau, aus dem ihn riesige dunkle Augen ansahen. Für den Bruchteil einer Sekunde lag noch Todesangst darin, dann stieg maßlose Verwunderung in ihnen auf.
Ich hätte sie fast getötet.
Sie öffnete den Mund, aber sagte nichts. Lange rote Locken hingen ihr wirr ins Gesicht, und plötzlich erkannte er, dass sie die Frau gewesen sein musste, die man mit ihm auf dem Wagen zum Statthalterpalast transportiert hatte. Aus irgendeinem Grund trug sie ein weißes Nachthemd, das hier unten in der Kanalisation seltsam unwirklich erschien.
Ein bisschen fester, und sie wäre jetzt so tot wie die Frau dort vorne.
Dumpfes Entsetzen erfüllte ihn angesichts dieses Gedankens. Sein Blick wanderte zu ihrem Hals und ihren Armen und er sah die dunkelroten Stellen, die sein Griff dort hinterlassen hatte.
Nur ein kleines bisschen fester…wie damals…
Bevor die kleine Flamme verlosch, sah er, dass ihre Hände mit weißem Stoff verbunden waren und erinnerte sich an die schlimmen Verletzungen, die er an ihr gesehen hatte, als sie bewusstlos neben ihm unter dem weißen Himmel von Khorinis gelegen hatte.
Nur ein kleines bisschen fester…
Die Welt versank wieder in Dunkelheit. Morgan konnte nur daran denken, dass er sie beinahe getötet hatte, immer wieder schien eine Stimme zu flüstern:
Nur ein kleines bisschen fester… wie damals…
Die Frau fand ihre Sprache als erstes wieder. „Tu mir nichts“, murmelte sie, aber die Todesangst war aus ihrer Stimme gewichen.
Morgan strich sich mit der Hand über das Gesicht und versuchte, das quälende, leise Flüstern aus seinem Kopf zu verbannen.
„Ich werde dir nichts tun. Ich dachte, du wärst eines dieser…dieser…“ Er rang nach Worten, fand aber keine.
„Ich bin Jenna“, sagte sie. „ich suche einen Weg aus dieser Stadt hinaus. Ich bin keines von diesen toten Dingern.“
„Morgan“, sagte er, „ich bin Morgan. Ich bin ihnen entkommen.“
Er schwieg einen Moment, und auch Jenna sagte nichts.
„Ich…ich wollte…dir nicht weh tun“, sagte Morgan. „Ich dachte… diese Wesen, sie haben mich verfolgt und…ich…“ Morgans Stimme verlor sich in der Dunkelheit, und die Dunkelheit schwieg. Dann spürte er eine kleine, kühle Hand an seinem Gesicht
weiß und mit Sommersprossen
und Jenna sagte: „Du bist ein lebendiger Mensch.“ Dabei klang ihre Stimme so erstaunt, als müsse sie sich selbst davon überzeugen, dass er das tatsächlich war. „Hilf mir, hier heraus zu kommen. Kannst du das?“
Morgan wusste es nicht, aber er nickte. Sie musste die Bewegung seines Kopfes gespürt haben – ihre Hand lag immer noch auf seiner Wange -, denn sie sagte: „Gut. Das ist gut.“
Und als er nichts erwiderte und keine Anstalten machte, sich zu bewegen, fügte sie mit leisem Spott hinzu: „Dann lass uns weitergehen. Oder sollen wir noch ein wenig plaudern?“
Morgan war verwirrt, aber sie ließ ihm keine Zeit zum Nachdenken. Sie zog ihn sanft am Arm in einen Kanal, der nach Westen führen musste, wenn sich Morgan noch auf seinen Instinkt verlassen konnte.
„Ich glaube, dass es dort hinten etwas heller wird. Nur ein schwacher Schimmer, aber…“
Morgan blinzelte in die Dunkelheit und stellte fest, dass er es auch sehen konnte. Es war wirklich nur ein ganz schwacher Schimmer, und er war so allmählich gekommen, dass er ihn nicht bemerkt hatte. Sie tasteten sich weiter nach vorne, und bald konnte Morgan das matte Glänzen des feuchten Steinbodens sehen und Umrisse im Dunkeln erkennen. Sie hielten auf die Lichtquelle zu, zwängten sich an einem großen Stapel vermodernder Holzkisten vorbei und sahen es.
Licht ergoss sich in zwölf dünnen, feinen Rinnsalen durch die Löcher eines Kanaldeckels in die Kanalisation, strömte über den Boden, bildete Lachen, versickerte und verlor sich. Es war erbärmlich wenig Licht, das kaum ausreichte, eine Fläche von fünf Schritten zu erhellen, aber Morgan und Jenna starrten es fassungslos an.
Licht!
Morgan sah Jenna im grauen Dämmerlicht des Tunnels. Ihr Gesicht war ein weißes Oval, umrahmt von einer Flut dunkelroter Locken. Ihre Haut schien beinahe so weiß zu sein wie das dünne Hemd, das sie trug und die Verbände an ihren Händen. Sie schien ungefähr in seinem Alter zu sein, aber ihre Augen ließen sie zugleich jünger und älter erscheinen. Es waren die Augen eines sehr jungen Mädchens auf einem alten Gemälde; eines Mädchens, das vielleicht zuviel über seinen Vater wusste.
Etwas in ihrem Blick verwirrte ihn. Morgan versuchte, den Ausdruck ihres Gesichts zu deuten. Hatte er eben noch gedacht, Erleichterung oder Freude über dieses winzige Geschenk, das ihnen das Schicksal gemacht hatte, auf ihren Zügen ausmachen zu können, bemerkte er nun, dass Jenna die kleinen Öffnungen des Kanaldeckels so misstrauisch ansah, als fürchte sie, etwas Hässliches, Gefährliches könnte sich unbemerkt hindurchzwängen.
Es ist doch nur Licht. Ein Geschenk Innos’, dachte er, und doch kam es ihm mit einem Mal vor, als ob ein winziger Teil von Khorinis mit diesem Licht in die Kanalisation fiele. Vielleicht sind es die Augen von Khorinis. Sofort fühlte er sich unbehaglich.
Er widerstand dem Impuls, aus dem kleinen Lichtkreis herauszutreten. Die Lichtpunkte sahen ihn an. Khorinis hatte seine toten Schergen hinter ihm hergeschickt, und sie hatten ihn verloren – oder entkommen lassen.
Jetzt musste Khorinis selbst nach ihm suchen. Und obwohl ihm dieser Gedanken vor einem Augenblick noch lächerlich erschienen wäre, hatte er auf einmal Angst. Die Lichtpunkte ließen ihn nicht aus den Augen und plötzlich schienen sie ihm mit boshafter Heiterkeit zuzuzwinkern.
Es ist nur eine kleine Wolke, die sich vor die Sonne geschoben hat.
Er konnte den Blick nicht abwenden, obwohl er spürte, dass etwas nach ihm griff. Nach seinem Verstand. Aber er hatte auf einmal keine Angst mehr. Was passierte, sollte passieren. Und während er noch die Staubkörner betrachtete, die in den dünnen Fäden aus Licht tanzten, hüllte ihn eine warme, freundliche Dunkelheit ein, nahm ihn in die Arme, drückte ihn an sich und verschloss ihm mit sanften Küssen die Augen.
Geändert von El Toro (02.08.2013 um 10:10 Uhr)
 Berechtigungen
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
|
Dieses Schuldgefühl habe ich seit Jahren meiner Erstlingsgeschichte im Forum gegenüber, „Durch einen Spiegel ein dunkles Bild“. Irgendwie bin ich damals in eine Sackgasse geraten, die Erzählfäden waren durcheinandergeraten, der Falke davongeflogen. Aber es hat mir immer Leid getan, denn, nun ja, ich mochte die Geschichte um Morgan und Jenna wirklich. Also will ich sie noch mal erzählen, neu überarbeitet, etwas gestrafft (wer hätte das nicht gern?) und ohne die ganz peinlichen Stellen, die John immer zum Lachen gebracht haben.







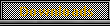



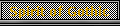










 World of Players
World of Players
 [Story]Durch einen Spiegel ein dunkles Bild (remastered)
[Story]Durch einen Spiegel ein dunkles Bild (remastered)










