-
Chemie problem
hallo, ich hab hier ein problem
und zwar haben wir im chemie unterricht ein versuch durchgeführt, in dem wir in Kaliumnitratlösung jeweils NaCl, NaNO3 und KCl Lösungen (alle gesättigt) gegeben habe. bei den ersten beiden entstanden Schlieren die sich aber wieder auflösten und bei dem letzten passierte quasi nichts. kann mir jemand quellen geben wo erklärt wird was passiert? oder mir verraten wonach genau ich suchen muss?^^
oder von mir aus auch gleich erklären was passiert^^
vielen dank schonmal
mfg
-
Spukhaft.
Nicht integrierbar.
Grenzdebil.
-
ist nicht on ._.
sonst hätte sie ne pn gekriegt =D
-
Es wird wohl ein Salz entstehen, das sich nach kurzer Zeit wieder löst.
-
das reicht aber nicht für eine wissenschaftliche auswertung des versuchs...
-
Wo es nichts auszuwerten gibt, gibt es nichts auszuwerten. Da ist genau gar nichts passiert, außer dass ihr zwei Lösungen zusammengekippt habt und diese sich vermischt haben. Wow, spannendes Experiment. Meinen Glückwunsch. Wieso habt ihr nicht was gemacht, wo irgendwas explodiert? 
Schlieren deuten in aller Regel auf Dichteunterschiede hin. Kann also sein, dass die NaCl-Lösung eine deutlich höhere oder niedrigere Dichte hat als die Kaliumnitratlösung.
Ansonsten könnte man noch hinschreiben, dass sich keine schwerlöslichen Salze gebildet haben, sondern die Lösungen sich alle schön brav vermischt haben.
-
hmh... vll. poste ich mal lieber den genauen versuchsverlauf:
Geräte:
Thermometer
4 Bechergläser (100ml)
3 Reagenzgläser
Reagenzglasständer
3 Pipetten (2ml)
Wasser (50ml/3*10ml)
4 Spatel
Spritzflasche
Messzylinder (100 ml)
Kreide
Bunsenbrenner
Feuerzeug
Dreifuß
Becherglas (600ml)
Chemikalien:
Kaliumnitrat (o) (KNO3)
Kaliumchlorid (KCl)
Natriumnitrat (o) (NaNO3)
Natriumchlorid (NaCl)
Durchführung:
Zunächst wurde ein Becherglas mit 50 ml Wasser gefüllt und danach so lange Kaliumnitrat hinzugeben bis eine gesättigte Lösung vorlag(bei Zimmertemperatur)(mit Bodensatz). Danach wurde die Lösung mit Bunsenbrenner und Dreifuß auf ca. 80 °C erhitzt und danach wieder in einem mit Eiswasser gefülltem Becherglas auf Zimmertemperatur abgekühlt. Währenddessen wurde in 3 weitere Bechergläser 10 ml Wasser gefüllt und mit den 3 anderen Salzen eine gesättigte Lösung hergestellt. Dann wurde die Kaliumnitratlösung auf 3 Reagenzgläser aufgeteilt (ca. 2 cm hoch) und die anderen 3 Lösungen in tropfenweise in je eins der Reagenzgläser gegeben.
Beobachtung:
Zunächst ist festzustellen, dass beim Erhitzen der Kaliumnitratlösung der Bodensatz sich bei ca. 60 °C auflöst und sich Schaum auf der Oberfläche bildet. Alle Lösungsreaktion liefen endotherm ab.
Beim Zugeben der anderen Lösungen ist Folgendes zu beobachten:
Mit Kaliumchlorid und Natriumnitrat:
Schlierenbildung, die sich dann aber wieder auflösen
Mit Natriumchlorid:
Keine Schlierenbildung, also auch kein "Wiederauflösen"
-
Gut. Und weiter? Ihr habt trotzdem nur zwei Lösungen ineinandergeschüttet. Gut, dies ist tropfenweise geschehen, aber ich weiß wirklich nicht, was da Großartiges passiert sein soll...
Äh, ach ja: Gutes Protokoll. Auch sinnlose Experimente müssen sauber protokolliert werden 
-
 Zitat von k4r0tt3

Mit Natriumchlorid:
Keine Schlierenbildung, also auch kein "Wiederauflösen"
Lass' den Teil hinterm Komma weg.
Fertig. Wenn nicht mehr passiert ist, ist nicht mehr passiert. Allenfalls eine Erklärung dafür könnte man nachliefern, aber wenn es nicht zu den Eigenschaften jener Lösungen gehört, miteinander sichtbar zu reagieren, dann war's das.
Spukhaft.
Nicht integrierbar.
Grenzdebil.
-
 Zitat von readonly

Fertig. Wenn nicht mehr passiert ist, ist nicht mehr passiert. Allenfalls eine Erklärung dafür könnte man nachliefern, aber wenn es nicht zu den Eigenschaften jener Lösungen gehört, miteinander sichtbar zu reagieren, dann war's das.
Und genau so ist es. Die tun rein gar nichts miteinander.
Es sei denn, lass mich kurz nachfragen, was genau meinst du mit "Schlieren"? Farblose Schlieren oder weiße Schlieren?
-
weiß ich nicht mehr genau...^^
kann sein dass salze entstanden sind die sich dann wieder aufgelöst haben.
jedenfalls hab ich mir gedacht dass durch das hinzugeben von kaliumchlorid oder natriumnitrat eine "über"konzentration entsteht und dadurch dann ja irgendwas passiern muss. weil die lösung ja eigentlich an kaliumionen schon gesättigt ist und keine kapazitäten mehr frei hat noch weitere kaliumionen aufzunehmen. aber andererseits sind diese kaliumionen ja in ihrem "eigenen" wasser, von daher sollte es da eig. keine probleme geben...
aber es kann doch nicht sein dass wir einen versuch gemacht haben der rein gar nichts aussagt?^^
edit: findest du das feuerzeug und die kreide bei den materialien überzogen? ich hoffe doch ja, soll nämlich leicht sarkastisch wirken, weil meine lehrerin mir immer noch ein paar spatel und sonstiges bei der korrektur hinzufügt xD
wenn es nicht überzogen wirkt muss ich noch tisch stuhl und servietten zum saubermachen hinzufügen 
-
 Zitat von k4r0tt3

weiß ich nicht mehr genau...^^
Das ist wichtig. Wenn man in der Chemie nur von Schlierenbildung redet, dann redet man auch genau davon (und das würde nur auf Dichteunterschiede hinweisen). Und nicht etwa von ausgefallenen Salzen, die in der Lösung weiß erscheinen und halt in der Lösung rumwabern.
Wenn es tatsächlich weiße Schlieren gewesen sein sollten, wäre dein Gedankengang richtig. Lokale Übersättigung an Eintropfstellen gibt es und ist auch häufig zu beobachten.
Kannst das ja ins Protokoll schreiben, dann hüpft deine Lehrerin wahrscheinlich herum vor Freude.
edit: findest du das feuerzeug und die kreide bei den materialien überzogen? ich hoffe doch ja, soll nämlich leicht sarkastisch wirken, weil meine lehrerin mir immer noch ein paar spatel und sonstiges bei der korrektur hinzufügt xD
wenn es nicht überzogen wirkt muss ich noch tisch stuhl und servietten zum saubermachen hinzufügen 
Ehrlich, mir ist das völlig egal  Aber die Kreide würde ich rausnehmen... die diente wohl nur zum Schreiben an der Tafel, oder? Aber die Kreide würde ich rausnehmen... die diente wohl nur zum Schreiben an der Tafel, oder?
-
nein wir haben damit die bechergläser beschriftet^^
kannst du mir das mit der lokalen übersättigung etwas genauer erklären, oder mir irgendwelche quellen geben? das protokoll muss 15 punkte geben xD
-
 Zitat von k4r0tt3

nein wir haben damit die bechergläser beschriftet^^
kannst du mir das mit der lokalen übersättigung etwas genauer erklären, oder mir irgendwelche quellen geben? das protokoll muss 15 punkte geben xD
Nun, eigentlich war dein Gedankengang genau richtig... es ist schwierig, das genau zu erklären.
Genau genommen denke ich, dass es so ist: Die KNO3-Lösung, die ihr vorgelegt habt, ist übersättigt. Das liegt daran, dass ihr das KNO3 in der Hitze gelöst und dann die Lösung wieder abgekühlt hat. D.h. in der Lösung sind eigentlich schon mehr Ionen als reingehören.
Dann tut man z.B. NaNO3 dazu. Dadurch, dass die vorgelegte Lösung an Nitrat übersättigt ist, fällt NaNO3 aus. Dann verteilen sich die Natriumionen aber in der Lösung, wodurch die Konzentration an Na+ an der Eintropfstelle deutlich abnimmt und das Salz sich wieder auflöst.
Bei Zugabe von KCl entsprechend, nur dass halt K+ im Überschuss vorliegt.
Bei NaCl passiert gar nichts, weil in der Lösung vorher weder Na+, noch Cl- vorlagen. Daher kommt es auch nicht zu einer lokalen Übersättigung.
Also, so würde ich es jetzt erklären. Das muss nicht richtig sein, erscheint mir aber logisch.
-
das klingt gut ja^^
bleibt nur noch zu erklären warum heißes wasser mehr ionen aufnehmen kann als kaltes... ?
achja und warum die ionen nicht wieder ausfallen wenn mans wieder abkühlt. eine übersättigung kommt ja dadurch zustande dass einfach nicht mehr genug wasser da ist um eine hydrathülle auszubilden. und das wasser wird ja nicht mehr wenn mans erhitzt. und wenn mans wieder abkühlt müsste es ja wieder wie am anfang sein eigentlich
habs ma formuliert:
Die vorliegende KNO3 ist durch Erhitzen und anschließendes Abkühlen an K+ und NO3- Ionen übersättigt. Geben wir nun Natriumnitrat hinzu, entsteht zuerst einmal festes Natriumnitratsalz, da die Lösung an Nitrationen übersättigt ist. Natriumionen sind in der Lösung allerdings nicht vorhanden, deswegen verteilen sich diese sofort in der Lösung und die Konzentration von Natriumionen an der Eintropfstelle nimmt deutlich ab, das bedeutet, dass sich das Salz wieder auflöst (Das bewirkt die Schlierenbildung). Bei Hinzugeben von Kaliumchlorid passiert prinzipiell das gleiche, nur dass das übersättigte Ion hier das Kalium ist, nicht das Nitrat und das sofort lösliche Ion das Chlorid, anstelle des Natriums. Bei Hinzugabe von Natriumchlorid passiert nichts, da die Lösung weder Natrium-, noch Chloridionen enthält und somit für eben jene noch voll aufnahmefähig ist.
fehlt aber noch eben gefragtes.
Geändert von -RT- (08.12.2009 um 21:04 Uhr)
-
 Zitat von k4r0tt3

das klingt gut ja^^
bleibt nur noch zu erklären warum heißes wasser mehr ionen aufnehmen kann als kaltes... ?
Du hast es geschrieben. Der Lösevorgang ist endotherm. Das hast du daran erkannt, dass sich erst bei 60 °C alles KNO3 aufgelöst hat.
achja und warum die ionen nicht wieder ausfallen wenn mans wieder abkühlt. eine übersättigung kommt ja dadurch zustande dass einfach nicht mehr genug wasser da ist um eine hydrathülle auszubilden. und das wasser wird ja nicht mehr wenn mans erhitzt. und wenn mans wieder abkühlt müsste es ja wieder wie am anfang sein eigentlich
Du denkst völlig richtig.
Man spricht von einer "übersättigten Lösung", d.h. dass mehr Ionen im Wasser gelöst sind als eigentlich drin sein dürften. Bei manchen Salzen ist es leicht, übersättigte Lösungen herzustellen. Es ist so, dass die Bildung von Kristallen langsam vostattet geht. Man sagt, dass sie "kinetisch gehemmt" ist. Also, wenn man die Lösung ein paar Tage im Kalten stehen gelassen hätte, wäre das KNO3 auch wieder ausgefallen.
-
 Zitat von Zerwas

Du hast es geschrieben. Der Lösevorgang ist endotherm. Das hast du daran erkannt, dass sich erst bei 60 °C alles KNO3 aufgelöst hat.
das hieße ja, dass der lösevorgang nur deswegen nicht weiter vonstatten geht weil das wasser zu kalt geworden ist? ich mein die reaktion ist ja trotz endothermie exergonisch, folglich müsste es, wenn es an der temperatur läge, weiter vonstatten gehn. also die bloße temperaturerhöhung einfach aufgrund der endothermie ist irgendwie keine befriedigende antwort für mich^^ weil an energie mangelts ja nicht umbedingt, die kann das system ja der umgebung entziehen
 Zitat von Zerwas

Du denkst völlig richtig.
Man spricht von einer "übersättigten Lösung", d.h. dass mehr Ionen im Wasser gelöst sind als eigentlich drin sein dürften. Bei manchen Salzen ist es leicht, übersättigte Lösungen herzustellen. Es ist so, dass die Bildung von Kristallen langsam vostattet geht. Man sagt, dass sie "kinetisch gehemmt" ist. Also, wenn man die Lösung ein paar Tage im Kalten stehen gelassen hätte, wäre das KNO3 auch wieder ausgefallen.
das klingt doch intressant^^
könntest du das vll. noch weiter ausführen?^^
ich weiß jetzt zwar nicht inwiefern das relevant fürs protokoll ist (wrsl. eher weniger), aber einfach nur intressehalber^^
-
 Zitat von k4r0tt3

das hieße ja, dass der lösevorgang nur deswegen nicht weiter vonstatten geht weil das wasser zu kalt geworden ist? ich mein die reaktion ist ja trotz endothermie exergonisch, folglich müsste es, wenn es an der temperatur läge, weiter vonstatten gehn. also die bloße temperaturerhöhung einfach aufgrund der endothermie ist irgendwie keine befriedigende antwort für mich^^ weil an energie mangelts ja nicht umbedingt, die kann das system ja der umgebung entziehen
Alle Reaktionen, die ablaufen, sind unter den Bedingungen, unter denen sie ablaufen, exergonisch. Sonst würden sie nicht ablaufen. Exergonisch oder nicht ist aber von den Bedingungen abhängig.
Grundsätzlich ist es so, dass Bodensatz und Lösung im Gleichgewicht miteinander stehen und, je nachdem, wie groß ΔG ist (also je nachdem, wie stark exergonisch die "Auflöse-Reaktion" ist), stellt sich die Konzentration in der Lösung ein. Man kann eigentlich nicht absolut sagen, dass sich ein Stoff ab einer bestimmten Temperatur erst auflöst, sondern man kann eigentlich nur sagen, dass sich eine bestimmte Konzentration einstellt. Diese kann größer oder kleiner sein.
So, und wenn wir jetzt schon von exergonisch und endergonisch reden, dann füllen wir das Ganze doch mit etwas Leben und verstehen, was da passiert.
ΔG = ΔH - T ΔS
Angenommen, ΔH sei um einen bestimmten Betrag positiv, es handele sich also um eine endotherme Reaktion. Dann müsste T ΔS größer sein als ΔH, damit die Reaktion exergonisch wird.
Soweit so gut. Für Lösungsvorgänge ist ΔS immer positiv. Das heißt, dass Lösungsvorgänge in allen Fällen von höherer Temperatur begünstigt werden.
Wenn ΔH nur um einen kleinen Betrag positiv ist (oder ΔS sehr stark positiv), dann kann Raumtemperatur schon ausreichen, damit die Reaktion exergonisch wird. Das sind solche Reaktionen, bei denen man beobachtet, dass das Gefäß kalt wird. Die also endotherm sind und trotzdem schon bei Raumtemperatur ablaufen.
Hoffe, das war jetzt verständlich. In der Tat ist es natürlich so, dass auch das Auflösen von KNO3 bei Raumtemperatur schon exergonisch ist. Dennoch wird die Reaktion bei höherer Temperatur begünstigt und man bekommt bei höherer Temperatur einfach mehr in Lösung als bei kleiner.
Aber stimmt schon, es ist nicht unbedingt sinnvoll, zu schreiben, dass der Auflösevorgang endotherm vonstatten ging. Denn das würde man eigentlich nur wissen können, wenn man bei Raumtemperatur wirklich geschaut hätte, ob das Wasser sich beim Auflösen des KNO3 abgekühlt oder erwärmt hat.
das klingt doch intressant^^
könntest du das vll. noch weiter ausführen?^^
ich weiß jetzt zwar nicht inwiefern das relevant fürs protokoll ist (wrsl. eher weniger), aber einfach nur intressehalber^^
Naja, Kristalle sind hochgeordnete Strukturen. Es geht nicht so sehr schnell, diese aufzubauen. Daher ist es möglich, durch Abkühlen einer gesättigten Lösung hoch übersättigte Lösungen herzustellen, ohne dass irgendein Feststoff ausfällt. Weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Aber wenn du spezifische Fragen dazu hast, werde ich sie dir gerne beantworten.
Ich geh jetzt aber ins Bett, daher werde ich erst morgen antworten.
-
danke für alles, ohne dich wär ich verloren gewesen 
und ja dein letzter beitrag war verständlich. zwar nich unbedingt relevant für das protokoll aber sehr intressant^^
hier nochmal meine endauswertung, falls es dich intressiert:
Nach dem Lösen des Kaliumnitrats spaltet sich dieses in Kalium- und Nitrationen auf. Die Lösung ist dann gesättigt, wenn sich ein Bodensatz bildet. Dieser zeigt an, dass die Aufnahmekapazität des Wassers an diesen Ionen ausgeschöpft ist. Zwischen diesem Bodensatz und der Lösung stellt sich nun ein Gleichgewicht ein. Dies bezeichnet man als Löslichkeitsgleichgewicht. Die Masse des Niederschlags hat keine Auswirkungen auf das Gleichgewicht, daher vereinfacht man das Massenwirkungsgesetz. Es wird jetzt als Löslichkeitsprodukt bezeichnet: K = c (K+) * c (NO3−). Doch darauf kommen wir erst später zurück. Die nun vorliegende Kaliumnitratlösung ist durch Erhitzen und anschließendes Abkühlen an K+ und NO3- Ionen übersättigt. Um diese Übersättigung erklären zu können, muss etwas weiter ausgeholt werden. Wir wissen, die Reaktion läuft bei Standartbedingungen, trotz Endothermie, exergonisch ab. Daraus ergibt sich durch Berücksichtigung folgender Gleichung: ΔG = ΔH – T*ΔS, dass T*ΔS größer als 0 (bzw. größer als ΔH) sein muss. (Da ΔH ja ebenfalls positiv ist und ΔG kleiner als 0 sein muss, damit die Reaktion exergonisch abläuft). Das Wiederum bedeutet, dass hohe Temperaturen die Reaktion begünstigen(da dadurch dieser Term wächst und ΔG kleiner wird) und das bewirkt, dass sich bei einer Temperaturerhöhung auch mehr Salz lösen kann. Wir bekommen dadurch eine übersättigte Lösung. Dass sich diese Übersättigung bei Abkühlen nicht einfach wieder auflöst, liegt daran, dass die Kristallstrukturen die Ionen bei der Hydration eingehen, hochkomplexe Strukturen sind, die eine gewisse Zeit brauchen um sich wieder aufzulösen. Nun zurück zur eigentlichen Reaktion: Geben wir nun zur Kaliumnitratlösung Natriumnitrat hinzu, entsteht zuerst einmal festes Natriumnitratsalz, da die Lösung an Nitrationen übersättigt ist. An unserer Formel verdeutlicht (hier: L (KNO3) = c (NO3-) * c (K+)) bedeutet das, dass sich die Konzentration des einen Partners erhöht(also der Nitrationen) erhöht und sich somit auch die Konzentration des Produktes erhöht. Deswegen bildet sich vorerst ein Salz. Die Natriumionen sind in der Lösung allerdings nicht vorhanden, deswegen verteilen sich diese sofort in der Lösung und die Konzentration von Natriumionen an der Eintropfstelle nimmt deutlich ab, das bedeutet, dass sich das Salz wieder auflöst (Das bewirkt die Schlierenbildung). Bei Hinzugeben von Kaliumchlorid passiert prinzipiell das gleiche, nur dass das übersättigte Ion hier das Kalium ist, nicht das Nitrat und das sofort lösliche Ion das Chlorid, anstelle des Natriums. Bei Hinzugabe von Natriumchlorid passiert nichts, da die ursprüungliche Lösung weder Natrium-, noch Chloridionen enthält und somit für eben jene noch voll aufnahmefähig ist.
Geändert von -RT- (08.12.2009 um 22:45 Uhr)
 Berechtigungen
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
|







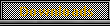



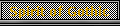










 World of Players
World of Players
 Chemie problem
Chemie problem













 Aber die Kreide würde ich rausnehmen... die diente wohl nur zum Schreiben an der Tafel, oder?
Aber die Kreide würde ich rausnehmen... die diente wohl nur zum Schreiben an der Tafel, oder?

