-
 [Story]Botanischer Garten München-Nymphenburg
[Story]Botanischer Garten München-Nymphenburg
Es folgt eine Szene, deren Ablauf simpel gehalten ist. Eine Person betritt ein Gebäude und trifft dort auf eine zweite Person. Ein Gespräch beginnt, das sich nach einiger Zeit zu einem handfesten Streit entwickelt, wobei es gegen Ende zu einem Kampf kommt.
-
---------------„Ich habe mal wieder meine Tage, einen Zyklus“
---------„Beliars Mundgeruch war heute wieder besonders schlimm,
------------------Vampire, Vampire, Vampire, Vampire, Vampire,
---Schwarz, dunkel, episch, geheimnisvoll – Ich bin der Größte!“
Rhàthrônh stieg ab, seine Füße sanken ein wenig in den frischen Schnee ein. Er ignorierte die aufkommende Kälte und sah sich um, wobei sein Blick an seinem edlen Reittier hängen blieb.
Die vier langen, starken Beine, die sich in das schwarze Gesamtbild des Tieres einfügten, ein kräftiger Hals samt schöner Mähne, ein wunderbares Hinterteil...
„Mein Gott“, sagte Rhàthrônh und legte ungeachtet der Unsinnigkeit seine Stirn in tiefe, nachdenkliche Falten.
„Ich steh auf Pferde!“
Der Schneefall hatte wieder begonnen, und erschwerte die Sicht auf die großartigen Weiten dieser Eislandschaft, deren eisige Kälte ebenso eindrucksvoll war wie die Schönheit, die sich durch die weißen Decken, den leichten Anklang von Nebel und den überdurchschnittlich vielen Gletschern und Höhlen ausdrückte, die die Natur in all ihrer Macht geschaffen hatte. Nun gut, wie bereits erwähnt sah Rhàthrônh davon nicht viel, weil der Schneefall ja immer stärker wurde, aber er wusste, dass es so sein musste – Es war ja schließlich immer so.
In dieser verlassenen Gegend befand sich hanebüchener Weise ein Haus, ein kleines Haus, das war sein Ziel.
Er schritt darauf zu – denn Schreiten ist viel würdevoller, auch wenn einem bei der Eiseskälte der Arsch abfriert – und klopfte dreimal fest gegen die schwere Holztür.
Das Zimmer, das sich vor ihm auftat, war übermäßig reich verziert: teure Sessel, obwohl nur eine Person hier wohnte, ein Kaminfeuer, ein teurer Tisch, sogar der Boden war mit fein bearbeiteten Steinen ausgestattet. Ansonsten hingen Bilder an der Wand, die Vampire oder Vampire zeigten. Oder Wein, den Wein, den der Bewohner dieses Hauses so gerne trank.
„Sei gegrüßt, Rhàthrônh, mächtiger Magier ohne irgendeine Aufgabe, welcher ständig nur hin und her reist“, er nahm noch einen großen Schluck aus dem Weinglas, „jener, der zu faul war, sich einen anständigen Beruf zu suchen.“ Er nahm noch einen weiteren Schluck Wein und sagte erbost: „Du bekommst keinen bisschen davon ab.“
Lyasudius hatte ihm geöffnet und erst einmal einen langweilig Monolog gehalten, und setzte sich nun auf seinen großen Thron, dessen Verzierungen ebenso übertrieben waren wie sein Gehabe.
„Ich will ausnahmsweise gleich zur Sache kommen“, meinte Rhàthrônh, und brach damit so einige Regeln seines Charakters.
„Der Rat schickt mich um herauszufinden, wie die Lage hier in den Ebenen steht.“
„Weiß Noxusiusiusisus schon davon?“, fragte Lyasudius Rhàthrônh und leerte sein Glas, woraufhin er umgehend nachschenkte.
„Es ist davon auszugehen“, lautete die Antwort, „die Minister haben in den Reichen für einige Unruhen gesorgt, und der König verliert mehr und mehr seine Macht. Die Vampire sind dem Aufstieg nahe, und der Rat der Magier ist besorgt darüber. Der Plan ist in Gefahr, der Krieg mit den Orks ist außer Kontrolle. Die Handelsbündnisse der Städte sind durch die geheime Organisation, die Grabarurach führt, geschädigt, und Xardas ist im Urlaub.“
„Das bringt unseren Plan tatsächlich in Gefahr“, sagte Rhàtrônh leise, sein Gesicht verfinsterte sich.
„Aber was ist mit Nordmar? Die Außenposten stehen noch. Zwar ist Kagrimbibus noch nicht seinen Truppen zur Verstärkung gekommen, doch noch ist nichts verloren. Es sei denn, die geheime Organisation hat bereits Kunde von Exandrulus und Niklililbius erhalten...“
„Du vergisst Omnibus“, kommentierte Lyasudius die Ausführungen seines Gesprächspartners, welcher daraufhin ein mildes Lächeln zeigte.
„Das stimmt, du bist aufmerksam. Du musst verstehen, ich verweile schon über zweimilliardenfünfhundertdreiundachtzigmillionenvierhundertsechzigtausendneunhun dertzweiunddreißig Jahre auf dieser Welt, bin wohl der mächtigste Mann der Welt, fühle mich alt und klapperig, aber unternehme dennoch Reisen. Da kann man die Lage schon einmal nicht ganz überblicken.“
„Glaubst du, mit meinen zweimilliardenfünfhundertdreiundachtzigmillionenvierhundertneunundfünzigtausendn eunhundertzweiunddreißig Jahren geht das leichter? Allein noch den Überblick über die Strukturen der Vampirjäger zu behalten, ist schwierig. Ununoxius hat die Führung übernommen und schart seine Streiter – Grabarurach muss sich in Acht nehmen. Der Rat ist nicht mehr bereit, so viel Hilfe zu gewähren wie zuvor, denke ich.“
Als er geendet hatte, nahm Lyasudius noch einen tiefen Schluck Wein aus dem Glas, und ließ nur noch einen kleinen, roten Rest übrig, den er hin und her schwenkte. Rot, so rot wie Blut.
„Die Bande sind noch nicht gekappt“, mahnte Rhàtrônh seinen Gesprächspartner, und blickte aus dem Fenster, weil er sich zu fein war, ihn anzugucken, „Noxusiusiusisus hat einen nicht geringen Einfluss auf die geheime Organisation. Über sie ist der Plan vielleicht noch zu retten. Lediglich Exandrulus und Niklililbius können dazwischenfunken.“
Lyasudius blickte ihn erstaunt an.
„Warum sollten sie das tun?“, fragte er.
Ein Schulterzucken als Antwort.
„Ich weiß nicht... wer sind die beiden überhaupt?“
Lyasudius schluckte, und dieses eine Mal nicht seinen Wein. Die Situation war ihm unangenehm. Er kannte Rhàtrônh schon lange, wusste aber nicht, wie er reagieren würde. Dennoch überwand er sich, die Frage zu stellen, die ihm das Herz schwer machte.
„Weißt du, worum es hier eigentlich geht? Also, hast du eine Ahnung, worüber wir hier überhaupt reden?“
Zwischen den beiden entstand ein betretenes Schweigen, verlegen sahen sie beide zu Boden, drucksten herum. Dann fing Rhàtrônh endlich an, mit tiefer, belegter Stimme zu sprechen: „Nein, ich weiß es nicht. Wer soll da noch den Überblick behalten?“
„Das wissen nur die Götter... so wahr ich der Dunkle Meister bin, das wissen nur die Götter.“
„Moment mal... ICH bin der Dunkle Meister. Du vertust dich da.“
„Wieso? Ich dachte immer, ich bin der Dunkle Meister. Wie kannst du sowas behaupten?“
Lyasudius blickte sein Gegenüber wütend an, und ließ eine blutrote Nebelwolke in seiner rechten Hand erscheinen.
„Dafür wirst du büßen... hier, ich habe mein Morbus Dingsbums, und weil du ein Vampir bist, macht dich das kaputt – Zumindest glaube ich, dass das so war, ist schon so lange her, dass es erklärt wurde.“
„Ich, ein Vampir?“, fragte Rhàtrônh ungläubig und ließ ein schauriges Lachen ertönen, „ich dachte immer, du seist der Vampir!“
Er ließ ebenfalls einen Zauber blutroten Nebels auf seiner Handfläche schweben, und sah Lyasudius mit finsterer Entschlossenheit an.
„Heute soll es sich also entscheiden“, sagte er.
„Oder morgen, je nachdem, wie lange wir das rauszögern.“
Geändert von John Irenicus (02.01.2009 um 12:58 Uhr)
-
Über den Vorfall
„Es war ein wirklich faszinierendes Erlebnis, was uns jedoch sehr ungelegen kam. Die Auseinandersetzung hätte man vorausahnen können, ihren Ausgang jedoch nicht. Okay, eigentlich ist mir das jetzt scheißegal – Ich schiebe die Verantwortung einfach auf einen ominösen neuen Rat, der sich mal bilden soll.“
- Danus, Verteidiger des wahren Blödsinns
"... als Standarten eines orcischen Trupps. Deshalb bin ich zur Armee gegangen. Man sagte mir, ich könnte nie was erreichen ... ich war damals ein Schwächling, der nicht einmal ein gutes Schwert heben konnte. Und jetzt ...
Moment Mal! Was mache ich eigentlich in diesem Text hier?"
- Ajon, Leutnant irgendeiner Armee oder sowas
„Eieiei, dem hamse aber gegeben, wa? Hat ja jedenfalls ganz schön geknallt, du. Bin nur froh, dass da jetzt nich' so viel kaputt gegangen is', wär ja schade drum. Bleibt ja meist eigentlich nich' aus, wenn ma' so richtig die Fetzen fliegen, hab' da ja schon viel gesehen. Naja, damals, als das noch ging jedenfalls. Scheiß die Wand an – DAS hier hätte ich nun wirklich gerne gesehen!"
- Erich, ein ehemaliger Schaulustiger
„Hör ma'... hör mir mal zu! Du Arschloch... höhö... pass auf... wennse dich kriegen, vonne Vam... Vam... hicks... Vampyre, dann bisse fertig. DANN BISSE FERTIG MENSCH, DA KANNSE DICH DRAUF VERLASSEN! Hicks... entschullijung. Die Vampyre jedenfalls... KERL DIE VAMPYRE! Das sind ganz Gefääähährliche... Bluujtverserrer... Balutverss... Blutverzehrer sind das, ja. Oder irgendwie so... vielleicht warn das auch ganz andere... Burschen, die Vampyre, und die Blutdingens... ach komm, lassen wir den Scheiß... trink lieber noch einen mit! Trink, Freund, trink, lass die Sorgen zuhaus...“
- ein besoffener Nekromant
2 Stangen Brot
3 Laibe Käse
2 Schinkenkeulen (der billige!)
6 Flaschen Wasser
4 Flaschen Milch
1 Flasche Wein (und auch nur eine!)
3 Flaschen Wein
Salz, Pfeffer
1 Kilo Scavengerkeulen
Buch 'Falsche Gedanken'
6 Flaschen Bier
- Hannas Einkaufsliste
„Also, was ich hier noch einmal sagen will... und auch muss: Es heißt nicht 'Orc' sondern 'Ork', und auch 'Vampyre' statt 'Vampire' ist ja vor allem im deutschen Sprachraum eher unüblich, und weiß mir daher nicht zu gefallen. Aber die Atmosphäre ist gut und so."
- Ein pingeliger Autor
”Begehbar nur über eine Brücke, die kein Feind betreten kann. Gelegen hinter der natürlichen Grenze, die ein reißender Fluss zieht. Tief in den harten Fels der Insel gegraben. Eine solche Feste ist es, die den ghuradianischen Kolonisten gebührt. Niemand, bei allen Ahnen, wird dieses Herz unserer Stadt Khorinis ausheben können.
Ähm.
Das hat jetzt nicht gepasst, oder? Sorry."
- Baron Nimuel Shatim-Tanos
"Kutsche, Viersp., Vollh. Esche mass., Lederbez., neuwertig, Bj. 53, 1 Hd., abzh. b. Rosi, ehem. Sek. Hof
Preis: Ein Apfel, ein Ei"
- Anzeige im Khoriner Morgen
„Aber das Licht war eine Qual für Beliar. Und alles, was Innos erschuf, wurde von Beliar zerstört.
Adanos aber sah, dass so nichts sein konnte. Kein Licht und keine Dunkelheit.
Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Und es gelang ihm nicht.
Aber dort, wo Adanos stand, ward ein Ort, an dem Innos und Beliar keine Macht hatten.
Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos zugleich. Und so ward das Meer erschaffen.“
- Vatras, arbeitsloser Prediger
„Vatras, halt die Klappe. Das hat nichts mit dem Thema zu tun.“
- Saturas, ein erboster Wassermagier
„Ich mag keine Sümpfe.“
- Miguel, eine Moorleiche
„Würde jetzt vielleicht jemand etwas Vernünftiges zum Thema beitragen?“
- Fiur, ein namensgeplagter Feuermagier
„Nein. Ich habe jetzt keine Zeit.“
- Xardas, im Urlaub
Geändert von John Irenicus (05.01.2009 um 13:51 Uhr)
-
„Das Leben kann manchmal echt schwer sein“, seufzte Jaqueline und fuhr sich mit ihrer zarten Hand energisch durch das dichte, blonde Haar, während sie fröhlich auf das große Gebäude zuhüpfte. Dann aber machte sie eine Pause, sie hatte ja nun schon immerhin rein gar nichts in ihrem Leben erreicht und durfte einen Moment lang stolz darauf sein.
Sie musste jetzt einfach ihre pink lackierten Fingernägel betrachten. Sie hatte den Nagellack bei ihrem Lieblingshändler erworben und beim Kauf ständig innerlich von seiner Attraktivität geschwärmt. Statt bei eigentlich passender Gelegenheit auf offener Straße sein bestes Stück in sich aufzunehmen hatte sie aber wegen irgendeiner Nichtigkeit herumgezickt. Das Problem war, dass der Händler adelig war – wie irgendwie jeder adelig und aus gutem Hause und von hohem Stand war, selbst der einfachste Bauerntrottel. Manchmal glaubte Jaqueline, das sei nur so, damit sie sich noch effektvoller irgendwelchen abgehobenen, gepuderten Typen um den Hals schmeißen konnte um damit ihr eigenes Ansehen aufzubessern und später mal im Licht eines Kronleuchters ihre frisch lackierten Fingernägel und blondierten Haare begutachten zu können. Bis dahin war es zwar noch ein weiter, beschwerlicher Weg, aber sie würde es ganz bestimmt schaffen, denn wenn sie von etwas überzeugt war, dann waren das in erster Linie sie selbst und ihre Haare.
Nun stand sie also vor dem Anwesen von Jean-Luc von und zu und unter Aladassia, dem Sohn des Grafen irgendeiner weithergeholten Provinz, die auf jeden Fall – oder zumindest höchstwahrscheinlich – jede Menge grenzenlosen Reichtum, exotisches Flair und gestelzte Liebesbekundungen bot. Vermutlich tanzten dort täglich dreißig leicht bekleidete Damen verschiedener Haarfarben um den Oberherrscher herum, damit seine Geliebte möglichst eifersüchtig wurde und ein Geflecht vom stechendem Schmerz in allen Herzen entstand. Der dann von einer neuen Charge teuren Weins wieder weggespült werden konnte.
Jedenfalls war eben dieser Jean-Luc genau der Händler gewesen, den sie heute Mittag versetzt hatte. Jetzt musste er ja wieder zu Hause sein, mehr als eine Stunde Arbeit konnte selbst so ein gut gebauter Mann nicht aushalten. Nicht auszudenken, mal mit derartigen Dingen beschäftigt zu sein. Der dunkelhaarige Jean-Luc war und blieb eben von Beruf Sohn, und fiel deshalb genau in Jaquelines Beuteschema des hochnäsigen Privatiers mit Hang zum Blödsinn schwafeln.
Vorsichtig klopfte Jaqueline an die prunkvolle Tür der Villa am Stadtrand von Aladassia. Sie brauchte gar nicht lange zu warten, da öffnete ihr ein alter, weißhaariger Herr in einem förmlichen schwarzen Gewand die Türe. Obwohl er geschätzte 190 Jahre alt war, strahlte er doch eine gewisse Anziehungskraft auf Jaqueline aus, die ihren Blick nicht von seinen attraktiv verschrumpelten Handrücken lösen konnte.
„Ah, My-mimimi-lady Jaqueline, Eure Ankunft wurde natürlich bereits erwartet. Tretet doch ein. Bei eurer Bekleidung sollt Ihr nicht so lange draußen verweilen müssen.“
Jaqueline spürte den Blick des edlen Herrn auf ihrer Kleidung, die zu einem Großteil aus einem Hauch von Nichts bestand. Es gefiel ihr, so von ihm gemustert zu werden. Sie stellte sich vor, wie es wäre, beim Sex mit ihm seine dritten Zähne halten zu dürfen.
Ihre Aufmerksamkeit wurde nun auf die Eingangshalle der Villa gelenkt, prompt war alles andere vergessen. Jeder noch so kleine Winkel des mit weißem Marmor gefliesten Bodens war mit teuren, weinroten Teppichen aus feinsten Stoffen bedeckt worden, was den weißen Marmor zwar eigentlich nur versteckte, aber so einen Feinsinn für Verschwendertum ausstrahlte, dass Jaquelines Atem augenblicklich schneller wurde. All die goldenen Rahmen an den prunkvollen Wänden, die Bilder enthielten, die für sie aber nebensächlich waren. All die Kronleuchter, die von der Decke herab hingen, und der Kamin an der gegenüberliegenden Wand, die aufgrund der Weite der Halle einige Schritte entfernt war: Genau so und nicht anders hatte sie sich es vorgestellt. Dieses Anwesen versprach Geld, Ruhm und plötzlichen Hirntod. Alles, was sie sich immer gewünscht hatte!
Ihre Augen glitzerten vor Freude erfüllt und sie befand sich in einer Art Rausch, aus dem sie erst wieder zur Besinnung gelangte, als sie die Hand des alten Bediensteten an ihrer nackten Schulter spürte. Die Berührung von Haut auf Haut ließ sie erschaudern, so musste sich eine Leiche anfühlen – Trotzdem machte sie die Situation natürlich unglaublich an.
„Nehmt auf diesem weißen Sofa dort Platz, der Herr wird sich bald um euch kümmern, Mylady Jaqueline-Chantal“, röchelte der in beerdigungskonformer Kleidung steckende Mann anregend und wies auf das leicht cremefarbene Möbelstück an der Wand. Dann verbeugte er sich tief, und nachdem sein Hüftgelenk dreimal geknackt hatte, schwebte er wieder dahin, wo er hergekommen war.
Wo auch immer das war, Jaqueline hatte es gar nicht mitbekommen. Wie von fremder Hand geführt bewegte sie sich auf das Sofa zu, dass wirklich ein absoluter Klassiker war. Normalerweise war es irgendein dunkelhaariger Adeliger aus dritter Inzestgeneration, der auf einer dieser komfortablen, weißen Sitzgelegenheit Platz nahm, während sie vor ihm kniete und den Mund wie so oft ein wenig zu voll nahm, um ein paar unwesentliche Ansehenspunkte zu sammeln, die sie in ihrem Lebensstil bestätigen konnten. Ja, das Leben konnte manchmal echt schwer sein.
Nun war sie es aber, die auf diesem Sofa saß und das Panorama des Raumes in vollen Zügen genießen konnte. Ab und zu musste sie aufgrund von akuter Hitzewallungen – vermutlich wegen Überanstrengung, was hatte sie heute nicht schon alles erlebt – zu dem Fächer greifen, den sie stets bei sich trug. Das Wedeln wurde ihr aber derweil auch zu anstrengend, weshalb sie sich umso leichter im Kopf fühlte und im Halbschlaf ein wenig zu träumen begann.
Vor ihrem geistigen Auge tauchten langsam Bilder auf, wie sie in einer Stadt irgendwohin ging. Zu Zeiten, als sie sich noch dazu herabgelassen hatte, mehr als fünzig Schritte am Stück zu gehen. Sie war nun schlauer, denn ihre Erinnerung führte ihr grausam vor, was sie durch sinnlose Ertüchtigung erleben musste. Sie fühlte genau nach, wie es damals gewesen war, als gerade einmal zwei Schrittlängen von ihr ein Mann vorbeigegangen war, der doch tatsächlich mindestens zweieinviertel Gramm Übergewicht hatte, seine Zähne offensichtlich noch zum Essen benutzte und keine quietschbunte Kleidung aus Seide trug – Schaudernd erinnerte sie sich, wie sie damals an einem Nichts, einem Niemand vorbeigehen musste! Ein einfacher Mann, kein Adeliger! Sie hatte sich damals dafür einsetzen wollen, solche Leute aufzuknüpfen um die Stadt von derartigen Abschaum zu befreien und hatte mit führenden, filzbärtigen und schwarzhaarigen Bürohengsten geschlafen um so eine Entscheidung durchzudrücken, doch offenbar war ihr Engagement nicht ausreichend gewesen.
Das tiefe Gefühl des Frusts ließ sie aufschrecken. Nicht einmal das wilde Herumfummeln in ihren Haaren konnte sie beruhigen, das Grauen von damals saß einfach zu tief in ihr. Wie lange war sie in Erinnerungen versunken gewesen? Warum hatte man sie noch nicht hier abgeholt? Wie konnte man es wagen, eine Dame von Welt einfach so sitzen zu lassen?
Gerade als sie dabei war, vor Enttäuschung ihre Unterlippe kaputt zu beißen, kam ihr ein Gedanke. Er kam so unbemerkt, dass ihr der Seltensheitwert dieser Situation gar entging, denn sie war dabei, einen Entschluss zu fassen. Sie würde ihr Leben selbst in die Hand nehmen, sie brauchte niemanden! Sie vergrub noch einmal ihre spindeldünnen Finger in ihren Haaren, dann stand sie auf. Jetzt würde sie einfach alleine die Treppe neben ihr hochgehen um Jean-Luc zu suchen!
Wenige Augenblicke später spürte sie, wie die Stufen des Weges ihr schmerzlich den Atem raubten – wie damals, als sie sich von dem Wolfshund der Schwippschwägerin des Gatten der Baronin von Hintertupfingen die schlabberige Zunge in den Rachen hatte schieben lassen, um einmal am Donnerbalken der hohen Gesellschaft lecken zu dürfen, um die Wette mit dem besoffenen Hausmeister des Anwesens um 10 Goldmünzen gewinnen zu können. Es war einer ihrer härtesten verdienten Erfolge gewesen, doch sie hatte sich durchgekämpft. Seitdem hatte sie für alle anderen Menschen, die ihr Geld mit Arbeit verdienten, nichts als Spott und Verachtung übrig.
Als sie oben auf der Galerie angekommen war, hörte sie aus dem Zimmer auf der linken Seite des breiten Flures rechts von ihr eine Frauenstimme singen.
Ich seh in dein Herz,
sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten
Ein Leben das neu – beeegiiiiiinnt...
Vermutlich war sie brünett.
Jetzt war es passiert, es war alles so passiert, wie Jaqueline es vermutet hatte. Eine Nebenbuhlerin! Es musste so sein, und so stürmte sie in den Raum aus dem der Gesang kam, und fand tatsächlich eine brünette Frau mittleren Alters vor, die selbstredend attraktiv war, was Jaqueline sich allerdings nicht eingestehen wollte, feinste Kleider trug und dem Adel angehörte. Für normale, einfache Leute war in dieser Welt glücklicherweise kein Platz – Sollten sie doch alle verrecken.
Die haselnussbraunen Augen der fremden Frau starrten in einen Spiegel, vor dem sie ihre lockigen Haare kämmte und immer und immer wieder dieses Lied sang, aber abbrach, als sie Jaqueline entdeckte.
„Iiiiiih, wer seid Ihr und was macht Ihr hier? Ich hoffe, Ihr habt einen Grund hier so aufzukreuzen, ansonsten lasse ich Euch selbstredend entfernen.“
Ihre verschnupfte Stimme weckte alle möglichen Assoziationen in Jaqueline, von denen sich Geld, Sex und Haare jedoch erfolgreich in den Vordergrund drängten.
„Das ist ja wohl eine Unverschämtheit, mich so anzusprechen“, schnaubte Jaqueline verletzt zurück, und fügte nicht ohne Stolz hinzu: „Ich bin Jaqueline-Chantal von und zu Varania, Bückstück für berühmte und vor allem reiche Adelige dieser Gegenden und daher selbst von hohem Stand, und NIEMAND wagt es, mich einfach so anzusprechen. Und ich habe dichtes, blondes Haar! Wo ist Jean-Luc?“
„Ich bin eine lockige Brünette und habe bereits vergessen, mit wem ich schon alles geschlafen habe, nachdem ich als Putzfrau von drei Orks vergewaltigt und verprügelt wurde, aber das irgendwie doch so genossen habe dass ich mir eine neue Identität und eine neue Haarfarbe zu gelegt habe. Was wollt Ihr von Jean-Luc?“
„Ätsch, sag ich dir nicht“, erwiderte Jaqueline und fand sich unglaublich souverän dabei, wie sie ihre dürren Ärmchen vor ihrer Brust verschränkte, von dieser Idee aber bald wieder abließ, da sie so viel zu viel ihrer Haut verdeckte.
Die lockige Brünette, die Jaqueline bisher nur im Spiegel beobachtet hatte, drehte sich jetzt erstmals zu ihr um.
„Wie oft hast du schon mit ihm geschlafen, du Miststück?“, kreischte sie, und wäre sie in dieser Situation nicht ihre Konkurrentin gewesen, wäre Jaqueline von dieser hysterischen Reaktion beeindruckt gewesen. Das war eine ihrer vielen Fähigkeiten, an der sie noch feilen musste.
„Das wird erst noch kommen, du falsche Schlange!“, erwiderte sie, „an dir kann Jean-Luc doch gar kein Interesse mehr haben! Sieh dich doch einmal an! Selbst wenn alle Leute hier naturgemäß attraktiv sind damit sie sich durch die gesamte Stadtpopulation bumsen können – Du hast Falten, meine Liebe! Falten!“
„Fa-Falten?“, kreischte sie jetzt wieder und versuchte hektisch, ihr Gesicht zu straffen, indem sie ihre zentimeterlangen Fingernägel in ihre Wangen grub und daran herumzog.
Da das nichts brachte, setzte sie zu einem gefährlichen Konter an, der Jaqueline beinahe ins Taumeln brachte.
„Aber deine Haare gehen dir nur bis zur Arschritze, wie erbärmlich!“
„WAAAS?“, war die schockierte Antwort, und Jaqueline wusste, dass sie das nicht auf sich sitzen lassen konnte.
In einem dramatischen Akt der Aggression versuchte sie, ihrer Konkurrentin eine Ohrfeige zu verpassen, bemerkte aber dann, dass sie gar nicht wusste, wie so etwas geht. Bislang hatte sie für solche Aktionen einfach Hofdiener beauftragt, die dies gegen einen kleinen Blick auf Jaquelines abgegriffene Brüste als Belohnung stets gewissenhaft erledigten. Abschaum waren sie trotzdem.
So also schlug die Blondine daneben und erwischte die Kommode, ein kleines Knacksen verriet sofort, was passiert war.
„Ich habe mir einen Fingernagel abgebrochen!“, rief sie, wälzte sich dann noch ein wenig weiter in Klischees von Zickenkriegen und weinerlichen kleinen Mädchen und lief schlussendlich aus dem Anwesen heraus. Sie sah Jean-Luc nie wieder und musste sich nun andere Adelige zum Hochschlafen suchen.
Das Leben war wieder ein Stück schwerer geworden, doch Jaqueline wusste, sie würde auch mit so einem Schicksalschlag fertig werden. Selbst sie, die so gezeichnet vom Leben und seinen Leiden war, wusste noch aufrecht zu stehen und konnte nur über die kriegsversehrten, bettelnden Veteranen auf den Straßen lachen, die ja gar nicht wussten, wie hart das Leben wirklich war.
Während sie auf dem Weg zum nächsten großen Anwesen einem solchen niederen Menschen begegnete und ihm ins Gesicht spuckte, dabei gleichzeitig in Gedanken von dunkelhaarigen wie blonden Fürsten schwärmte und sich mit ihren Händen endgültig in ihren blonden Haaren verfing, obwohl ihr neuer knallroter Nagellack noch nicht getrocknet war und sich nun in den Strähnen verteilte, summte sie dieses Lied...
Ich seh in dein Herz,
sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten
Ein Leben das neu – beeegiiiiiinnt...
Jaqueline begann wieder zu hüpfen. Sie war doch einfach unschlagbar und würde nie aufhören, zu kämpfen. Sie war etwas wert. Sie war eine Heldin.
Geändert von John Irenicus (22.09.2010 um 14:52 Uhr)
-
Es begab sich an einem schönen Morgen im Königreich Afterflor, dass Prinz August von und zu Nierenstein auf Schloss Bumms die Nüsse klappern ließ und sich mit Vergnügen am Körper seiner Cousine Alabasta von Tütenhausen labte.
Schon sein Onkel Frohgemuth von Scheffelsberg pflegte den täglichen Genuss der engen Öffnungen seiner entfernten Verwandten und erfreute sich an dem kollektiven Inzest, der in seinem eigenen Prunkschloss herrschte, bis er nach Jahren der Erfüllung unglücklicherweise einen tragischen Unfall beim morgendlichen Broteschmieren hatte und verstarb. Noch bevor der Arzt eingetroffen war, hatte seine Gattin Ingrida van Bahlenbergen in heldenhafter Tugend das Messer, welches sie nach ihm geworfen hatte, aus seinem Rücken entfernt und die Wunde so präpariert, dass der angerufene und justamente eingetroffene, besagte Arzt, der im ganzen Lande und auch über dessen Grenzen hinaus als Professor Doktor Doktor Wahnfried von und zu Tüdelingen bekannt war, ruhigen Gewissens auf seinem medicalen Formular das vorgesehene Kästchen für den Fall eines natürlichen Todes in Form des Kreuzchenmachens in Anspruch nehmen konnte, um sich somit jede Menge Papierkram und den Besuch eines Mordsachverständigen sparen zu können.
Ingrida van Bahlenbergen organisierte eine Bestattung mit viel Brimborium und großem „Vivat“, was zeitgenössische Humoristen wie Olemis van der Jauchegrube oder den wohlbekannten Martinus op Kölsch (Jahre später noch sprach Ingrida von ihm als einen zwar attraktiven und von reichhaltigem Verstande gesegneten, aber doch unnötig gehässigen und überheblichen Krätzchensänger) auf den Plan rief, ihrerseits Spottschriften über den Todesfall und den unangemessenen, ja in seiner Natur selbst schon ironischen angehauchten, Tamtam um den Tode Frohgemuths von Scheffelsberg zu verhöhnen.
Die Trauer von Alabasta von Tütenhausen jedenfalls hielt sich in Grenzen. Auf dem zügellosen Festbankette, auf dem selbst der sonst so zurückhaltende Küster Schwengelbald von Lattenheim seine Sekrete bei wilder Orgie ins Dessert abließ, begegneten sich Alabasta und August zum ersten Mal in intimer Atmosphäre in dem mit Haltegriffen gesegneten Seniorenwaschraum des Festsaals, nachdem sie den lauernden Stadtgreis Jakobius Stielaug von dort des Feldes verwiesen hatten. Schon bald waren die zarten Bande zwischen den beiden stärker und inniger geworden, bis sie sich zu jenem Verhältnis entwickelten, was wir nun heute, Jahre später auf Schloss Bumms vor uns vorfinden.
„Ich mag es, wenn Du beim Liebesspiel ein wenig unleidlich bist, verehrteste Alabasta“, hauchte August, als sie geendet hatten.
„Dein primäres Geschlechtsorgan ist in seiner Fülle leider mehr als deckungsgleich mit meiner Öffnung, so entsteht diese gewisse Enge, die Dir wohl ganz recht zu sein scheint und Dir angenehm anmutet.“
„Ja“, lächelte August, „außerdem sieht Dein Intimbereich aus wie ein verwesender Goblin – und er riecht auch so.“
August meinte dies natürlich als eine Art Anspielung auf das berühmte Zitat von König Majestät Fürchtegott Hallelujah XVI., der seines Zeichens ein begeisterter wie talentierter Orgelspieler war und sich für einige Sinfonien, aber auch vortreffliche Arien mit Orgeluntermalung verantwortlich zeichnete. Sein Glanzstück allerdings komponierte er eines Nachmittags im Kopf, als er seine Haushälterin vergewaltigte, weil dieses niedere Bauernpack nicht so spurte wie er als Adeliger es wünschte. So erschuf er sein Opus Nr. 147, heutzutage in erlesenen Kreisen bekannt als Hallelujah-Werke-Verzeichnis HWV Nr. 1102 „Wut über die um Hilfe schreiende Bauernhaushälterin die im Intimbereich aussieht und riecht wie ein verwesenender Goblin“, ein Orgelquartett mit vielen Glissandi, Forte-Passagen und Accelerandi in den Tonarten A, B, C, D und X-Moll, unterstützt in den Bassläufen durch einen Stimmentausch im zweiten Satz par Phrygisch-F und Lokrisch-E, dann mit einem H-mixolydischen Kontrapunkt versehen und durch einen Spiegelkrebs gekreuzt.
Lieber Leser, liebe Leserin, liebe Leserinnen und Leser, meine Damen und Herren, liebe N... – die geneigten dieser Gattung respektive Gattungen vermögen nun natürlich ihre Hirnströme anzustrengen um zu erdenken, wie es denn wohl weiter gehen mag. Das kann ich jedenfalls gerade nicht sagen, denn ich habe vor einigen Minuten schon komplett den Faden verloren, sabbere und brabbele nur noch vor mich hin und weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Mein Urgroßvater mütterlicherseits pflegte in solchen Situationen – natürlich stets mit einer Tasse Tee mit Grundstoff von Blättern aus Ersternte, die in ganz Myrtana Ruhm genossen und selbst für Könige und Kaiser, nämlichen Herrschern des ganzen Reiches der Menschen seit Urzeiten, die für viele Historiker an die Randgebiete ihres Wissens und selbst ihrer Archive zu drängen vermögen, und ich sage es schmeckt.
Betrachten wir nun, was weiter zwischen Prinz August von und zu Nierenstein und seiner ehrenwerten, anmutigen Cousine Alabasta von Tütenhausen auf Schloss Bumms geschieht.
„August, warum sagst Du nur so etwas?“, empörte sich Alabasta, die ihres Zeichens zwar aus gutem Hause kam, jedoch trotzdem nie in den Genuss einer fundierten musikalischen Ausbildung gekommen war und zwar wohl Majestät Fürchtegott Hallelujah kannte, den großen König jedoch nicht in die breite Komponistenriege des Reichs einzuordnen wusste.
August höchstselbst jedenfalls war so überrascht, dass ihm nachgerade die Worte fehlten, die nämliche Entschuldigung für eine Beleidigung, die doch gar keine gewesen war.
Wie Alabasta keine Antwort vernahm, steigerte sich ihre Empörung in ein unleidliches Maß, dass selbst August zu viel war, denn seine Cousine hüpfte nackt wie sie war vom Bett und verbreitete mit ihrer Stimme Unannehmlichkeiten, die einer Gemütlichkeit wie von ihrem Cousin bevorzugt keineswegs angemessen waren.
Mein Lieber Leser, Du als aufmerksamer Verfolger dieser Geschichte magst folgenden, evidenten Schluss aus Alabastas Reaktion ziehen und die Empirie beglaubigen lassen: Sie war verstimmt.
Gerade als ihr Gekreisch abebbte, sprang aus dem Eichenschranke ihr gegenüber ein unbekleideter Mann heraus, dessen Ausdruck sowohl im Gesicht als auch im Schritt offenbaren ließ, dass er ins Geschehen tatkräftig eingreifen wollte.
„Ferdinand von Donnerbalken!“, brach es aus August hervor, der den auftauchenden Mann nicht nur an seinen Augen, sondern auch an seinem Gemächt erkannte.
Dem Adelsgeschlechte Donnerbalken war seit jeher eine gewisse Einfältigkeite nachgesagt worden, doch trotzdem konnte Vater Gerowitz seinem Sohnemanne Ferdinande mittels vieler großzügiger Spenden genug Sympathien in demselben angesehenen Internate verschaffen, indem auch Auguste seine Jugende verbrachte, was Ferdinande dann einen dortigen Platze sicherte.
So kamen Ferdinand und August recht früh in Berührung, und dies, lieber Leser, sei durchaus wörtlich zu verstehen, denn die beiden Heranwachsenden hatten unziemlich schnell eine Vorliebe für die gegenseitige Erkundung ihrer Körper gefunden, ein Umstand, der auch dem Internatsleiter Jörgenfried Taussback breites Gefallen verschaffte.
Somit, lieber Leser, sei Augusts scharfes Auge auf die Bestückung Ferdinands und die rasche Identifikation desselben ausreichend erläutert.
„Hat er Dir was getan, Alabasta?“, fragte Ferdinand die nackte Schönheit vor ihm und ging auf sie zu um sie zu schützen.
„Er hat mich beleidigt, Ferdinand!“, ließ sie verlauten und suchte Trost an Ferdinands starkem Körper um sich selbst zu saturieren.
„Alles klar“, befand Ferdinand erschreckend einfach und für Augusts Verhältnisse unverschämt unkompliziert, „August, ich fordere Dich zum Duell!“
„Duell?“, fragte der Prinz entgeistert, „Du bist in Schloss Bumms eingedrungen und forderst MICH zum Duell? Raus hier! Alabasta gehört mir!“
„Eingedrungen?“, entgegnete Ferdinand lachend, „fürwahr, das ist der Fall. Nicht nur in Schloss Bumms, sondern auch in Alabasta höchstselbst! Du Schmock bringst es doch schon lange nicht mehr! Alabasta gehört mir!“
„Nein mir!“
„Mir!“
„MIR!“
Es begab sich, dass Alabasta sich endlich wieder einschaltete. Elegant und voller Anmut stolzierte sie zurück zum Bett und ließ sich auf die dreihundert großen, weichen Kissen sinken.
„Ich gehöre keinem. Aber los, kämpft um mich!“
August war schon zum Bücherregal gerannt um sich mit den gesammelten Werken des Staatsphilosophen Himmelbert von Pfanneheiß zu bewaffnen, doch Ferdinand grinste nur.
„Merkste was?“, fragte er und gab keine Zeit zu einer Antwort, „wir sprechen schon gar nicht mehr gestelzt genug, und ein Kampf ist leider a priori spannend – das ist sogar empirisch bewiesen, schätze ich. Das müssen wir verhindern!“
„Und jetzt?“
August machte einen verwirrten Eindruck.
„Jetzt würde ich mich normalerweise in einen riesigen, spielbegeisterten und humorvollen Drachen verwandeln und dich irgendwie platt machen – du hättest keine Chance. Da mein Volumen allerdings den Raum sprengen würde, möchte ich dich um Schloss Bumms willen bitten, einfach zu gehen. Ist ja schließlich deine Bude hier und ich möchte nichts kaputt machen. Dann kann das hier alles in der obligatorischen Knatterszene enden und alle sind zufrieden.“
Augusts Miene hellte sich auf – er hatte die Worte seines Rivalen vernommen und eingesehen, dass er a priori empiristisch und deduktiv wie induktiv keine Schnitte gegen Ferdinand von Donnerbalken hatte.
„So machen wir's – fick sie hart!“, sprach er noch zum Abschluss und fühlte sich durch so unkomplizierte Worte innerlich befreit, als er aus dem Schlafgemach heraustrat und selbiges auf diese Weise verließ.
Nachbemerkung (Menschen mit Narkolepsie ist das Lesen NICHT zu empfehlen):
Prinz August von und zu Nierenstein taucht auch auf in den Werken „Fummelei auf Falkenstein“ und „Abhandlung über die numerische Benennung des royalen Geleges“, sowie dem Klassiker „Auf Schloss Bumms klappern die Nüsse“, wo auch Alabasta von Tütenhausen eine der Hauptpersonen ist.
Frohgemuth von Scheffelsberg ist Autor des Episodenromans „Die 31 Wochen von Gomorrah“, zu dem Schwengelbald von Lattenheim das Vorwort verfasste. Letzterer kommt außerdem in der Novelle „Kleider sind überflüssig“ vor.
Ingrida van Bahlenbergen sitzt momentan leider im Knast weil sie ihren neuen Ehegatten ermordet hat, sie kommt allerdings auch im Medienspektakel „Camp in Jharkendar“ vor.
Professor Doktor Doktor Wahnfried von und zu Tüdelingen ist Protagonist in der Erzählung „Guru Tshabalala“ und lebt dort seine Heroinsucht offen aus – an seinen Patienten. Er hat auch einen Enkel – Gereon von und zu Tüdelingen – dessen Karriereweg jedenfalls ausschnittsweise in „Eine Geschichte über die Erkenntnis, dass derjenige, der mahlt, früher oder später selbst gemahlen wird“ nachgezeichnet wird.
Weite Informationen zum Schaffen von König Fürchtegott Hallelujah XVI. finden sich in „Die Grammatik des mittleren Westens“, „Empirische Analyse der musikalischen Ausarbeitung eines Magenwind der nicht den Weg zum Hintern find“ und „Mein Dienstmädchen und ich – Sexgeschichten die keiner hören will“.
Die Figur Martinus op Kölsch ist frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Olemis van der Jauchegrube ist Nebenperson in „Einfaches Leben – Nase zu und reinspringen“ und taucht dort nicht nur auf, sondern auch öfters mal ab.
Die Bahn nach Düsseldorf fährt um 12:40 Uhr ab, man muss einmal in Hagen umsteigen.
Jakobius Stielaug ist Hauptperson im Volksstück „Gruppensex im Altersheim – Der Friedhof hat heute Ausflug“.
Pater Lahache kommt in „Irrelevanzen“ und „Omnipotenz“ vor.
Geschichten mit Gerowitz von Donnerbalken müssen erst noch geschrieben werden.
Ferdinand von Donnerbalkens Penis ist nach eigenen Angaben 25 Zentimeter lang, allerdings hat sich noch nie jemand getraut, nachzumessen.
Das Verhältnis zwischen Gerowitz und Ferdinand ist im Gedicht „Wie der Vater, so der Sohn“ aufgearbeitet.
Mehr von Himmelbert von Pfanneheiß gibt es in „Auszug 3: Über die ökonomische Analyse der neoliberalen Staatspolitik des 11. Jahrhunderts“, „Abhandlung über die kirchlichen Traditionen und Riten des Volks der Urkhmer“, „Mama hat gesagt...“ und „Die beste Möglichkeit zu zitieren ist das Zitat – wie uns eine mittelmäßige Philosophenelite zugrunde richtet“. Himmelbert von Pfanneheiß' Verstand wurde bis heute nicht gefunden. Er selbst kommt auch in „Irrelevanzen“ vor.
Jörgenfried Taussback ist ein Idiot.
...keuch.
Geändert von John Irenicus (31.07.2019 um 17:53 Uhr)
-
Jeffrey hatte es sich leichter vorgestellt. In seiner Fantasie war es immer leichter. Warum konnte sein Roman nicht einfach genommen werden? Sicherlich war es eine statistische Notwendigkeit. Ja, das musste es sein. Sein wissenschaftlicher Mitarbeiter Bartholomew hatte es ihm erklärt: Geisteswissenschaftler wurden wegen ihrer überragenden Schlüsselqualifikationen gesperrt, die Quoten für den anderen Pöbel mussten erst einmal erfüllt werden. Wie in einem gedoppelten Reißverschlussverfahren, bei dem die langsame rechte Spur stets den Vorzug genoss. War es anderen Jacke wie Hose, so ging bei Jeffrey der Reißverschluss einfach nicht richtig zu, bis der Kragen platzte. Er fühlte sich wie ein Sprinter, der kurz vor der Ziellinie erst einmal auf die Letzten im Rennen warten musste, bis er endlich Erfolg haben durfte.
Plötzlich fühlte es sich an, als würde sein Hals von innen mit einem Messer bearbeitet, wie ein Kamm, der sich durch verfilztes Haar kämpfte, um es wieder seidig zu machen.
„Ich muss wohl einfach mehr reden“, röchelte Jeffrey sich selbst zu, gleich einem Auto mit Motorschaden, „diese langen Schweigephasen sind einfach nichts für mich. Es muss geredet werden!“
Emy hätte dafür gesorgt, doch sie hätte ihn auch ermahnt, wegen der Bücher, die er unter dem Arm trug. Das machte er, damit er intellektueller wirkte. Präsenter. Ein Rennfahrer der Dreißiger Jahre, der auch nach dem Rennen noch seine große Brille um den Hals trug. Immer im Einsatz.
Emy war aber nicht hier, sie saß vermutlich zu Hause und hämmerte vor Blödheit beständig ihren Kopf vor die Wand, bis sie umfiel und liegen blieb wie eine senile Schildkröte auf ihrem Rückenpanzer. Frauen waren ja so doof. Vor allem, wenn sie nicht einmal studiert hatten.
„Reden, reden!!“, keuchte Jeffrey und ergab sich einfach seinem Hustenanfall. Frische Luft gepaart mit den wie Planeten kreisenden Staubpartikeln aus seinen Büchern gaben ihm einfach den Rest, weshalb er nach kurzer Zeit einen Schwall schleimiger Bröckchen aus seinem Mund entließ. Wie sie sich auf das raue Pflasterstein des Verlagsviertels von Vengard verteilten, erinnerten sie Jeffrey an die Marmeladenbrötchen in die Emy morgens immer hineinspuckte, weil sie in einer Frauenzeitschrift gelesen hatte, dass das gesund sei. Sie war so herrlich blöd. Eigentlich war es unter Jeffreys Würde, mit einer Frau der Unterschicht zusammen zu sein, es war so, als würde Papst Innostian III. eine Provinznonne heiraten. Doch es ging ihm einfach einer dabei ab, sich in ihrer Abwesenheit in Verachtung für sie zu suhlen wie ein myrtanisches Mastschwein kurz vor der zwölften Mahlzeit am Tag.
„Hallo, hallo, Sie da?“
Jeffrey hatte seine Chance gesehen und ergriff sie. Er war ein erfahrener Bergsteiger, der das rettende Sicherungsseil kurz vorm Absturz noch zu packen bekam.
Der Mann, den er angesprochen hatte, entpuppte sich als Frau. Aber die Raupe wurde nicht zum Schmetterling.
Vor ihm stand eine große, kräftige, nur ansatzweise weibliche Gestalt mit langen blonden Haaren und grunzte ihn fragend an.
Hauptsache reden.
„Wie heißen Sie?“
„Ich heiße Marushka“, blaffte sie ihn an und verzog das Gesicht als hätte sie in eine, nein, in einen ganzen Sack voller Zitronen gebissen. Es passte, denn ihre Körperform glich der Form eines Apfels. Marushka war sicher keine Oase, keine Plantage inmitten der Wüste, doch für einen abgelaufenen Obstsalat reichte es gerade noch. Oder das aufgequollene Salatblatt auf dem Boden des Supermarkts, auf dem man ausrutschte und sich dadurch sämtliche Knochen brach. Wie eine Packung Salzstangen, die von einem rollenden Bürostuhl überfahren wurde, zermalmt wie von einem Panzer, der einen Baum umnietete, der seinerseits einem Hochhaus glich, dass durch ein Erdbeben...
„Biste plötzlich stumm geworden? Was willste denn jetzt?“
„Ich... ich wollte nur reden.“
Jeffreys zuvor messerversehrter Hals hatte sich nun in die weite Wüste Varants verwandelt. Er war ein guter Geograph, doch jetzt hatte er sich verlaufen. Der Wandersmann ohne Chance auf Einkehr.
„Dann such dir 'ne andere, du Streberleiche“, röhrte Marushka und stampfte davon.
„Och“, machte Jeffrey und klang dabei wie die große Ledercouch zu Hause im Wohnzimmer, wenn Emy mal wieder Stühle auf ihr stapele, um den größten Turm der Welt zu bauen. Jeffrey sah darin manchmal den Turmbau zu Babel, nur dass die Sprachverwirrung schon vorher eingesetzt hatte, ja ursächlich für den architektonischen Meisterakt war. Kommunikation war wie der Tanz zweier Sterne im ewigen Nebel des Weltalls. Für Jeffrey fehlte die Raumstation.
Er sah in die Ferne, gleich einem Späher der ausgesandt wurde, um unbekanntes Gebiet zu erkunden, dabei aber sein Fernrohr im Lager gelassen hatte. Ein Fahrradfahrer mit nur einem Pedal, ein Soldat mit zu wenig Munition. Es ging auch so.
Das Verlagsviertel Vengards. Eines der spießigsten Viertel der Stadt und dasjenige, welches eigentlich nur noch besucht wurde, weil an dessen Rande die besten Kneipen des Reichs ihren Sitz hatten. Jeffrey selbstverständlich mied sie wie der Teufel das Weihwasser, es war nicht alles Gold was glänzte und Morgenstund hat Gold im Mund. Die vermodertsten Häuser, die vermodertsten Ideen. Nun, vielleicht war die Polemik unangebracht. Jeffrey verspürte den Drang, lieber wieder gedanklich über seine schwachsinnige, unakademische Freundin herzuziehen und dabei ordentlich abzuhusten, um den Staub seiner imaginären Phantom-Arbeiterlunge gen Himmel zu schleudern. Irgendwer musste es ja schließlich bekommen. Er war der gute Samariter unter den Asthmatikern, der Sankt Martin der gebildeten Schwachen. Brauchte jemand seinen Mantel, nahm er den seinen ab und hustete dem Bittsteller mitten ins Gesicht, bevor er würgend weiter ritt. Der Kampf gegen die Windmühlen? Rosinante war seine Lilith und Emy war Eva. Doch Kain und Abel sprachen nicht. Wie Marmorstatuen im Museum der Gedanken, längst verstaubt und vergessen, doch solide wie am ersten Tag. Unverrückbar wie ein festgeschweißter Nagel im Panic Room um das Bild des röhrenden Hirsches aufzuhängen.
Nur wenige wirklich hohe Häuser waren in Vengard konstruiert worden. Außerhalb der Altstadt wurde der Boden sandig und weich. Schwierig für Wolkenkratzer, aber Geld war immer schon ein guter Baustoff gewesen.
Das waren Jeffreys Gedanken, als er das große Multikonzern-Verlagsbebäude betrat. Er fühlte sich wie das Lamm auf dem Weg in die Höhle des Löwen, der schon einmal seinen alten Kumpel Wolf eingeladen hatte. All you can eat.
Er versuchte diese Vorstellung abzuschütteln wie ein Hund das Wasser aus seinem nassen, stinkenden Fell. Diesmal musste es einfach klappen...
Schritte näherten sich. Kurze, unregelmäßige, als fehlte der dazugehörigen Person jede Ruhe. Ein zaghaftes Klopfen, das Knarren einer schweren Tür. Dann ein Aufschrei.
„Mein Lord!“
„Komm näher. Habe keine Angst.“
Es wäre ebenso sinnvoll gewesen, eine Vengarder Straßenstrich-Nutte davon zu überzeugen, auf ein Präservativ zu verzichten. Das war nur bei Zahlung eines Aufpreises möglich.
„Schön, dass du wieder da bist, Ratte.“
Die rauchige Stimme füllte den Raum aus wie Tom Waits beim Tod durch Komasaufen. Ein wenig kratzig, herb, aber von eindrucksvoller Promillezahl.
„Ich habe die Aufgabe erledigt.“
„Hast du nicht.“
„Hab ich doch.“
„Gar nicht.
„Wohl!“
„Nun dann, ich will dir vertrauen und dir Glauben schenken. Dennoch, ich bin ein wenig enttäuscht.“
Die Bernsteinaugen lächelten spöttisch. Der Rest des Gesichts auch. Der Rest des Körpers auch. Dann lächelte auch der Raum, gleich einem Honigkuchenpferd auf der Suche nach Nägeln. Sie pieksten nicht, doch Ratte schaute gequält.
„Wieso das denn, Lord?“
„Deine Aufgabe ist noch nicht erfüllt.“
Der Bürostuhl drehte sich, die unruhige Gestalt vor ihm zitterte.
„Bring mir den Jungen! Bring mir HARRY POTTER!“
Mit Schwung drehte sich der Bürostuhl wieder in seine ursprüngliche Position. Er war das letzte Karussell auf dem Jahrmarkt. Alt, aber beständig. Die Ringe des Saturn.
„Ähh... mein Lord?“
„Was denn noch?“
„Wer ist dieser Harry Potter?“
„Sie machen einen großen Fehler, Mr. Thater!“
„Wieso? Glauben Sie etwa, ich bin auf Ihren Beitrag angewiesen?“
Mr. Thater rückte seine Brille zurecht und beugte sich über den wuchtigen Mahagoni-Tisch. Seine Wampe sah dabei aus wie eine vergessene Familienportion Wackelpudding.
„Hören Sie“, begann er wieder und strich sich über den Bart, „Diese Firma ist seit Jahrzehnten in Familienbesitz, und wir mussten nie Kompromisse machen. Eine Mutterfirma, international führend, 50 Tochterfirmen, über 20 verschiedene Joint Ventures und Anteile an allen relevanten Elektronikherstellern. Und da soll mich ein Roman über ein längst vergessenes Computerspiel interessieren?“
Dr. Jeffrey „lunovis“ Cole ließ vor Wut seine Hand auf eine freie Stelle des Mahagoni-Monstrums niedersausen, sodass sämtliche Porzellanfigürchen des passionierten Sammlers Thater einen Satz in die Höhe machten.
„Das kann nicht Ihr Ernst sein!“, japste er und fummelte in der Innentasche seines überteuerten Anzugs nach seinem Inhaliergerät, „Ich habe jahrelang an diesem Werk gearbeitet! Sie müssen doch einsehen, allein welchen ökonomischen Nutzen dieses Buch für Ihren Konzern haben wird! Es ist ein... Jahrhundertwerk!“
Mr. Thaters Schnurrbart bewegte sich nur minimal nach oben, als er mit ruhiger Stimme antwortete. Ruhig, aber bestimmt. Wie lunovis' Freundin Emy, wenn er mal wieder mutwillig ihre Zeitschriften entsorgt hatte, die unordentlich im Haus herumgelegen hatten.
„Das ist mir egal. Dr. Cole, sehen Sie... ich habe genug Geld, um mir tausend Jahrhundertwerke schreiben zu lassen. Ihre Mitarbeit ist dabei nicht nötig.“
Ein lautes Klappern. Der Stuhl blieb kurz vor dem überdimensionierten Bücherregal des Büros liegen. lunovis fasste sich keuchend an die Brust. Lange würde er das nicht mehr aushalten, aber eines musste noch gesagt werden. Das letzte Wort mit den letzten verbleibenden Buchstaben eines endlich endenden Scrabble-Spiels. Nur die Punkteverteilung, die blieb ungerecht.
„Wissen Sie was?“, kreischte er, „Sie sind ein Banause! Sie sind fett, faul, und selbstzufrieden... Sie... ich, ich habe studiert, Sie können nicht einfach...“
„Dr. Cole!“
Jetzt war auch Mr. Thater aufgesprungen und war puterrot im Gesicht. Nicht allerdings primär vor Wut, sondern offensichtlich vor Scham. Seine fleischige Hand wies auf die hässlichen Porzellanvögel auf seinem Schreibtisch.
„Nicht vor den Enten!“
Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und eine Person stürmte in das Büro, welche lunovis sofort als Marushka identifizierte.
„ECHSENMENSCHEN!“
„NEEEEEEEEEIN!“
Mr. Thater hatte sich geduckt und aus einer Schreibtischschublade einen Satz Granaten hervorgeholt, die zum Sturmgewehr, das Marushka in den Händen hielt, farblich in etwa genauso gut passten wie ein angeschossener Wallach zu einem wolkenverhangenen Himmel.
Durch das gekippte Fenster drangen die pulsierenden Geräusche von Hubschraubern herein.
„Das Militär ist hier!“, raunte Marushka und setzte sich eine viel zu enge Kappe im Camouflage-Muster auf ihren dicken Kopf, „Jetzt geht’s hier richtig ab!“
Eine Explosion erschütterte das ganze Gebäude derart, dass es alle im Büro von den Füßen riss. lunovis fühlte sich wie der Frosch im Mixer.
Mit einem Mal wurde die Wand rechts von ihm einfach weggesprengt, wie ein Knoppers um halb zehn Uhr morgens in der rissigen Hand eines einsamen Bauarbeiters.
„Mr. Lybyan!“, keuchte Thater, der sich als erstes wieder erholt hatte, wobei er einem explodierenden Feuerlöscher nicht unähnlich sah.
Mr. Lybyan grinste. In seiner rechten Hand ruhte ein Stein, die Rune. Sie war umgeben von einem violetten Glühen, das wie Rauch waberte. Jetzt war alles aus. lunovis wurde schlecht er und konnte sich nicht einmal in einen Hustenanfall retten – stattdessen erbrach er sich auf den staubigen Büroboden wie ein gealteter Bahnhofspenner. Sowohl durch den Mund, als auch durch die Nase.
„Das“, sprach Mr. Lybyan langsam wie die Zeit in einem Zahnarztwartezimmer, gedehnt wie der Raum bei einer umgekehrten Warpreise, arrogant wie Dr. Cole bei seiner Promotion und selbstsicher wie Jesus nach seiner Auferstehung, „ist die Zukunft.“
Geändert von John Irenicus (16.03.2011 um 22:56 Uhr)
-
„So, jetzt nur noch die neunzehn Bücher irgendwie auf dem Nachttisch unterbringen, und dann bin ich für heute fertig…“
Innostian beendete gerade einen ereignisreichen Tag, der vor allem von jeder Menge Predigten sowie einer großzügigen Kollekte geprägt war. Als Paladinanwärter hatte man einiges zu tun, doch bereitete es ihm große Freude, den Menschen das Wort Innos näher zu bringen und den Armen zu helfen. Erst heute Morgen hatte er wieder eine sterbende Frau den Segen des guten Gottes gegeben und um Vergebung für ihre Sünden gebeten. Nach der Mittagspredigt hatte er einem Kleinbauern eine Horde wilder Keiler vom Feld gejagt – ohne auch nur den Hauch einer Gegenleistung zu verlangen. Selbst den angebotenen Eintopf der Bäuerin überließ er lieber den Feldarbeitern als Extraportion. Für ihn war das Vollbringen einer guten Tat Lohn genug.
Jene Erlebnisse ließ er beim allabendlichen Aufräumen in seiner Wohnung Revue passieren. Während er seinen Gedanken nachhing, schaffte sich die Ordnung wie von selbst. Jetzt war es ihm auch gelungen, sämtliche der neunzehn Bücher, die er gerade parallel las, auf seinem kleinen Nachttisch zu platzieren. Nicht eine Ecke ragt über die Ablagefläche hinaus, nicht einmal „Das große Buch der Logik“. So musste es sein!
Auch der Rest der Wohnung war aufgeräumt, geputzt und gewischt, und alles in allem fand Innostian, dass er wirklich stolz auf sich sein konnte. Gelungener konnte ein Tag nicht zu Ende gehen.
Er wollte sich gerade in seinen Sessel fallen lassen, da klopfte es zweimal laut an der Tür, und eine ihm nicht unbekannte Gestalt stürmte herein.
„Manus! Sieh zu dass du nicht sofort wieder alles dreckig machst!“
Innostians wie immer dunkel gekleideter Mitbewohner hatte einen irren Blick aufgesetzt und musterte entsetzt die Wohnung.
„Was hast du getan, heuchlerischer Narr?“, brüllte er, „Hier ist ja alles… alles…“
Er brach ab, weil er es offensichtlich nicht wagte, das nächste Wort auszusprechen. Mit zufriedenem Grinsen beendete er Manus’ Satz.
„Ordentlich.“
„Eine der wenigen Momente, in denen du Innosfanatiker nicht lügst, und trotzdem machst du mir Angst! Warum nur propagierst du in deiner Beschränktheit den geistigen Stillstand? Du Untermensch!“
Immer noch lächelnd ließ sich Innostian nun doch noch in seinen Sessel herabsinken.
„Definiere Untermensch“, bat er.
„Wie bitte?“
Manus blickte zunächst in Innostians Gesicht, sah sich dann noch einmal im Raum um und blieb am Nachttisch seines Mitbewohners hängen.
„Ja… das große Buch der Logik, na toll. Stehen da wieder Innos seine Hasspredigten drin, oder was?“
„Definiere Hasspredigten“, konterte Innostian selbstsicher und hörte gar nicht mehr auf zu grinsen.
„Jetzt reicht’s mir aber! Verdammt, IN-OS-TI-AN! Weißt du was wir mit so einem wie dir zu Hause machen würden? Mit Gesindel wie dir? Innospack, das nur zu motivlosem Morden und sinnloser Quälerei fähig ist? Weißt du, was wir mit Innos seinen Jüngern machen? Wir sperren sie in eine unserer Zellen ein, lassen sie sich selbst zuscheißen, und holen sie nur raus um ihnen ihre Scheiße wieder zurück in den Arsch zu schieben, sie dabei auszupeitschen und ihre Gesichter mit Säure zu verbrennen! Geheilt werden sie dadurch zwar nicht, aber wir töten sie ja eh irgendwann.“
„Das ist krank und böse“, kommentierte Innostian ruhig.
„WIR SIND NICHT BÖSE!“, fauchte Manus, „und der einzige, der krank ist, das bist du. Mannmannmann… schlimm genug, dass mein Haus da unten zusammengebrochen ist, weil ich es von den Skeletten meines totgeborenen Sohns und meines einarmigen Vaters zusammenzimmern ließ. Schlimm genug, dass ich meinen Mentor vergrault habe, weil ich ihm vier seiner zehn 13-jährigen Mädchen weggeschnappt habe. Aber dann komme ich auch noch in eine Oberweltwohnung wie deine! Und nur, weil wir über drei Millionen Ecken verwandt sind!“
Jetzt war Innostian wieder aufgestanden.
„Beklage dich nicht, Manus!“, wies er ihn mit erhobenem Zeigefinger an, „Du kannst froh sein, hier umsonst wohnen zu dürfen!“
„Pah“, erwiderte Manus und spuckte auf den Teppichboden, „Keinen müden Schith würde ich für die Bude hier zahlen!“
„Was heißt hier Bude?“, empörte sich Innostian, und ging einen Schritt auf Manus zu, „Hier ist doch immer alles aufgeräumt und ordentlich!“
Manus klatschte sich mit der flachen Hand ins Gesicht.
„Na gerade das ist doch das Problem, du Narr!“, nölte er, „Wo bleibt die Bewegung, wo bleibt das Chaos? Was ist mit dem Adanos-Prinzip?“
„Definiere Adanos-Prinzip“, erwiderte Innostian lakonisch.
„Ja, wenn ich das nur könnte…“, murmelte Manus resignierend.
„Weißt du“, begann Innostian wieder, „Ich glaube, du hast dich einfach nur von eurem künstlichen Spielzeugfeuerball da unten bescheinen lassen. Da kann man ja nur blöde werden.“
„Du Heuchler!“, fuhr Manus ihn an, „Der Gemeinschaft ihre künstliche Sonne ihr Licht und ihre Wärme sind unübertroffen! Sie scheint immer, und eurer Sonne ihre Strahlen können da ja gar nicht mithalten!“
„Sie ist ein Geschenk Innos’“, erklärte Innostian sachlich.
„Mir doch egal, ob sie Innos ihm sein Geschenk ist! Weißt du was? Mir meine Laune ist mir jedenfalls gründlich vergangen, und alles nur wegen dir deiner Ordnungssucht! Dieser Tag ist einfach furchtbar… ich hab ja auch noch mir mein Amulett verloren und musste mir kurzfristigen Ersatz aus dem Kaugummiautomaten holen.“
Energisch deutete Manus auf den kleinen Anhänger, der um seinen Hals baumelte. Er stellte einen debil sabbernden Zombiekopf dar.
„Weißt du eigentlich, wie demütigend das ist?“
„Keine Ahnung… wir haben mit solchen protzigen Statussymbolen nichts am Hut“, erklärte Innostian schulterzuckend.
„Du Heuchler!“, brüllte Manus wieder, „Dass ich nicht lache! Innos seine Kirche macht doch den ganzen Tag nichts anderes, als Geld für irgendwelchen Luxus zu verprassen! All dieses Gold… statt eure Kathedralen zu bauen, solltet ihr vielleicht lieber Lebensmittel kaufen!“
„Tun wir ja auch“, sagte Innostian lächelnd, „Dafür ist eben auch noch Geld übrig.“
„Lügner! Ihr seid alles Lügner! Euch eure Lügen kann ich nicht mehr hören! Ich muss für ein Brot zweieinhalb Monate das Skelett meines querschnittsgelähmten Cousins auf die Felder schicken!“
„Jetzt sei doch nicht so gereizt…“
„Nicht so gereizt? Dir deine Visage würde ich jetzt gerne in den Totenländern sehen! Der Freizeitpark der morbiden Meuchelfreunde! Oh ja… was würde ich dir gerne eine Fahrt auf dem Blutkarussell oder der Beliarbahn spendieren… und zum Abschluss gäbe es eine schöne Portion gebrannte Paladinmandeln und einen Stab Nekrowatte! Mjam…“
„Definiere Nekrowatte“, antwortete Innostian.
„Bei Beliar, halt einfach die Klappe, sonst werde ich noch bö… äh… sonst, du weißt schon. Oh Mann… dieses verdammte Amulett. Ob es wohl jemand findet? Hoffentlich!“
„Ähm, Manus“, gab Innostian zu Bedenken, „Ist derjenige, der es anpackt und dabei nicht du ist, nicht auf der Stelle tot? Ich meine, es…“
„Verdammt, ja, und dann hat er es auch verdient! Wenn er Grenzen überschreitet, muss er dafür bezahlen! So ein Gesindel, wenn man mir mein Amulett auch einfach anfasst! Das gehört bestraft, aufs Härteste!“
„Aber wie soll es dir dann je jemand zurückbringen, wenn das Amulett selbst doch quasi verhindert, dass es zurückgebracht werden kann?“
Manus warf abermals einen kurzen Blick auf das große Buch der Logik und ließ ein abfälliges Grunzen ertönen.
„Weißt du was, Innostian? Ich gehe jetzt in einen Club und reiße ein paar Mädels auf. Vielleicht finde ich ja endlich eine, die mit mir Opfersaft-, Nassauskiesung- und Durchbruchsbohrung-Rollenspielchen spielt. Mann, diese letzte, die ich da hatte, Zeloti hieß sie, die hat mich immer ein uraltes Skelett spielen lassen und dann auf meinen Rippen Xylophon gespielt, ich kann’s dir sagen, die hat eine Sonate nach der anderen auf meinen Knochen gehämmert…“
„Das ist auch sowas, worüber ich mit dir reden wollte, Manus“, begann Innostian nachdenklich, „Euer Frauenbild ist doch ziemlich bedenklich. Alles wird von Männern regiert, und die Frauen sind einfach nur da, um willig zu sein. Ihr könntet doch zum Beispiel mal eure Bauwerke nach Frauen benennen, um ihnen auch mal eine wichtige Bedeutung einzuräumen!“
„Achja? Und wie soll dann so ein Bauwerk heißen? Xardas-seine-Frau-ihr-Turm, oder was?“
„Definiere Xardas.“
Zähneknirschend spreizte Manus die Finger an seinen Händen und raunte: „Jetzt reicht es, heuchlerischer Innosjünger! Vorbei die Zeiten der Heuchelei, Lügerei, Gelderpresserei und Unterdrückung! Vorbei sei dein schändliches Wirken auf dieser Welt, die du am liebsten im starren, strengen Stillstand sehen würdest! So wahr ich einer von Beliar seinen Drahtspinnern bin, so wahr ich ein Dementor bin! Du wirst nun vernichtet werden, und nicht in deiner schrecklichsten Vorstellung wirst du dir ausmalen können, was ich danach mit dir deiner Leiche machen werde!“
„Mach dich nicht lächerlich Manus, was willst du schon machen?“, sagte Innostian schulterzuckend und steckte lässig eine Hand in die Hosentasche.
„ICH WERDE DICH IM FUNKENFLUG GRILLEN, DU BESCHRÄNKER NARR!“, keifte Manus, und richtete seine gichtkranken Finger auf seinen Mitbewohner.
Dann verging eine schier unendliche Zeitspanne, in der Manus mit vor Anstrengung und Konzentration verzerrtem Gesicht auf Innostian blickte. Die ausgestreckten Finger zitterten, und langsam bildeten sich Schweißperlen auf seiner Stirn. Innostian hingegen tat nichts außer weiterhin milde zu lächeln. Dann irgendwann brach Manus endlich sein Schweigen.
„Verdammt!“, fluchte er, „Was ist das? Ich kann dich nicht umpolen!“
Da verlor Innostian seine Selbstbeherrschung und fing aus vollem Halse an zu lachen. Es dauerte ziemlich lange, bis er sich beruhigt hatte.
„Natürlich kannst du das nicht!“, rief er triumphierend, „Ich habe keine Ladung! ICH BIN NEUTRAL!“
Mit angsterfülltem Blick wich Manus zurück.
„Das kann nicht sein!“, japste er.
„Oh doch!“, lachte Innostian, und zog seine Hand wieder aus der Hosentasche heraus. Fest umklammert hielt er nun einen langen Zauberstab aus Mahagoni.
„Und jetzt: EXPECTO PATRONUM!“
Dann ging alles in einem weißen Nebel unter.
-
Fisch.
Ist.
Sparsam.
HAAAAAALLOOOO!
Guys... es wird Zeit, dass ich mal ein bisschen dead-end-Storytelling betreibe. Ich hoffe ihr sitzt gut und habt etwas an dass ihr euch klammern könnt, denn dieses Script wird das dramturgical writing von Grund auf neu definieren! Klar, manche mögen das größenwahnsinnig nennen, aber hey, you've got only one shot, das Leben ist zu kurz um sich immer nur zurückzuhalten. Wenn du auf der Seite der Gewinner stehen willst, gibt’s nur eines: Try!
Kleines Intermezzo für die Leute die immer noch nicht vor lauter Langeweile eingeschlafen sind: Meine Contribution mache ich gerade von einem Strip-Club in dem die Hupen Nadjas einem für lau ins Face gedrückt werden... nach meiner Reise in alle Ecken Myrtanas, allen Mitgliedsstaaten der NATO (fuck yeah – die Kanadier wissen, wie man einen annehmbaren Starbuck's-Schuppen schmeißt!), dem Bernsteinzimmer und Hempels Sofa kann ich definitiv sagen, dass DAS hier nicht mehr zu toppen ist. Und hands down: Ich glaube nicht, dass meine Weiterreise zum Mars zur Besichtigung von Curiosity wirklich besser wird.
Jedenfalls stehen die Mädels hier auf Bartricks, und ich kenne sie alle... für einen wirklich guten Trick braucht man ja nur eines: Eye Contact. Und Leute, wenn ich was über mich sagen kann, den hab ich! Obwohl alle Augenärzte mich niedergemacht haben, wurde mir stets überdurchschnittliche Sehkraft bescheinigt. Warum? Weil man wissen muss, wie man auf die Gewinnerseite kommt. Ich kenne alle Achttausender in- und auswendig obwohl ich noch nie einen bestiegen habe, mache eintausend Liegestützen auf einem Nagelbrett ohne dass ich Arme hätte, jongliere bauchfrei mit meinen Kontoauszügen, ich kann dreiunddreißig Sprachen fließend ohne je Sprechen gelernt zu haben und kein Lehrer konnte sich das je erklären. Dabei ist die Antwort so einfach: Learning-by-Doing. Wie du reich wirst, kann dir keiner beibringen. Wie du dir den Arsch abputzt, auch nicht. Aber: Selbst das habe ich mir selbst beigebracht! Von daher nur eines: Selbst wenn du (und damit meine ich nicht nur dich (denn ich kann ja nicht wissen ob du das gerade liest (falls es überhaupt jemand liest (oder sich vorlesen lässt))), sondern auch andere die da kommen mögen) glaubst, alles zu wissen: Es gibt eine Form von Erfahrung die kannst nur du selbst machen. Und die habe ich gemacht. Und davon möchte ich auch erzählen... während ich meinen letzten Sex in irgendwelchen Amsterdamer Hinterhöfen noch einmal durch den Kopf gehen lassen wie den Abspann eines Films oder einer Serie, in der die Figuren, die man so lieb gewonnen hat, nun letztendlich Abschied nehmen und dazu erklingt eine traurige Komposition... you know what I mean.
Oh shit! Ich habe euch ja noch gar nicht von meinem epischen Battle mit Xardas erzählt! You know, at that time war ich ungefähr 6, konnte aber schon alle Zaubersprüche Diesseits Myrtanas und Jenseits von Eden. Ihr wisst schon, Grünschnabel von Jungfeuermagier der nicht damit klarkommt dass das unglaublich harte Arbeit ist und die ersten 10 Spruchrollen totaler Bullshit sein werden. Kurz und gut: Boy meets Xardas, auf kurze Sicht sieht alles in jeder Hinsicht finster aus, weil der Dämonenbeschwörer einen Finsterniszauber gewirkt hat. Licht gab's nur für den Spiegel, den er mir vorgehalten hat... und ich sag's euch, eine Innos-Götze war nix dagegen! Mein ganzes Idealbild ist zusammengekracht... dazu noch typical Mage-Rage, ihr wisst schon: Kloster hassen, Zaubersprüche ausdenken, Pyrokar den Nachttopf klauen und sich Ulthars Stab in den Arsch rammen. Y'know.
Was kam dann? Ein elender Entleerungsprozess. Der ganze Dünnschiss wooshte einfach aus mir raus, ich hockte nur noch auf der Toilette. Being busy eben. Awesome Erfahrungen bisher. Bin lebhafter Karaoke-Furzer geworden und scheiße euch Beethovens Sinfonie in doppelter Geschwindigkeit. Gestank ist, wenn dein Körper von einem Geruchskeiler auf höchst effiziente Weise zerfetzt wird, weil du ihm einen Moment zu lange die Nase hingehalten hast. Entweder die ganzen Putzfrauen hier lieben mich wirklich, oder sie verarschen mich.
And now for something completely different: Das, was ich euch eigentlich erzählen wollte.
Also, da gab es diese Gestalt, wobei ich jegliche Artikel jetzt weglassen werde. Just for fun, Y'know. Und das war... also irgendwann im frühen Sommer oder späten Frühling. In etwa Juno, Y'know. Gestalt war gerade ziemlich busy, nahm sich aber die Zeit um ein paar neue Barwetten im geilsten Club der Stadt auszuprobieren: Lynchens Valley. Klar, auch auf die Gefahr hin dass es blasphemisch klingt: Aber der Name passte einfach nur in an amazing way.
Denn drinnen war nur Knochenmann, der so vor sich hin ächzte. Being busy eben. Anyway, Gestalt zögerte nicht lange und platzierte einen ziemlichen Dick-Move, der noch Jahre andauern sollte. Und hat er sich dafür entschuldigt? No Way!
Stattdessen setzte der Gestalt-Rockstar noch einen drauf und schlug ihm eine Barwette vor:
Dunkle Biere sich ergiessend, in jenen Krug der Safte fließend,
Malze, trüb, doch stark so sehr, heimgesucht vom Gerstenmeer,
Hopfen auf der Früh Gesandte, und der Schnaps wie Feuer brannte,
Als sich die Gestalt umwandte, bitter und bedeutungsschwer,
Brünftig hoffte auf den Orgi, seelig und redundanter,
Füll den Krug, das Bier ist leer!
Endlos hier der Brand tat Kund, gießt den Safte in den Schlund,
Brustbehaarung wie ein Bär, und untenrum sogar noch mehr,
Fantasien vom Frauenzimmer, der dürre Dick verharrt noch immer,
Totenstimmen in dem Zimmer, being busy everywhere,
Das Metrum und die Anzahl der Silben geben in dieser Zeile echt nix her ,
Gib mir halt die Kohle her.
Fuck yeah, was soll ich sagen? Einen Augenblick später sind Gestalt und Knochenmann am Wettsaufen und machen dabei einige awesome Erfahrungen. Just in case: Gestalt verliert natürlich. Wieso? Weil das ganze Bier, was sich Knochenmann in den Mund kippt, durch seine Rippen wieder herausfließt. DAS ist die Pointe des Ganzen.
Und jahaa, wer sagt dass das lächerlich ist, hat das noch nie im Kontext gelesen.
Geändert von John Irenicus (19.08.2012 um 17:08 Uhr)
-
Die Nacht hatte Korbir keinerlei Erholung beschert, er hatte unruhig geschlafen wie eigentlich jede Nacht, denn seine Träume bestanden seit einiger Zeit nur noch aus Mauern.
Ziegelmauern, Holzmauern, Lehmmauern, Mauern aus Blattwerk, Eis, Geröll, selbst Mauern aus Leichenteilen waren die Hauptdarsteller in seinen Träumen. Diesmal hatte er von einer besonders großen, unüberwindbaren Steinmauer geträumt, auf die er sich wie jedes Mal zunächst keinen Reim machen konnte. Nun aber, als er in völliger Ruhe an den Himmel seines Zeltes starrte, erkannte er, wo die Nautilus im Pfeffer lag, was immer eine solche Nautilus auch sein mochte und aus welcher fremden Welt sie gekommen war.
„Wir bauen eine Mauer um diese verdammten Orks! Eine riesige, endlos lange Mauer! Dann sind wir sie für immer los!“
Korbir erschrak ein wenig vor sich selbst. Einerseits weil er geglaubt hatte, in Sachen Mauern mit seinem Jharkendari eigentlich schon längst am Ende gewesen zu sein. Andererseits, weil er angesichts seines Geistesblitzes ganz vergessen hatte, dass da noch jemand neben ihm lag, der vielleicht schlafen wollte.
Schuldbewusst drehte er sich um und blickte in das Gesicht seines Kameraden Rodlar. Er war offenbar schon wach gewesen, was Korbir, jetzt wo er es sah, nicht mehr weiter überraschte. Nicht umsonst betonte Rodlar doch immer, dass der frühe Scavenger den Wurm fange und den letzten die Warge bissen.
Rodlar war mittlerweile der dritte kräftige, große Hüne, der Korbir auf seiner Reise begleitete. Nachdem er zunächst den ersten dicken Kumpel und schließlich auch den zweiten beleibten Sympathikus hatte auswechseln müssen, hatte er Rodlar unverhofft in einem Zwischenlager der gefürchteten „Knarzenden Paladine“ aufgegabelt, einer umstürzlerischen Gruppe, die ihren Namen den alten Ritterrüstungen verdankte, welche die Männer trugen, und die schon weitaus bessere Zeiten und vor allem mal mehr Moleratfett gesehen hatten. Für Rodlar jedenfalls war aufgrund seiner Statur ohnehin nie eine passende Rüstung vorrätig gewesen, was ihn schließlich zu einem ziemlichen Außenseiter in seiner Gruppe gemacht hatte. Korbir aber hatte die hünenhaften Qualitäten Rodlars auf den ersten Blick zu schätzen gewusst, passte der Mann doch perfekt in sein Begleiterschema. So hatten er und Rodlar sich letztendlich aus dem Zwischenlager der Knarzenden Paladine unter dem Vorwand geschlichen, sie wollten mal eben in den Wald gehen um einhändig und mit verbundenen Augen ein Rudel Snapper zu erlegen. Gesagt, getan, hatten sie sich schnell abgesetzt und in die Berge begeben, um aus der Höhe zunächst etwas Überblick über die umgebende Landschaft zu gewinnen. Und nun lag Korbir hier, nach ihrer Nachtruhe, gemeinsam mit Rodlar im kleinen Zelt und sah sich der Verwunderung seines Gefährten ausgesetzt.
„Was schreistn auf eima so rum?“, nuschelte dieser doch noch etwas verschlafen. „Haste wieder geträumt?“
„Ja“, antwortete Korbir, der noch immer ein innosfürchtiger Mann war, aufgeregt. „Ich habe die Idee: Wir bauen einfach eine Mauer um die Orks herum und schotten diese niederen Kreaturen so von uns ab! Vergiss die Knarzenden Paladine, Rodlar: Den Steinernen Mauern gehört die Zukunft!“
Rodlar fuhr sich mit einer seiner Pranken durch seinen Bart und brummte nachdenklich.
„Na, wenn du meinst… hey, hey, warte mal, sei still, da kommt noch einer, jetzt, jetzt!“
Rodlar hob sein Hinterteil in die Höhe und entließ aus seinen Gedärmen einen wahren Orkan, dessen Geräuschpegel in etwa mit einem Donnern vergleichbar war. Nach nur wenigen Augenblicken roch es im Zelt wie im Ripperkäfig.
„Harharhar“, ließ Rodlar sein bauchiges Lachen ertönen, „das war ja ma’ ’n richtiger Hammer, was? Boah ey, von deinem Riesenratteneintopf kann ich echt nicht genug bekommen!“
Er stieß Korbir ein paar mal lachend mit dem Ellenbogen in die Seite, was dieser seinerseits mit ein paar Stößen quittierte. Manchmal verglich Korbir sich und Rodlar mit einem Paar Gaganüsse: Außen hart und innen weich, schwer zu knacken, aber in der richtigen Mischung einfach unschlagbar.
„Nun komm“, sagte Korbir und setzte sich endlich auf, „wenn wir hier noch weiter herumliegen, fressen die Riesenratten noch uns!“
„Am Hexenarsch, am Hexenarsch,
da lab’ ich mich nach langem Marsch,
ich knet’ ihn durch, ich stoß hinein,
Wandern kann so lustig sein!“
Sie waren nun schon eine Weile den immer steiler werdenden Berg hinaufmarschiert, als Rodlar plötzlich das Lied angestimmt hatte.
„Wo hast du das denn schon wieder her?“, fragte Korbir nun, nachdem sein Freund geendet hatte. Er war lustigen und auch derben Liedern prinzipiell nicht abgeneigt, aber dass es gerade um einen Arsch gehen musste, sagte ihm nicht gerade zu, und das musste eigentlich auch Rodlar wissen – als einer der wenigen Menschen auf dieser Welt.
„Erinnerst du dich noch an Rennicko?“, fragte der Hüne zurück.
Korbir nickte. Er hatte nur wenige Tage im Lager der Knarzenden Paladine verbracht, doch dem Barden Rennicko und seiner Laute konnte niemand auch nur für wenige Stunden entrinnen.
„Der hat mir das mal beigebracht, einen Abend, als wir mal wieder voll wie die Katapulte waren. Leider kann ich mich deshalb auch nur noch dunkel an alle Strophen erinnern, aber vielleicht bekomme ich sie ja noch zusammen…“
„Lass nur, lass nur“, meinte Korbir und sah betreten zu Boden, was seinem Freund nicht entging.
„Hast du etwa wieder Schiss, dass wir irgendwelche unsichtbaren Schattenläufer aufscheuchen?“, neckte Rodlar ihn. „Immer wieder das gleiche… sie sind überall, wir können sie nur nicht sehen, sie aber uns, was? Klar, eine halbe Tonne Fell, Fleisch und Pranken versteckt sich mal eben hinter einem Farn oder so, und das am besten noch zu hunderten, was?“
Korbir schüttelte den Kopf.
„Das ist es nicht, aber lass es für den Moment einfach gut sein, in Ordnung?“
„Kein Problem“, meinte Rodlar, „mir fällt die nächste Strophe ja gerade sowieso nicht ein.“
Der Hüne grinste, als er erkannte, dass sich das Bedauern Korbirs über diesen Umstand in Grenzen hielt.
„Ja, da ist dieser Feuerkelch wohl noch einmal an dir vorübergegangen… vorerst.“
Den nächsten Teil des Weges gingen sie schweigend nebeneinander her, wenn man einmal von den gelegentlichen und geräuschvollen Nachwirkungen der Doppelportion Riesenratteneintopf in Rodlars Verdauungstrakt absah. Hier im Freien konnten die Lüfte aber immerhin abwehen, im glücklichen Gegensatz zu der Situation heute morgen im Zelt. Selbiges trug Rodlar nun zusammengerollt auf dem Rücken, eine Aufgabe, die er einst widerwillig angenommen hatte, mittlerweile aber mit großem Pflichtbewusstsein ausführte. Seinen vormaligen Widerstand, das Zelt auch nur anzufassen, geschweige denn darin zu schlafen, hatte Rodlar stets mit dem seiner Ansicht nach „bestialischen und menschenrechtswidrigen Herstellungsprozess“ begründet. Nachdem Korbir dem aber mehrmals entgegnet hatte, „dieser unverschämte Typ mit den Schlepphoden“ sei „doch selbst Schuld“ gewesen und bräuchte „seine Haut nun eh nicht mehr“, war Rodlar zwar nicht gänzlich überzeugt gewesen. Als Korbir aber drohend erklärt hatte, er hätte sich dann ja gar keinen dicken, kräftigen Freund suchen brauchen und könne auch gut mit einer schlankeren Variante vorlieb nehmen, wenn er das Zelt eh selber tragen müsse, hatten sich auch die letzten Bedenken Rodlars in alle Winde verstreut.
Und so trug Rodlar auch jetzt wieder das Zelt, während er und Korbir den felsigen Gebirgsweg hinauf trotteten. Der Boden unter ihren Füßen war staubig und karg, nicht weit von ihnen aber floss ein kühler Gebirgsfluss den Berg hinab, welcher an so mancher Passage die Breite und Stärke eines reißenden Stroms erreichte. Sollten wir hier blitzartig fliehen müssen, überlegte Korbir einer plötzlichen Eingebung folgend, dann springen wir ganz bestimmt nicht da rein. Das wäre ja lebensmüde!
Stolz über seine scharfsinnigen Überlegungen ließ Korbir seinen Blick weiter über die Umgebung schweifen. Der Überblick, den er sich von der erhöhten Position versprochen hatte, war ihm noch nicht vergönnt. Schaute er nach unten, so sah er nur Baumwipfel an Baumwipfel gereiht, wie sie zusammen denjenigen Wald bildeten, dessen brüchiger Friede nur allzu trügerisch war. Hier oben hingegen erschien ihm die Natur wirklich friedlich: Nicht einmal er konnte hier allen Ernstes irgendwelche lauernden Schattenläufer wähnen. Ganz im Gegenteil: Es war so idyllisch, Korbir kam sich mittlerweile vor wie Innos in Geldern. Immer weiter ging der Bergweg hinauf, immer kühler und klarer wurde die Luft, und Korbir fühlte etwas, was er schon lange nicht mehr gefühlt hatte: Glück. Er fühlte sich tatsächlich glücklich, wie er mit seinem dicken Gefährten Nr. 3 auf der Suche nach den Waldläufern und dem Druiden war, die ihm vielleicht endlich helfen konnten. Allein diese Zuversicht stimmte ihn schon wahrhaftig glücklich.
Man konnte meinen, allein mit der Gegenwart glücklich (oder unglücklich (oder traurig (oder etwas weniger glücklich (oder eine Mischung aus traurig und glücklich (oder vollkommen indifferent (oder irgendwo zwischen allem, nur eben nicht glücklich (oder doch wieder glücklich (jedenfalls in irgendeinem, hier an dieser Stelle nicht näher zu bestimmenden Gemütszustand befindlich)))))))) zu sein, doch sobald sich die Zeichen mehren, dass etwas Größeres im Vergangenen liegt und sich alles wie ein Puzzle zusammenfügen lässt, beginnt die eine, lange Suche, die einen im äußersten Fall den Verstand oder das Leben kosten kann. Sollte diese Suche aber nicht das Leben wert sein? Was ist denn schließlich noch ein Leben ohne Vergangenheit?
„Keine Ahnung“, murmelte Korbir ratlos, während er sich mit einer Hand seinen Hintern rieb, „jedenfalls ist ein Leben ohne diese Scheißdinger da hinten dranne besser als eines mit, der Rest interessiert mich doch nicht, und wo der Kram herkommt schon gar nicht. Ich kann’s mir ja eh denken.“
Rodlar, der durch das Besteigen des Bergs schon schwitzte wie ein Wildschwein – hier zeigten sich mal wieder die Nachteile der von Korbir favorisierten Begleiterstatur – wandte sich zu seinem Kumpanen um.
„Hast du was gesagt?“, fragte er, bekam die Antwort aber gleich durch ein abwesendes Kopfschütteln Korbirs geliefert, welcher sich mehr auf den Weg konzentrierte, der, wie ihm aufgefallen war, so langsam aber sicher abflachte.
„Gut“, kommentierte Rodlar fröhlich, „denn ich habe etwas zu sagen! Mir sind die nächsten Strophen eingefallen, vom Rennicko-Lied, pass auf…“
„An die Titten, an die Titten,
wird gepackt und dann geritten.
Die Sache ist ganz schnell geritzt,
nach dreimal Stoß wird abgespritzt.“
„Sei still“, unterbrach Korbir ihn schroff und blieb auf der Stelle stehen. Rodlar tat es ihm gleich und bedachte ihn dabei mit einem teils verwunderten, teils beleidigten Gesichtsausdruck.
„Nun hab dich doch nicht so“, entgegnete er, „hier sind doch nun ganz bestimmt keine Schattenläufer unter…“ - „Das weiß ich auch“, fiel Korbir ihm abermals ins Wort und deutete nun in die Ferne. Rodlar folgte seinem Blick und sah nun das, was Korbir schon lange vor ihm gesehen hatte: Ganz unversehens waren sie an einer Art Plateau angekommen, an dessen Ende zwei neue Wege abzweigten. Der eine schlängelte sich weiter den Fels hinauf und führte vermutlich bis an den Gipfel des Berges. Der andere, interessantere Weg jedoch führte wieder ein Stück abwärts. Was Korbir aber wie von der Blutfliege gestochen hatte reagieren lassen, war ein ganz anderer Umstand: Direkt an diesem Weg lagerten drei junge Männer in grünen Wämsern, mit Bögen auf den Rücken und naturbraunen Stiefeln an den Füßen.
„Da wird ja das Molerat in der Pfanne verrückt“, flüsterte Rodlar. „Waldläufer!“
Wie zur Bekräftigung seiner Verwunderung entfuhr Rodlar just in diesem Moment noch einer kleiner, dröhnender Abwind, der wenige Meter vor dem Plateau noch an den Gebirgswänden widergehallt wäre, jetzt aber glücklicherweise eher still und heimlich hinfortkroch. Korbir machte sich instinktiv bereit, einen kumpelhaften Ellenbogenhieb Rodlars ob dieser gelungenen Leistung abzuwehren, erkannte aber dann, dass der erstaunte Hüne in dieser Situation gar nicht daran zu denken wagte.
„Ob sie uns schon bemerkt haben?“, fragte er ehrfürchtig.
„Natürlich haben sie das“, sagte Korbir, meinte dies aber gar nicht so belehrend, wie es klang. „Es sind immerhin Waldläufer und nicht irgendwelche tumben Orks oder die Knarzenden Paladine. Offenbar warten sie auf uns. Oder darauf, was wir nun tun.“
Rodlar kratzte sich mit einer Pranke am Kopf.
„Dann sollten wir wohl einfach mal zu ihnen hingehen“, meinte er. „Aber Korbir, vielleicht sollten wir das Zelt sicherheitshalber hier lassen, ich meine, so Waldläufer, die könnten auf so etwas ja…“
„Geht das schon wieder los?“, fragte Korbir so aufbrausend, wie er es sich erlauben konnte, ohne angesichts der wartenden Waldläufer zu aggressiv zu wirken. „Das kommt überhaupt nicht in Frage! Ich habe dieses Zelt mit meiner Hände Arbeit zusammengenäht! Du weißt doch selber, dass der Kerl zäh wie Leder war! Ich musste schuften wie ein Klosternovize… das lasse ich mir doch jetzt nicht einfach so nehmen! Das Zelt kommt mit. Und damit basta.“
Rodlar machte Anstalten, Widerworte zu geben, besann sich dann aber offensichtlich seiner Ersetzbarkeit als Gefährte Korbirs und schüttelte daher nur genervt den Kopf.
„Weißt du, Korbir“, seufzte er, „manchmal bist du der reinste Krötenwurz, so schnell, wie du eingeschnappt bist! Aber gut, ich nehme das Zelt mit…“
In gespanntem Schweigen setzten sich Korbir und Rodlar nun in Bewegung, direkt über das Plateau hinweg auf die drei Waldläufer zu, die trotz der längeren Wartezeit noch keinerlei Anzeichen von Ungeduld zeigten. Erst als die beiden die Distanz auf nur wenige Schritte verringert hatten, sahen die drei Waldläufer überhaupt erst richtig zu ihnen auf.
„Seid gegrüßt, Waldläufer“, sagte Korbir, der sich dem Ziel seiner Reise nun näher fühlte, als jemals zuvor. Die Freude darüber ließ sein Herz schneller klopfen, und beinahe fürchtete er, aufgrund der ganzen Aufregung wieder einmal einen seiner Schwächeanfälle inklusive traumhafter Wahnvorstellungen zu bekommen, aus denen Rodlar – von dessen Vorgängern ganz zu schweigen – ihn mehr als nur einmal hatte herausschütteln müssen. Als einer der Waldläufer, der jüngste von ihnen, mit halblangem, blonden Haar, das Wort ergriff, beruhigte sich Korbir aber rasch wieder. Vielleicht sollte er einfach nicht stets den Beliar an die Wand malen, überlegte er kurz, dann würden diese Attacken auch ausbleiben.
„Seid ebenfalls gegrüßt, Wanderer“, klang die Stimme des Waldläufers überraschend tief zu ihnen herüber, als Korbir und Rodlar die letzten Schritte zu ihnen taten. „Ich sehe in euren Augen, dass ihr nicht nur der wundervollen Natur wegen hier umherstreift, sondern auf der Suche nach etwas seid. Ich hoffe doch, ihr seid keine Jäger? Denn hier beginnt unser Gebiet, und welches Getier in unserem Reservat zu leben oder zu sterben hat, das bestimmen allein wir, in Dienerschaft des Gleichgewichts.“
Korbir fühlte sich ein kleines bisschen von den mit hochheiligem Ernst gesprochenen Worten des jungen Mannes überfordert. Ein rascher Seitenblick zu Rodlar brachte ihn auch nicht weiter, was ihn aber nicht besonders überraschte: Schließlich hatte er ihn nicht wegen seiner Eloquenz, sondern wegen seiner Statur zu seinem Reisegefährten erkoren.
„Wir sind in der Tat auf der Suche nach etwas“, sprach Korbir so respektvoll, wie er angesichts der doch recht weiberhaften Kleider der drei Burschen vor ihm konnte. „Und ich glaube, wir haben es gefunden. Vielleicht kann ich in eurem Hain endlich Erlösung von meinem Fluch finden.“
„Deine Worte sind die eines Hilfesuchenden“, sprach der Blonde wieder, während die anderen zwei Waldläufer beharrlich schwiegen, „und wer Hilfe sucht, der soll sie auch bei uns bekommen. Du hast Glück, unser Druide Shelak versteht sich auch auf das Brechen von Flüchen. Doch will ich dir nicht zu viel versprechen, Wanderer. Wir wollen dich zu unserem Druiden führen, auf dass du ihm deine Geschichte erzählen mögest.“
Korbir deutete eine kleine Verbeugung zum Zeichen seines Dankes an. Vielleicht war seine Reise wirklich bald vorbei, vielleicht war er wirklich am Ende seines langen Pfades angekommen.
„Habt Dank“, sprach Korbir, „ich – wir – wollen euer Angebot gerne annehmen. Es geht hier direkt den Weg herunter, nehme ich -“
Korbir brach erschrocken ab und wich zurück, als auf einmal alle drei Waldläufer ihre Bögen spannten und säbelzahntigerschnell Pfeile anlegten. Korbir konnte nicht einmal blinzeln, da hatte der beleibteste der drei Männer bereits einen Pfeil abgefeuert, woraufhin ein gellender Männerschrei ertönte. Korbir riss seinen Kopf nach links zum Bergweg, woher der Schrei gekommen war, und sah einen ogerigen Mann zu Boden sinken. Als die drei Waldläufer in aller Seelenruhe zum leblosen Körper des Mannes hinspazierten, schlossen sich Korbir und Rodlar wortlos an, froh, nicht Ziel der Bögen gewesen zu sein.
Als sie angekommen waren und den Mann im Kies liegen sahen, erschauderte Korbir. Ein einziger Pfeil dieses Waldläufers hatte genügt, um den richtiggehenden Rippernacken des nun toten Mannes zu durchbohren.
Es bedurfte gar nicht Korbirs fragenden Blickes, da erhob nun erstmals der Schütze seine Stimme.
„Der furchtbare Hermann“, meinte er mürrisch. „Endlich haben wir ihn. War einmal ein Milizhauptmann oder so. Ein wahrer Oger von einem Mann!“
Die Redeweise dieses Waldläufers unterschied sich so stark von ihrem blonden Wortführer, dass Korbir kurz aufschreckte und beinahe in Ohnmacht fiel um von schlimmen Szenen seiner ohnehin nur noch nebelhaft und suffverzerrt gespeicherten Vergangenheit zu träumen. Da es dieses Mal aber nun wirklich keinen ernsthaften Anlass dazu gab, besann er sich eines besseren und ließ es lieber bleiben, schon wieder den sterbenden Scavenger zu spielen.
„Nachdem er unrühmlich aus seinem Dienst ausgeschieden war, hatte er sich wohl in die Wälder abgesetzt… seitdem streifte er schon seit einiger Zeit um unser Gebiet herum.“
Korbir musste unwillkürlich an seinen verflossenen Reisegefährten Hitolf denken, der jedoch nicht in der Reihe seiner dicken Kumpanen gestanden hatte, sondern vielmehr irgendwann zu den Knarzenden Paladinen gewechselt war. Dessen herrisches und teils launisches Wesen hatte ihm auch nicht nur Freunde eingebracht. Es hätte Korbir also nicht gewundert, wäre auch Hitolf eines Tages nach seinem rasanten Aufstieg in den Reihen der Knarzenden Paladine hinausgeworfen worden und in die Wälder gegangen, um seiner unsteten Seele ein bisschen Frieden zu geben.
„Zuerst haben wir ihn gewähren lassen“, fuhr der dickliche Schütze fort, den Korbir ganz nebenbei schon als potentiellen Ersatz für Rodlar ins Auge gefasst hatte. Die Größe war zwar nicht ganz passend, aber sollte Rodlar noch mehr Zicken mit dem Zelt machen…
„Dann aber hat er angefangen, einfach Blumen zu pflücken! Diesen abscheulichen Angriff auf die Integrität der Natur hat uns und unseren Druiden erbost. Er gab uns den Auftrag, Hermann seiner gerechten Strafe zuzuführen, wenn wir ihn das nächste Mal sehen sollten. Und nun… ist er tot. Das Gleichgewicht ist endlich wiederhergestellt.“
Korbir war sich nicht ganz sicher, ob er die Gedankengänge des Waldvolks wirklich nachvollziehen konnte, der Blonde ließ ihm aber auch keine Zeit dazu, weiter darüber nachzudenken.
„Aber nun kommt“, sprach er, „da dies nun erledigt ist, wollen wir keine weitere Zeit verlieren und in unser Dorf zurückkehren. Folgt uns, Wanderer, bleibt dicht bei uns, und euch wird nichts geschehen.“
Korbir schluckte. Waren hier etwa…?
„Ähm, was soll uns denn geschehen?“, fragte er vorsichtig. „Lauern hier etwa… Schattenläufer auf uns auf, die wir nicht sehen können, sie aber uns?“
Der Blonde und der Schütze schauten sich kurz an und fingen dann lauthals und schallend an zu lachen, und sogar der schweigsame Dritte im Bunde stimmte kurz mit ein. Es dauerte quälend lange, bis endlich einer der Waldläufer wieder das Wort ergriff.
„Aber nein“, meinte der Blonde, der sich nur schwerlich wieder einkriegen konnte, „wie kommst du denn auf sowas? Schattenläufer, die sich verstecken… oh Mann. Nichts für ungut, aber… hahaha, ich kann nicht mehr, hast du sowas schon einmal gehört?“
„Nee“, scavengerte der dicke Schütze und musste sich vor einem Hustenanfall bewahren, „echt noch nicht. Großartig, einfach großartig…“
Korbir indessen hatte die Hände in die Hüfte gestemmt und fühlte sein Gesicht heiß werden. Vermutlich sah es gerade aus wie das Blatt einer Blutbuche.
„Okay, okay, war ja nur eine Frage…“
„Schattenläufer in den Büschen“, prustete der Blonde daraufhin noch einmal los und riss nun auch den eher zurückhaltenden Dritten vollends mit, der sich stehend auf die Schenkel klopfte. Hilflos sah Korbir zur Rodlar herüber, der sich zusehends auch nur noch schwerlich zusammenreißen konnte.
„Wag es ja nicht, Rodlar, wag es ja nicht“, murrte Korbir beleidigt. „Der nächste Ersatzmann ist nicht weit, denk daran.“
Rodlar zuckte bloß grinsend mit den Schultern und sagte nichts weiter, verkniff sich aber immerhin, gewarnt wie er war, ein Lachen. Als die Waldläufer zumindest wieder des Gehens mächtig waren, beschritten sie endlich zusammen mit Rodlar und Korbir den Pfad, der sie zu ihrem Druiden führen sollte.
„Im Hexenfut, im Hexenfut,
vermengt die Hex’ heut’ Saft und Blut.
Aus hiesgem Dorfe, strammer Schwanz,
spielt gut mit beim Mummenschanz.“
„Rodlar“, zischte Korbir seinen Noch-Kumpanen an, „ich glaube nicht, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist!“
„Wieso?“, raunte Rodlar leicht beleidigt zurück. „Bis jetzt hat sich doch noch keiner beschwert.“
In der Tat hatten die drei Waldläufer auf das Lied, welches Rodlar nach einigen Metern auf dem Weg hinab plötzlich wieder angestimmt hatte, geschwiegen. Korbir interpretierte dieses Schweigen aber als bloße Abwehrreaktion, bestehend aus einer Mischung aus Höflichkeit und Fremdscham.
„Ach, vergiss es einfach, Rodlar“, seufzte Korbir und schloss ein wenig zu den drei Männern vor ihm auf, um nicht zu sehr mit Rodlars Stimmungsgesängen in Verbindung gebracht zu werden. Rodlar jedoch kam ihm direkt hinterher, allerdings mit einer Korbir milde stimmenden Nachricht.
„Vergessen ist das richtige Stichwort“, meinte er, „die letzte Strophe fällt mir nämlich beim besten Willen nicht mehr ein.“
„So“, übertönte der dicke Schütze von vorne das Geflüster hinter ihm, „wir betreten gleich unser kleines Dorf. Ich hoffe, es gefällt euch!“
Tatsächlich war es auf dem stetig nach unten führenden Weg immer waldiger und pflanzenbewachsener geworden, und nun tauchte einige Meter vor ihnen ein großes Holztor mit behelfsmäßigen Palisaden auf, vor denen zwei stämmige Männer in Waldläuferkleidung Wache standen. Sie grüßten schon von weitem, woraufhin die drei Waldläufer sowie Korbir und Rodlar den Gruß erwiderten. Das Holztor stand aber ohnehin offen, sodass die fünf ohne weiteres Prozedere hindurchgehen konnten. Korbir war froh, dass der Schweigsame der drei Waldläufer zum Eintreten drängte, denn der dicke Schütze machte Anstalten, den beiden Torwachen erst einmal eine kleine Anekdote über unsichtbare Schattenläufer zum Besten zu geben.
Nur wenige Schritte nach Passieren des Tores fühlte sich Korbir wie in einer anderen Welt. Verwundert war er, als er die Bauten sah, die gerade einmal ganz entfernt richtigen Häusern glichen. Inmitten von kreuz und quer gepflanzten Hütten und Zelten herrschte ein reges, aber dennoch ruhiges Treiben. Waldläufer liefen umher, Waldläuferinnen liefen umher, und Personen von unterschiedlichem, keinem oder nicht bestimmbarem Geschlecht in Waldläuferkleidung liefen umher.
„Es ist zwar nicht gerade Vengard“, kommentierte der Blonde, der nun wieder die Führung übernommen hatte, „aber gerade das macht unser Dorf aus.“
Zielstrebig bahnte er sich einen Weg zwischen den Hütten, einigen Beeten und natürlich den umherlaufenden Waldläufer*innen hindurch. Zu fünft fiel es bei der engen Bebauung des nur teilweise als Lichtung, teilweise aber auch als echter Wald ausgestalteten Dorfgebiets schwer, beisammen zu bleiben. Wohl auch deshalb verabschiedeten sich nach kurzer Zeit der dicke Schütze und der Schweigsame, um ihrer eigenen Wege zu gehen. Korbir versuchte, sich den Weg zu merken, den der Schütze nahm, falls er Rodlar doch noch die Freundschaft aufkündigen musste. Bei den unübersichtlichen Wegen jedoch und den vielen gleichartigen Hütten hatte er so rasch zunächst den Schützen und dann auch noch die Orientierung verloren, dass er sein Vorhaben aufgab. Wenn es hart auf hart kam, würde er den Dicken immer noch irgendwie wiederfinden können, da musste er jetzt nicht die Schattenläufer scheu machen.
Von einer großen Zeltanlage aus sah Korbir ein Feuer brennen, wobei er sich fragte, was ein Feuer denn sonst tun sollte, als zu brennen. Auf diese Zeltanlage mitsamt Feuer jedenfalls steuerte der Blonde nun zu, und als Korbir und Rodlar ihm folgten, bemerkten sie rasch, dass sie in der Dorfküche gelandet sein mussten.
„Ihr werdet nach eurer Reise Hunger haben“, sagte der Blonde, der von Korbirs deftigem Riesenratteneintopf nichts ahnen konnte, da sich Rodlars Darmwinde mit der Zeit wieder beruhigt hatten.
„Ein Mittagsmahl wird euch gut tun. Währenddessen werde ich Shelak aufsuchen und ihm von eurem Besuch berichten, wenn er Zeit hat, wird er dann zu euch kommen.“
Der Blonde grinste und fügte dann noch hinzu: „Falls er nicht unterwegs aus dem Nichts von ein paar Schattenläufern angefallen wird.“
Nach diesen Worten und einem kleinen Kichern auf den Lippen ließ der Blonde die beiden zurück und verschwand hinter dem Küchenzelt, um in die Tiefen des Waldläuferdorfes zu gelangen. Korbirs Seitenblick auf Rodlar bestätigte ihm, dass der Hüne seine Lektion wohl vorerst gelernt hatte: Nicht einmal der Hauch eines spöttischen Lächelns lag auf seinen Zügen. Stattdessen zeigte er sich fast schon besorgt.
„Und wo sollen wir jetzt unser Mittagsmahl herbekommen? Etwa bei dem da?“
Rodlar deutete wenig diskret auf den Mann, der unter dem Zeltdach gerade vor einem großen Kessel gebeugt stand und sich seines feuchten Hustenanfalls nicht erwehren konnte oder wollte. Das Fett in den Haaren des alten, spindeldürren Mannes trat deutlich hervor, während er weiter angestrengt in einige der großen Töpfe neben dem Kessel hustete. Nein, dachte Korbir, der jedenfalls würde keinen guten Ersatz für Rodlar abgeben.
„Das glaube ich nicht“, meinte Korbir. „Schau dir doch nur an, wie dünn der ist. Das kann niemals der Koch sein! Der macht sicher nur… sauber, oder so.“
„Saubermachen nennst du das?“, fragte Rodlar entgeistert, der nicht viel Spaß verstand, wenn es ums Essen ging. „Der ist der Koch, ich sag’s dir, und der ist so dünn, weil diese Pampe, die er zubereitet, einfach nicht schmeckt.“
„Jetzt mal doch nicht direkt wieder den Beliar an die Wand“, versuchte Korbir ihn zu beruhigen und ging entschlossen auf den ausgemergelten Alten zu. Dieser zögerte keinen Moment, die Neuankömmlinge anzusprechen.
„Na, habta euch donnoch getraut?“, fragte er und entblößte eine einzige Zahnreihe, deren Bestandteile in den verschiedensten Gelb-, Braun-, Grau- und Schwarztönen schimmerten. Er war ein wenig schlecht zu verstehen, aber aus dem Zusammenhang konnten Korbir und Rodlar sich erschließen, was er meinte.
„Könnt euch nomma bisschen hinsetzen du, die Schlunzelsuppe brauch nohn bisschen… inna Ruhe liecht die Kraft, hömma… dat lassich mir au nich verbieten du.“
Etwas hilflos setzte sich Korbir an den kleinen Holztisch, auf den der vor Dünnheit fast auseinanderbrechende Koch mit seinem runzeligen Gichtfinger wies. Als Rodlar gegenüber von ihm auf einem kleinen Holzbänkchen Platz nahm, schien dieses unter der Last laut zu knacken. Ein Blick herüber zum Koch, der sich wieder dem Kessel und den Töpfen zugewandt hatte, zeigte jedoch, dass es lediglich dessen Genick war, das so laut geknackt hatte, während der Koch sich mit dem kleinen Finger das Ohr vom Schmalz gereinigt hatte, welches er nun als goldgelben Klumpen zum Abschmecken der vor sich hinköchelnden Suppe verwendete. Als er dann noch wie ein Ripper in den Kessel hineinschniefte, wurde es Rodlar zu viel.
„Du, Korbir… ich glaube, ich habe keinen Hunger mehr.“
„Mir egal“, schnauzte Korbir wenig begeistert zurück. „Hier wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und wir dürfen auf keinen Fall riskieren, Missfallen zu erregen, Rodlar. Ich bin kurz davor, endlich diese scheiß Tätowierung…“
„Entschuldigt, wenn ich störe“, ertönte plötzlich eine entzückende Frauenstimme, die von einer noch entzückenderen Frau kam, welche nun an ihrem Tisch stand. „Aber ich habe gehört, hier hört jemand schon die Schattenläufer knurren?“
Rodlar musste sich sichtlich ein Lachen verkneifen.
„Der da“, brachte er mit zusammengebissenen Zähne hervor und deutete auf Korbir, welcher wenig begeistert von diesem Gesprächsbeginn war, sich angesichts des Vorbaus der jungen Frau in Größe von kleinen Moleratbabys aber nicht offen unleidlich geben wollte. Deshalb nickte er zunächst freundlich und versuchte, sympathisch zu grinsen.
„Aber das ist wohl nicht der Fluch, den der Blonde erwähnte, nehme ich mal an?“
„Der Blonde?“, fragte Korbir erstaunt. „Ihr nennt den… also… ja, hat er denn keinen Namen?“
„Namen sind Schall und Rauch“, erklärte die Frau wissend und fuhr sich durch ihr ungewöhnlich langes, dunkles Haar. „Ich bin Nehemia. Freut mich, euch kennenzulernen.“
„Das ist Rodlar und ich bin Korbir“, erwiderte er, um seinem hünenhaften Kumpanen die Gesprächsführung so schnell wie möglich zu entziehen, bevor noch die Schattenläufer mit ihm durchgingen.
„Ich bin seit langem auf der Suche nach jemandem, der mich von einer gewissen Unnanehmlichkeit erlösen kann. Fluch ist vielleicht zu viel gesagt, ich möchte ja nicht aus einer Blutfliege einen Drachen machen. Aber ich habe diese Tätowierung… an einer Stelle, die, ähm… nicht ganz so passend ist und die ich gerade auch verdeckt halte. Und was ich auch tat und zu wem ich auch ging, niemand konnte sie entfernen. Deshalb ging ich in die Wälder, um euer Volk zu suchen. Vielleicht könnt ihr mich von dieser Tätowierung befreien.“
Nehemias Augen blitzten auf, und sie zwinkerte Korbir zu, als sie mit ihm sprach.
„Ach, so ist das… nun, Shelak hat mich ohnehin geschickt, damit ich ein wenig was über deinen „Fluch“ in Erfahrung bringe. Das klingt äußerst interessant… vielleicht sollten wir uns das nachher in meinem Zelt mal genauer angucken?“
Korbir zwang sich, jetzt nicht wieder aufgrund eines Anfalls zu Boden zu gehen wie ein getroffener Troll.
„Ja… ja, das wäre ziemlich toll“, hauchte er Nehemia zu, die seine Reaktion erfreut auffasste.
„Brennt dann aber ein bisschen.“ Korbir hörte schon gar nicht mehr richtig zu.
„Aber schön, dann machen wir das gleich so! Und nachher blas ich euch beiden dann noch schön einen“, flötete Nehemia. Korbir bekam irgendwie ein komisches Gefühl. Er wusste nicht warum, aber irgendwie hatte er den Feuerdrachen Feomathar im Hals. Vielleicht lag es daran, dass er tatsächlich drauf und dran war, wieder einen seiner abgefahrenen Erinnerungstrips zu bekommen, die mangels Erinnerung ja eigentlich gar nicht stattfinden durften. Vielleicht lag es aber auch einfach an der schönen Nase Nehemias, die
„Seid gegrüßt, da sind ja unsere beiden Neuankömmlinge!“, tönte eine Männerstimme, und als Korbir aufsah, erkannte er einen Mann mit grauen Haaren, die diesem auch ohne Wind ständig ins Gesicht wehten, was diesem angesichts seines Gesichtsausdrucks auch mächtig auf den Geist ging. Dennoch hatte sich der Naturmagier um eine freundliche Begrüßung bemüht, was Korbir, der immer noch ein innosfürchtiger Mann war, als äußerst tugendhaft bewertete.
„Vielen Dank, Nehemia“, sagte er zu der hübschen Heilerin, falls sie denn auch abseits ihrer sonstigen Vorzüge tatsächliche Heilkünste beherrschte, gewandt. „Den Rest übernehme ich.“
Etwas verwirrt ob der Tatsache, dass Nehemia ja noch überhaupt nichts gemacht hatte und der vom Druiden angesprochene „Rest“ daher nicht viel weniger sein konnte als das Ganze, verabschiedete Korbir sich von der spielerisch zwinkernden Nehemia, die dann ihrer Wege ging.
„Tut mir leid, dass ich euch warten ließ“, sagte der Druide dann, „aber an manchen Tagen ist hier einfach das Beliarreich los. Ich bin Shelak, der Druide hier. Ich darf euch in unserem Dorf willkommen heißen. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl hier.“
„Das ist Rodlar und ich bin Korbir“, sprach Korbir erneut über seinen Freund hinweg. „Ja, das ist ein nettes Dorf hier. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft.“
Während er sprach, musterte Korbir Shelak ein wenig. Er trug ein langes, grünes Gewand und in der rechten Hand einen langen, geraden, edelsteinbesetzten und von gelegentlichen Energieblitzen durchzuckten und surrenden Stab. Korbir fragte sich, ob dieser Stab vielleicht magische Kräfte besaß.
„Ich habe zu danken, und zwar für dieses Kompliment!“, entgegnete Shelak lächelnd. „Aber ihr habt anscheinend noch gar nichts zu essen bekommen, sehe ich das recht? Deshalb solltet ihr nicht die Morgendämmerung vor der Abenddämmerung loben. Das bringt sonst das Gleichgewicht durcheinander.“
Korbir überlegte einen Moment, was er darauf sagen sollte. Rodlar, der ein wenig beleidigt die Arme ineinander verschränkt hatte und schwieg, war ihm dabei keine besonders große Hilfe.
„Ihr scheint das Gleichgewicht ziemlich ernst zu nehmen, ähm… Sumpfgasdrohnenmann?“, meinte Korbir verwundert, aber ohne es böse zu meinen, als er glaubte, endlich das klobige Steinamulett um den Hals des Druiden korrekt gedeutet zu haben.
„Richtig“, räumte Shelak die offensichtlichen Restzweifel Korbirs an der richtigen Anrede aus, „ich bin in der Lage, mich in eine Sumpfgasdrohne zu verwandeln. Wenn ich das tue, nehmen zwar alle Reißaus vor mir, und seitdem tun das auch dann viele Leute, wenn ich mich gerade nicht in der Gestalt einer Sumpfgasdrohne befinde. Aber letzten Endes schätzen dann doch alle meine Sumpfgasdrohnenverwandlungskünste und meinen Anteil, den ich dadurch an unserer herrlichen Schlunzelsuppe habe. A propos…“
Er wandte sich zum Koch, der sich gerade von einer besonders blutigen Hustenattacke mitten in den Kessel erholte.
„Stanko, sind jetzt langsam mal drei Portionen fertig?“, rief er zu ihm herüber. „Und für mich bitte eine große, ich könnte einen ganzen Bluthund verdrücken!“
„Jou, allet klar, Chef“, kam es postwendend vom röchelnden Stanko zurück, der mit zitterigen Händen drei schmutzige Schüsseln mit einer widerwärtig aussehenden Pampe auffüllte.
„Ich möchte, dass ihr meine Gäste seid“, sagte Shelak nun wieder an Korbir und Rodlar gewandt. „Nehmen wir uns das Mittagessen mit in mein Zelt.“
Das Zelt Shelaks war leer. Und zwar vollkommen leer. Die kleine überdachte Fläche hätte mühelos Platz für ein Bett, einen Labortisch, vielleicht auch für eine Ecke zum Waschen und druidische Rituale gewährt. Doch stattdessen schützte die Zeltplane lediglich das unbeirrt wachsende Gras.
„Verzeiht die Unordnung“, bat Shelak, „aber mein Mittagessen nehme ich normalerweise immer direkt bei Stanko ein. Und das Frühstück und das Abendessen auch. Ebenso wie diverse Zwischenmahlzeiten. Zum Lesen setze ich mich immer in irgendwelche Feuernesseln, da bleibt man frisch und munter. Zum Experimentieren hingegen suche ich mir meist irgendeine andere Hütte oder ein Zelt, dessen Besitzer gerade nicht da ist. Diese Ogersauereien, die dabei manchmal entstehen, die will ich ja nicht bei mir im Hause haben.“
„Und wo schläfst du?“, fragte Korbir ungläubig.
„Na bei Nehemia, wo denn sonst?“, fragte Shelak mindestens ebenso voller Unglauben zurück. „Nehemia ist für alle da.“
Abermals wusste Korbir nicht so recht, was er sagen sollte, wurde aber dankbarerweise von Shelak erlöst.
„Wie auch immer“, sagte der Druide, „nehmt doch ruhig auf dem Boden Platz und fühlt euch wie zu Hause.“
Gesagt getan, befanden sich die drei wenige Augenblicke später sitzend auf dem weichen Gras. Während Shelak still über seiner Schüssel saß und mit geschlossenen Augen einige Worte zu murmeln schien, pikste Rodlar bereits mit einem Finger in seiner Portion herum. Die Schlunzelsuppe roch noch schlimmer, als sie aussah.
„Mensch Rodlar“, fauchte Korbir seinen Geradenochso-Freund an, „siehst du denn nicht, dass er betet? Du solltest damit warten, bis er fertig ist!“
Schuldbewusst zog Rodlar seinen Finger wieder aus der glibberigen Masse heraus, die stinkend in ihre ursprüngliche Form zurückschwabbelte.
„Ach Korbir, du weißt doch“, murrte Rodlar resigniert, „so ne Höflichkeitssachen, das sind für mich doch Sildensche Dörfer.“
Der Druide hatte das in normaler Lautstärke geführte Gespräch der beiden bestimmt nicht bemerkt, und so öffnete er die Augen erst wieder, als es wieder still war.
„Dann lasst es euch munden“, sprach er in die kleine Runde.
Missmutig starrten Korbir und Rodlar abwechselnd sich selbst und dann ihre Schüsseln an. Shelak hingegen stopfte sich seine Ogerportion glücklich mit den bloßen Händen in den Mund, wobei es ab und an ein Schleimpropfen nicht vollständig in die Mundhöhle schaffte und über sein Kinn hinweg auf den Boden abgesondert wurde. Je mehr der Druide in seiner Schüssel wühlte, desto mehr verbreitete sich der Gestank, sodass bei seinen beiden Gästen jeder Versuch, sich die Schlunzelsuppe überhaupt zum Munde zu führen, im Keim erstickt war.
Ein vorsichtiges Rütteln am Zelteingang riss Shelak aus seinem Fressrausch.
„Herein, wer immer der Störenfried auch sei“, sprach er an den Eingang gewandt, während er sich einige Reste Schlunzelsuppe mit Hilfe seines Druidengewands vom Mund abwischte. Der Zelteingang wurde von außen geöffnet und ein bärtiger Mann mit bloß einer knappen Hose bekleidet und in verdreckten Stiefeln trat ein.
„Auf ein Wort, Druide!“
Shelak erhob sich augenblicklich und bewegte sich zum Zelteingang. Das weckte Korbirs und Rodlars Aufmerksamkeit, welche den unbeobachteten Moment nutzten, um ihre beiden Schüsseln unter der Zeltplane an der Seite des Zelts hindurchzuschieben und dort vollständig zu entleeren. Dann konzentrierten sie sich auf das Gespräch zwischen Shelak und dem Waldläufer. Ihre Lauscher waren gespitzt wie die Zähne eines Säbelzahntigers.
„…hat dennoch gespritzt… aber… fantastische…“, erklärte der bärtige Jäger lang und breit. „… auf jeden Fall mal so richtig durch… keine… aber ohne… verträgt noch einiges, die kleine…“, fügte er noch hinzu. „… elche vom andern… ruhig… Schwänze desto besser“, schien er dann zu enden, setzte aber unverhofft noch einmal nach. „at… richtig geil… itten wie Milchfässer… mal gek…“
Als er definitiv geendet hatte und schmierig dreinblickte, legte Shelak sich eine Hand auf den Schritt und erwiderte etwas, jedoch war der Druide nicht ganz so gut darin, seine Worte leise hervorzubringen.
„Klingt ziemlich geil, mein Schwengel könnt’ auch mal wieder ’ne enge F.otze vertragen. Hab’ auch gerade erst meine Eier frisch rasiert, und die sind langsam dick wie so ein Beutel Schnapsbeeren. Sagt mir nachher Bescheid, ich scavenger die dann dermaßen durch, dass sie drei Wochen lang weder gehen noch sitzen kann, das kleine Schluckluder.“ Mehr bekamen Korbir und Rodlar nicht mit. Schließlich nickte der Waldläufer und verließ das Zelt wieder.
„Verzeiht“, meinte Shelak, als er wiederkam, „aber es ging um wichtige Angelegenheiten betreffend das Gleichgewicht.“
Sein Blick fiel auf die Schlunzelsuppenschüsseln von Rodlar und Korbir.
„Oh, ihr habt ja schon aufgegessen!“, sagte er erfreut. „Hat geschmeckt, was?“
Die beiden nickten pflichtbewusst.
„Gut, dann gibt es auch keinen Grund mehr, noch länger hier drin zu verweilen“, beschied Shelak. „Korbir, ich habe dein Gespräch mit Nehemia ein wenig mitgehört, und bin daher schon etwas im Bilde. Es geht um eine Tätowierung?“
Korbir nickte abermals.
„Es ist eine Tätowierung, die ich nun schon lange habe und deren Ursprung mir nicht ganz klar ist. Sie ist an einer… unangenehmen Stelle. Ich möchte, dass sie mir endlich jemand entfernt.“
Shelak stopfte sich den letzten Rest seiner Schlunzelsuppe in den Mund und erwiderte schmatzend: „Mch denke, ch künn dir häfn“. Endlich schluckte er runter.
„Es gibt Rituale in unserem Volk, die derartige Male entfernen können. Diese Rituale allerdings haben öffentlich auf dem Ritualplatz stattzufinden, und das gesamte Dorfvolk soll Zeuge sein! Ich werde dafür sorgen, dass alle erforderlichen Vorbereitungen getroffen werden.“
Shelak klopfte Korbir im Vorbeigehen auf die Schulter, und hinterließ dabei einige stinkende Klumpen seiner Schlunzelsuppe.
„Keine Sorge“, meinte er, „in ein paar Stunden bist du deine Tätowierung los.“
Korbir schluckte. Feomathar war in seinen Hals zurückgekehrt, und er hatte zu allem Übel auch noch Feodaron mitgebracht.
Korbir und Rodlar, welcher zusammen mit den Waldläufern außerhalb des Ritualkreises in der Mitte des Dorfplatzes stand, staunten nicht schlecht: Dass das beschauliche Waldläuferdorf derart viele Einwohner beherbergte, hatten sie auf ihrem Hinweg nicht gedacht. Nun aber drängten sich die alternativ gekleideten Männer, Frauen und Zwischendinger geradezu wie hungrige Fleischwanzen um den in den Boden eingeritzten Kreis, in dessen Zentrum wiederum Korbir und Shelak standen, letzterer mit seinem langen Stab in der Hand. Der Druide hatte ihm noch einige Anweisungen für das Ritual gegeben, die ihn sichtlich überfordert hatten, sodass Shelak das anvisierte Programm auf ein auch für Korbir verständliches Mindestmaß heruntergefahren hatte, welches darin bestehen sollte, dass Korbir auf ein bestimmtes Stichwort hin seine Tätowierung entblößen sollte, damit Shelak sie mithilfe seines Stabs unter der brennenden Nachmittagssonne entfernen möge. Korbir war sich nicht ganz sicher, ob sich der Druide im Klaren darüber war, wie das Entblößen dieser furchtbaren Tätowierung ganz konkret aussehen würde, doch nun war ohnehin alles zu spät. Hätte er das Ritual jetzt noch abgeblasen, das ungeduldige Publikum wäre wohl über ihn hergefallen wie eine Horde Snapper.
Shelak wandte sich noch mit ein paar druidisch-ritualisierenden Worten an die Umstehenden, die vom Gleichgewicht, Sumpfgasdrohen, dem Gleichgewicht, Schlunzelsuppe, dem Gleichgewicht und irgendwelchen Milchfässern handelten, doch Korbir hörte gar nicht so genau hin. In seinen Gedanken war er schon in dem Moment, in dem sich entscheiden würde, ob er diese demütigende Tätowierung endlich los würde. Ob das Ende seiner Reise erreicht war. Ob das Waldvolk ihm helfen konnte.
„…und deshalb sage ich nun…“, hörte Korbir nun wieder deutlich Shelaks Stimme und bereitete sich auf seinen Einsatz vor, „…präsentiere der Sonne des Nachmittags dein Mal!“
Feomathar und Feodaron hatten Kinder bekommen, doch Korbir konnte jetzt nicht kneifen. Die Spannung knisterte förmlich in der Luft, als er sich langsam mit dem Rücken zu Shelak drehte. Niemand sagte auch nur ein Wort. Es war still wie in einem verlassenen Nautilusgehäuse, was auch immer so eine Nautilus denn sein sollte, wie sich Korbir heute schon zum zweiten Mal fragen musste. Er holte noch einmal tief Luft. Dann zog er sich mit einem Ruck die Hose herunter.
Im selben Moment hatte Korbir unwillkürlich die Augen geschlossen, sodass er nur erahnen konnte, was bei Shelak und den Umstehenden nun vor sich ging. Die Stille jedenfalls dauerte weiter an, lediglich ein gemeinsames Nachluftschnappen hatte Korbir vernehmen können. Dann, nach einer quälend langen Weile, hörte er eine laute, vertraute Stimme.
„Ein Gespiele nur noch fehlt,
doch schon gefunden, dich erwählt!
Denn am Hexenarsch, am Hexenarsch,
da hat ein jeder mächtig Spaß!“
Korbir schlug die Augen auf und drehte sich mit entblößtem Hintern im Kreis, bis er endlich Rodlar gefunden hatte. Dann schließlich brandete ein Gelächter auf, wie Korbir es noch nicht einmal bei den volltrunkenen Knarzenden Paladinen erlebt hatte. Ein Johlen und Tosen erfüllte den gesamten Dorfplatz, und Korbir musste hilflos mit ansehen, wie sich dutzende von grün gewandeten Gestalten vor Lachen nur so krümmten.
„Für Innos!“, rief eine Männerstimme. „Auf seinen Arsch ist ’Für Innos!’ eintätowiert, ich kann nicht mehr!“
„Tut mir leid, Korbir“, brüllte Rodlar über die vollkommen austickenden Waldläufer hinweg, „Aber jetzt, wo ich das wieder sah, ist mir die letzte Strophe eingefallen, und da konnte ich einfach nicht anders. Bevor ich es wieder vergesse, ne… man soll die Schlunzelsuppe löffeln, solange sie noch heiß ist, hat man mir hier beigebracht!“
„Für Innos!“, grölte ein weiterer Mann dazwischen, und Korbir glühte innerlich wie äußerlich, als die auf seinen Hintern in großen Lettern eintätowierte Parole nun stoßweise immer wieder von den Umstehenden wiederholt wurde, gespickt von weiteren Rufen, die an seiner Würde erheblich kratzten.
„Na, der hat ja Feuer unterm Hintern!“, gellte eine Frauenstimme hindurch, was die anderen nur noch mehr anfachte. Hilflos sah Korbir zu Shelak, der sich jedoch offensichtlich weniger für die Tätowierung, sondern vielmehr für den halbnackten Körper an sich zu interessieren schien.
„Waren wahrscheinlich seine ominösen Schattenläufer, die ihm das unbemerkt da reingehackt haben!“, erschallte ein weiterer Ruf.
Spätestens jetzt reichte es Korbir. Der Trél war endgültig überschritten.
„SCHLUSS JETZT!“, brüllte er wie ein orkischer Berserker über die Menge hinweg, die erschrocken innehielt. Nach wie vor starrten ihn alle an, doch richteten sich ihre Blicke nun in seine wutentbrannten Augen, als er erneut die Stimme erhob.
„Ja, es ist ja wirklich gut jetzt“, rief Korbir, der heute nun schon zum wiederholten Male das Opfer ziemlich gemeinen Spotts geworden war, was ihn so langsam fuchtsbeliarswild machte. „Ich weiß nicht, woher diese Tätowierung kommt, na und? Ich kann es nur erahnen. Sie wird irgendwie im Suff entstanden sein, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur noch, wie jemand meinte, er wolle sein neues Tätowierbesteck ausprobieren, und dann… kompletter Theaterriss. Wir waren halt betrunken, meine Güte! Ach, was sag ich… voll wie zehn Nordmänner! Jenseits von Innos und Beliar! Und dann ist es eben passiert. Und deshalb kann ich mich auch an nichts mehr erinnern. Dieser Nebel in meinem Kopf, er ist einfach der Dunst verflossener Branntweine.“
Korbir zog seine Hose nun wieder hoch, prüfte, ob sie richtig saß und stapfte energisch aus dem Ritualkreis heraus an Rodlar vorbei – mitnehmen wollte er den Hünen nicht mehr. Mit dieser Aktion war er zu weit gegangen. Es gab genug dicke Kumpel auf dieser Welt, da brauchte sich Korbir wirklich nicht auf so einen verlassen.
„Wisst ihr was?“, setzte Korbir erneut an. „Wenn ihr mich nicht helfen sondern mich nur auslachen wollt, dann kann ich auch direkt wieder gehen. Und übrigens: Euren scheiß Weg hier könntet ihr auch mal anständig jäten, das sieht ja aus wie Sumpfkraut und Feldrüben hier!“
Erneut schnappte die Menge nach Luft, diesmal aber mit einem deutlich aggressiveren Unterton. Auch Korbir verstummte daraufhin und besah sich den Untergrund, auf dem er lief. Offentlich war er gar nicht auf einem Weg, sondern auf einem vom Dorfvolk angelegten Beet herumgetrampelt, was ihn aber auch nicht besonders beeindruckte.
„Jetzt macht euch mal nicht ins Wams“, polterte er, „wegen so ein paar rumwuchender Orkblätter hier. Schafft hier mal ein bisschen Ordnung, Leute! Das sieht hier bei euch im Dorf sowieso alles aus wie bei Plescotts unterm Sofa, ey!“
Aus der Menge kam Shelak hervor, der auf einmal doppelt so groß wirkte wie noch zuvor. Rasch erkannte Korbir, woran dieses seltsame Größenwachstum lag: Shelak balancierte mittig auf seinem Druidenstab, der wiederum von zwei Waldläufern auf den Schultern getragen wurde.
„Sprich nicht so vorlaut, wenn du rein gar nichts verstanden hast!“, erhob Shelak seine Stimme im Befehlston. Es klang, als sprächen Blitz und Donner und es war das erste Mal, dass er den Druiden wirklich ärgerlich erlebte, was ihm gerade aber ziemlich am tätowierten Allerwertesten vorbei ging.
„Du stehst gerade auf unseren heiligen Ork-Mulu-Blättern, aus denen wir unser Ork-Mulu-Getränk machen! Oh Unglückseliger, das Gleichgewicht soll dich richten!“
Shelak bedeutete seinen Trägern, ihn durch das Beet hinweg auf Korbir hinzu zu tragen, aber stolperte bereits am Rande der Bepflanzung jämmerlich, um schließlich unter der strengen Beobachtung aller Anwesenden von seinem Stab herunter in den Staub zu krachen.
„Ist das etwa dein Gleichgewicht?“, entfuhr es Korbir laut und er zeigte dabei auf den Gefallenen, ungeachtet der Tatsache, dass an jenem bereits ein grünliches Glühen entfacht war, welches die Dorfbewohner interessiert beobachteten. Korbir befürchtete einen beliarischen Zauber, den er mit einem schnellen Griff zum am Boden liegenden Stab wenige Meter vor ihm zu unterbrechen gedachte. Als er ihn in der Hand trug, erkannte er aber, dass das Glühen etwa nicht aus der Magie des Stabs, sondern der Kraft des druidischen Amuletts entstammte. Das konnte nur eines bedeuten…
„Weg hier!“, rief plötzlich einer der Waldläufer und stürmte mit zugehaltener Nase davon. Kaum einen Augenblick später taten es ihm seine Mitbewohner gleich, sodass sich nach kurzer, halsbrecherischer Flucht – auch Rodlar hatte sich verdrückt – nur noch Shelak und Korbir gegenüberstanden.
„Das wirst du bitter bereuen“, knurrte Shelak, als er sich wieder aufrappelte. Blitzschnell griff er an sein Amulett, woraufhin das grünliche Glühen zu einem wahren grünen Gleißen anwuchs, welches Korbir für einen kurzen Moment die Sicht nahm. Als seine Augen wieder etwas von der Umwelt wahrnahmen, hatte ihm seine Nase schon längst verraten, was nun vor ihm schwebte: Eine Sumpfgasdrohne von überdimensionalen Ausmaßen.
Das Surren, dass dieses Monstrum an Sumpfgasdrohne aussandte, fühlte sich unter Korbirs Füßen wie ein Erdbeben an. Nach einigem Geschwebe schoss Shelak in Gestalt der Drohne mit ungeahnter Geschwindigkeit auf ihn zu.
„Warte nur ab“, murmelte Korbir, „dir zeige ich schon, wo der Troll die Hauer hat.“
Was dann geschah, hatte Korbir nur noch seinen säbelzahntigerartigen Reflexen zu verdanken, zumindest denen, die er noch nicht irgendwann einmal kaputtgesoffen hatte. Er fasste den Druidenstab fest in der Hand, holte weit aus und schleuderte ihn wie einen Speer direkt auf die herannahende Sumpfgasdrohne zu.
Und was daraufhin wiederum passierte, ging in einem beliarischen Gemisch aus flatschenden, knallenden und knackenden Geräuschen sowie beißenden, moderigen und atemberaubenden Gestankswolken unter. Die Sicht Korbirs wurde von einer wahren Welle an schleimiger Brühe und propfigen Klumpen versperrt, die nun nach und nach und gar nicht enden wollend aus dem aufgeplatzten Körper der Sumpfgasdrohne, die einst Shelak war, herausquollen und das komplette Dorf einwildsauten. Kein Zelt, keine Hütte blieb unbespritzt, und am allerschlimmsten hatte es das Ork-Mulu-Beet getroffen. Korbir, der entkräftet von der Auseinandersetzung und der schwächenden Wirkung des auch ihm anhaftenden Drohnenschleims zu Boden sank, fühlte sich, als würde er sich ein Moor senken. Von den einzelnen Blättern der Genusspflanzen war kaum noch etwas zu erkennen.
„Sieht ganz so aus“, keuchte Korbir triumphierend, „als müsstet ihr fürs Erste auf euren Ork-Mulu-Kram verzichten… aber dafür habt ihr jetzt mehr Schlunzelsuppe, als ihr je fressen könnt.“
„So, das wär’s dann“, murmelte Korbir zu sich selbst, als er dem unförmigen Fleischhaufen vor sich einen festen Tritt verpasste, sodass dieser zunächst langsam, dann immer schneller werdend den hohen Berg hinunterrollte.
Korbir setzte ein paar letzte Nadelstiche und zog ein paar letzte Fäden, dann war sein neues Zelt endlich fertig. Das alte hatte immer noch Rodlar, doch diesen hatte er im nun druidenlosen Walddorf zurückgelassen. Auf ihn und das Zelt konnte er verzichten. Glücklicherweise hatte er noch den toten Körper des furchtbaren Hermanns an der Weggabelung vorgefunden, und sich sogleich an die Arbeit gemacht. Das Ergebnis seiner Mühen trug er jetzt – wie einst Rodlar das alten Zelt – zusammengerollt auf seinem Rücken.
Ein wenig enttäuscht war er schon, dass er von Shelak nicht die Hilfe bekommen hatte, die er sich erhofft hatte. Seine Reise war offenbar doch noch lange nicht zu Ende. Aber, so dachte er sich, mühsam nährt sich der Goblin. So war es, und so würde es wohl auch immer bleiben. Zum Glück war er ein Mensch, sodass er vielleicht nicht ganz so mühsam auf sein Ziel hinarbeiten musste. Diese Hoffnung wurde bestätigt, als Korbir, gerade als er den Bergweg hinauf zum Gipfel gehen wollte, von einer Stimme angehalten wurde.
„He, warte auf mich!“
Ein Scheppern von Tiegeln, Töpfen, Säcken und weiteren um den Bauch gehängten Vorräten kündigte den heranrennenden Mann bereits aus der Ferne an. Noch bevor er das Plateau erreicht hatte, hatte Korbir ihn schon erkannt: Es war der dicke Schütze. Als er bei Korbir angelangt war, schnaufte er schwer und musste sich erst einmal selbst auf seinen Oberschenkeln stützen. Korbir ließ ihm eine kleine Erholungspause, bevor er fragte: „Nanu? Gefällt dir dein Dorf etwa nicht mehr?“
Der Schütze sah auf, seine Augen waren vor der Anstrengung etwas hervorgequollen.
„Jetzt wo es so eingewildschweint ist, sowieso nicht“, keuchte er. „Aber auch so… so richtig wohlgefühlt habe ich mich da ja doch nicht… außerdem will ich mal etwas anderes sehen als immer nur das Dorf und den Wald. Und da dachte ich, da du ja nun deine Reise doch noch fortsetzen musst und deinen Kumpel bei uns zurückgelassen hast, dass ich… also, wenn es dir nichts ausmacht, natürlich, ich will mich nicht aufdrängen, nicht dass du…“
„Ist gewasserpfeift“, erlöste Korbir den Schützen und streckte seine Hand aus. „Ich bin Korbir.“
Freudestrahlend, aber immer noch schnaufend, ergriff der Dicke sie.
„Ich weiß, ich weiß“, sagte er. „Ich bin Garbrod.“
„Gut, Garbrod“, sprach Korbir, der bei der Neuaufnahme von Reisegefährten schon so etwas wie ein Routinier war, „dann könntest du dich direkt nützlich machen, und mir das hier abnehmen, du bist ja ein wenig stabiler als ich, dachte ich mir…“
„Kein Problem, kein Problem“, beschwichtigte Garbrod und riss Korbir das Zelt, welches er wieder von seinem Rücken gelöst hatte, förmlich aus der Hand, um es sich mit Hilfe eines kleinen Bandes auch noch um seinen Leib zu binden. Korbir musterte ihn dabei. Garbrod schien immerhin deutlich weniger quengelig zu sein, als Rodlar es gewesen war. Vielleicht war das tatsächlich der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
„Ich dachte mir“, weihte Korbir seinen neuen dicken Gefährten in seine Pläne ein, „wir könnten erst einmal bis nach oben auf den Gipfel gehen, um uns einen Überblick über die Gegend zu verschaffen. Wer weiß, vielleicht kommt mir dann eine Idee, wo wir als nächstes hinreisen könnten.“
„Alles was du willst, alles was du willst“, kommentierte Garbrod grinsend. Dann hielt er kurz inne, und ein nachdenklicherer Ausdruck schlich sich in sein Gesicht.
„Aber sag mal…“
„Ja?“
„Wo hast du eigentlich auf die Schnelle das neue Zelt herbekommen?“
Korbir lächelte.
„Weißt du“, sagte er, „auch gute Freunde müssen gewisse Geheimnisse voreinander haben.“
Geändert von John Irenicus (19.01.2021 um 20:08 Uhr)
-
Mist.
Er hatte mal wieder einen, vielleicht aber auch zwei oder drei über den Durst getrunken sowie eine definierte, aber nicht ermittelbare Menge unter den Hunger gegessen. Wer Lungenbrot hatte, der buk keine Brötchen mehr. Außerdem knallte der Schnaps dann besonders.
Mit heftigen Kopfschmerzen ließ The Big R, wie er sich seit seinen Heldentaten nur noch nennen ließ, seine Hand auf die braunen Zampanozigarren fallen, die zwischen den halbleeren bis leeren Glasfläschchen auf seinem Nachttisch wahllos verstreut lagen. Hier kam nicht einmal das pralle Sonnenlicht hin, denn das hielt er mit den heruntergelassenen Rollos erfolgreich aus seinem kleinen Zimmer fern.
Endlich hatte The Big R eine der Zampanozigarren zu fassen bekommen, schob sie sich mit zitternden Händen in seinen Mund und wartete darauf, dass ihm das Fernfeuerzeug aus einer der Zimmerecken in die geöffnete Hand sprang. Er konnte sich an nicht mehr viel aus der letzten Nacht erinnern, wohl aber daran, dass er es kurz vor dem Einschlafen noch achtlos irgendwo hingeworfen hatte. Das hatte er die ganzen letzten Monate mit seinen Feuerzeugen so gemacht, war es dann aber irgendwann leid gewesen, deshalb morgens nie eines davon zur Hand zu haben. Glücklicherweise hatte er es geschafft, seinen alten Bekannten, Privatdozent Doktor Ziben Zuben, zur Entwicklung des Fernfeuerzeugs zu nötigen. Ein hochkomplexes technisches Gerät, welches, ähnlich einer Fernbedienung, getreu dem Namen immer fern war, seinem Eigentümer dafür aber sofort in die Hand sprang, wenn man es brauchte. Und The Big R brauchte es jetzt, und zwar zum Anzünden seiner Zampanozigarre. Ohne waren weder Staat noch Morgen zu machen.
Es dauerte ein wenig, dann aber ertönte ein mechanisches Surren, und schon im nächsten Augenblick war das Fernfeuerzeug in seiner Hand gelandet. Er klappte es auf und ließ die Flamme erscheinen, mit der er die Zampanozigarre ansteckte. Er zog ein paar Male und paffte dann genüsslich, sah dabei zu, wie die blau glühenden Rauchringe Szenen vergangener Heldentaten abbildeten. Jetzt fühlte The Big R sich wieder angemessen groß. Die Zampanozigarren waren eine Erfindung von Zibens gescheitertem Kollegen Baalbert Tondral, der nach abgebrochener akademischer Karriere im wahrsten Sinne des Wortes in einen Sumpf geraten war, sich dort aber alchemistische Fähigkeiten angeeignet hatte, für deren korrekte Bewertung es nicht einmal einen passenden Begriff gab. Baalbert war geradezu ein Guru, wenn es um Substanzen aller Art ging. The Big R hatte zwar noch nicht alles aus Baalberts Sortiment ausprobiert – was er natürlich vorhatte – aber nachdem er zum ersten Mal in den Genuss einer Zampanozigarre gekommen war, war er sich eigentlich sicher gewesen, dass Baalbert diese Kreation nicht würde toppen können. Im Tabak waren neben dem obligatorischen Sumpfkrautanteil auch einige Brösel magisches Erz verarbeitet, die das Wohlgefühl durch die wandernden Rauchringe auf magische Weise erst möglich machen. Genau diesen Rauchringen sah The Big R gerade versonnen nach, wie sie Momente aus seiner vergangenen aktiven Zeit nachbildeten, gerade die Szene, in der er, The Big R – damals noch unter seinem bürgerlichen Vornamen bekannt – im Alleingang auf den Schwingen seines Gleiters, eine Pistole in der linken Hand, seinem Multifunktionsschwert in der rechten Hand und dem legendären Uriziel mit dem Knauf in sein Ohr gesteckt auf eine Rotte Roboratten herabfuhr, um sie der Reihe nach außer Gefecht zu setzen. Wenn The Big R sich genauer erinnerte und ehrlich war, dann war er zu diesen Zeiten eigentlich schon auf dem absteigenden Ast gewesen, wenn er sich als derartiger Kammerjäger hatte verdingen müssen, aber es war immerhin noch seine aktive Zeit gewesen und die Leute hatten ihn auch dafür noch verehrt. Er seufzte. Das alles schien schon so lange her.
„Krieg ich auch eine?“, ertönte plötzlich eine Frauenstimme von links neben ihm im Bett. Er schrak kurz hoch, zog dabei ungünstig Luft ein und fing an zu husten, die Zampanozigarre dabei fast aus dem Mund spuckend.
„Erschreck mich doch nicht so“, brachte er unter dem langsam abklingenden Husten hervor. „Ich wusste gar nicht mehr, dass du noch da bist. Ich dachte, du wärst schon wieder weg.“
„Bin ich ja offensichtlich nicht“, erwiderte die Frauenstimme. „Also, was ist? Krieg ich auch eine?“
„Das geht nicht“, wurde The Big R ruhig und ernst, ohne sich zu der Frau umzudrehen. „Rauchen ist gesundheitsschädlich. Es kann sogar tödlich sein! Ich kann es einfach nicht zulassen, dich in diese Gefahr zu bringen!“
„Achso, aber Abusymbel kannst du in diese Gefahr bringen, oder wie?“, wandte die Frau empört ein. „Ich habe es doch genau gesehen, wie du ihm gestern Abend in der Drängeldisco eine Zigarre nach der anderen gereicht hast! Und der Kerl ist mittlerweile über siebzig, hat einen Lungenflügel herausoperiert bekommen und ist an eine mobile Sauerstoffzufuhr angeschlossen, um überhaupt noch atmen zu können! Bei ihm ist das alles in Ordnung, aber bei mir nicht, oder was?“
„Das war aber nicht Abusymbel. Abusymbel ist der Südländer. Der, den du meinst, heißt Hagen.“
The Big R drückte seine Zampanozigarre auf dem Bettlaken aus, er hatte genug. Wenn jemand dazwischenquatschte, machte das Resümieren der eigenen Glanztaten einfach keinen Spaß. Er wandte sich genervt zu der Frau um.
„Davon abgesehen ist es bei dir halt was anderes, Rita. Du bist eben eine Frau.“
„Falsch“, sagte die Frau, was The Big R derart erschreckte, dass er sich mit einem Ruck aufsetzte. Das löste einen erneuten Schock in ihm aus, denn für einen Moment glaubte er, mit dieser unbedachten Bewegung einen riesigen Fehler gemacht zu haben, und steckte sich deshalb bereits panisch die Finger in die Ohren, in Erwartung eines gewaltigen, unerwünschten Feuerwerks. Nachdem das aber ausblieb, erinnerte er sich wieder daran, dass er das Böllerbett seit einiger Zeit nicht mehr nachgeladen hatte. Zibens Erfindung, mit der The Big R an verkaterten Tagen schneller aus dem Bett kommen sollte, hatte sich schließlich als echter Flop erwiesen. So hatte The Big R nun doch noch Gelegenheit, sich auf das zu besinnen, was ihn eigentlich überhaupt erst so in Aufruhr versetzt hatte.
„Wie meinst du das, ’falsch’?“, fragte er die Person neben sich. „Soll das heißen, du bist etwa gar keine Frau?“
„Doch“, antwortete diese amüsiert. „Aber so sehr scheinst du das ja nicht zu schätzen wissen, wenn du dir da nicht einmal sicher bist. Nein, ich meine, ich heiße nicht Rita. Das habe ich dir aber auch schon einmal gesagt.“
„Achso, ja, wie auch immer“, sagte The Big R augenblicklich beruhigt und ließ sich wieder ins deaktivierte Böllerbett sinken. Jetzt bereute er, dass er seine Zampanozigarre so schnell wieder ausgedrückt hatte. „Aber so etwas kann ich mir nun wirklich nicht mehr merken. Ich meine, ich habe in jeder Stadt eine Freundin – alle in Sicherheit, versteht sich – da kommt man schon einmal durcheinander. Ich habe Ziben ja bereits nach einem Erinnerungsedelstein für mein Augmentierarmband gefragt, aber bisher ist da außer jede Menge Schnack von ihm nichts bei herumgekommen. Ist also nicht meine Schuld!“
Die Frau neben ihm – ihr Name würde wohl nicht mehr in The Big R’s Erinnerung zurückkehren – seufzte resigniert. Als sie sich aufsetzte, erkannte The Big R, dass sie nackt war. Er hatte es also immer noch drauf – wenn eben auch nicht mehr im Gedächtnis.
„Du hast dich ganz schön verändert, oder?“, fragte die junge Frau.
„Wie meinst du das?“
„Naja, verglichen mit der Zeit, als du noch der Held des ganzen Reiches warst.“
„Aber der bin ich doch immer noch!“, wandte The Big R ein. „Sie nennen mich schließlich ’The Big R’, schon vergessen?“
„Vor allem du nennst dich so“, sagte die Frau und verdrehte dabei ihre Augen, was The Big R nur deshalb sehen konnte, weil das Zimmer langsam von den Leuchtlamellen erhellt wurde, die an der Innenseite der Fenster angebracht waren und immer dann aktiviert wurden, wenn sie innerhalb eines Zeitfensters von fünf Minuten genug menschliche Worte wahrnahmen und davon ausgehen mussten, dass jemand wach war und Licht benötigte.
„Ich meine außerdem die Zeit, indem du eben noch aktiver Superheld warst“, fuhr die Frau fort. „Als du noch jung, fit, aktiv, edelmütig und was weiß ich nicht alles warst. Und jetzt? Sieh dich an! Im Grunde bist du doch nur noch ein Schatten deiner selbst.“
„Wie kommst du denn auf sowas?“, fragte The Big R mehr verwundert als beleidigt. „Was ist denn falsch mit mir?“
Das junge Fräulein stemmte die Arme in die Hüften, wie, um sich bei der anstehenden Tirade noch zusätzlich zu stützen, damit auch alles so herüberkam, wie es gemeint war.
„Du säufst, rauchst und nimmst sonstige Drogen. Du hängst bis nachmittags in deinem Bett herum und verlässt dein Haus eigentlich nur, um eben ein paar Sachen beim Lebensmitteldiscounter zu holen oder eben am Abend in einen Club zu gehen, um junge Dinger aufzureißen.“
„Naja“, konterte The Big R, „hat bei dir ja auch geklappt.“
„Ja“, gab die Frau wiederum unumwunden zu. „Aber da wusste ich ja auch noch nicht so richtig, wie es um ’The Big R’ wirklich bestellt ist. Dass unser Nationalheld eigentlich nur noch ein längst verblasstes Märchen ist. Ich sage mal so: So big ist er nun wirklich nicht. Und unter einem Ionenbums hatte ich mir eigentlich auch etwas… anderes vorgestellt.“
The Big R wollte zu einer Erwiderung ansetzen, wurde dann aber von einem lauten vibrierenden Geräusch unterbrochen. Es dauerte eine Weile, bis er es zwischen den leeren Flaschen – von denen er ein paar beim Tasten umstieß – und dem sonstigen Gerümpel auf seinem Nachttisch fand, aber schließlich fiel ihm sein Heldenhandy doch noch in die Hände. Das blau leuchtende Display erhellte die Umrisse des Gerätes, die in etwa die Umrisse der Insel Khorinis waren – nur eben kleiner. Man hatte ihm dieses Handy damals überreicht, als er Khorinis zum wievielten Mal auch immer vor der xten Verbrecherbande gerettet hatte, nur damit die Perle der See wieder in eine Strafgefangenenkolonie umgewandelt werden konnte. Dafür war man ihm derart dankbar gewesen, dass man ihm dieses formschöne Handy zusammengebaut hatte – natürlich vor allem, damit er auch alle weiteren Hilfegesuche möglichst schnell und direkt annehmen konnte. Khorinis hatte nämlich ab diesem Zeitpunkt seine Polizei, das Militär, die Feuerwehr und schließlich auch die Traditionsgleitfliegerstaffel dichtgemacht und all diese Aufgaben auf The Big R outgesourced, wie es so schön geheißen hatte. Das war tatsächlich auch ein paar Monate lang gut gegangen, bis The Big R versehentlich versucht hatte, mit einem ausrangierten, ihm überlassenen Funkgerät der Polizei ein elektromagnetisches Impulsgewehr anzutreiben, mit dem er einer schwangeren Frau in einem brennenden Haus einen Kaiserschnitt hatte verpassen wollen. Die Stadtväter von Khorinis hatten mit der Presse zwar noch aushandeln können, nicht über den unglücklichen Ausgang dieses Ereignisses zu berichten. The Big R aber war ab da nicht mehr als Vorzeigedienstleister der Kommune zu halten gewesen, sodass ihre public private partnership ein jähes Ende gefunden hatte. Das Heldenhandy hatte The Big R zwar behalten dürfen, heutzutage aber benutzte er es höchstens noch, um gelegentlich eine Pizza zu bestellen oder die verpassten Gelegenheiten einer Clubnacht am nächsten Morgen noch einmal anzurufen. Zumindest war das bis zu eben diesem Moment so gewesen, in dem The Big R sich gerade befand, während er den unbekannten Anruf entgegennahm.
„Ja?“, fragte er, freilich ohne seinen Namen zu nennen, den ohnehin jeder kennen sollte, der ihn anrief.
„Rafael, du musst uns unbedingt helfen!“
„Na klar, erzähl mir was Neu…“
The Big R stockte, als er erkannte, was die ihm fern bekannte Stimme am anderen Ende der Leitung soeben gesagt hatte.
„Sag mal, wie hast du mich genannt? Wer ist da überhaupt?“
„Ich bin es. Manni.“
„Manni?“, fragte The Big R entgeistert.
„Manni“, tönte es nochmals nüchtern aus dem Hörer. „Manfred Esser. Sag mal, kennst du mich nicht mehr? Wir haben doch damals unzählige Abenteuer gemeinsam bestanden, so zum Beispiel, als die Chaoscherubim in Mora Sul vom Himmel gefahren waren und…“
„Ja doch, ja doch, ich weiß, wer du bist, Manni“, fuhr The Big R dem Anrufer dazwischen. „Und ich erinnere mich auch noch an deine langweiligen Abenteuer.“
„Es waren auch deine Abenteuer, Rafael“, ermahnte Manni ihn.
„Kann sein. Aber jetzt hör endlich auf, mich so zu nennen, okay? Ich bin schon seit gefühlt tausend Jahren nur noch ’The Big R’, also gewöhn’ dich endlich dran, Mann!“
„Manni.“
„Was?“
„Manni. Nicht Mann. Doch schon vergessen, Rafael?“
„Mann Manni, jetzt ist aber auch mal gut!“, keifte The Big R in den Hörer und stieß ein paar kratzige Keucher hinterher, die ganz eindeutig die Nachwehen der zuvor genossenen Zampanozigarre waren. „Hast du mich nur angerufen, um mich zu ärgern?“
„Ganz und gar nicht, R… R. Die Lage ist Ernst. Sie sind wieder da. Und nicht nur sie. Sondern die anderen auch.“
„Die, die dich suspendieren mussten, weil du schon alle Einheiten durch hattest und es keine mehr gab, in die sie dich hätten verschieben können?“
„Die Geschichte war noch etwas anders, aber ja, genau die meine ich. Und jetzt halt dich fest: Sie haben Olaf Ostgot, Carmen Bushycat, Harry Offroad, Nino Nagler und Jacques Peris geschickt.“
Die Frau neben The Big R wurde schlagartig bleich und übergab sich unter lautem Würgen in die Ritze zwischen Bettrahmen und Wand. The Big R konnte es nicht fassen. Jacques Peris?
„Und deshalb wollte ich dich fragen“, fuhr Manni ungerührt fort. „Kennst du die? Also, ich meine ein paar der Namen schon einmal gehört zu haben, aber im Grunde sagen mir die gar nichts. Du weißt ja, wie das ist. Heute hier, morgen dort. Heute dieser, morgen jener. Da kann man sich einfach nicht mehr alle Gesichter und Namen merken.“
„Also, bei ein, zwei von denen hat’s bei mir schon in der Ferne geklingelt“, stapelte The Big R tief. „Aber so richtig dabei helfen kann ich dir jetzt auch nicht. Sorry, Manni.“
„Hm, ja… da kann man wohl nichts machen“, murmelte Manni und kratzte sich dabei so laut am Kopf, dass man es bis durch den Hörer schaben hören konnte. „Vielleicht fällt es mir ja irgendwann selbst ein, wer diese Leute genau sind. Markante Namen haben sie ja.“
„Aber was ist denn eigentlich passiert?“, hakte The Big R nach. „Warum ist der M… MG… MSZ…. MGSO…“
„MGZSMGNSZZSMGOOZ“, half Manni bereitwillig aus. „Myrtanischer Ganzjahres-ZirkuS Mit Genau Null Seriösen Ziegen-Zähmern Samt Mehrerer Großer Ovaler OZelots. Das Wort ’Geheimdienst’ ist extra nicht erwähnt, damit wir uns nicht sofort verraten.“
„Ja, mein ich ja“, kommentierte The Big R. „Mit diesen Abkürzungen habe ich es nicht so.“
„Ich auch nicht“, gab Manni freimütig zu. „Aber die ganz kurzen krieg ich hin. Da gibt’s noch deutlich Schlimmere. Kurz vor meinem Rauswurf gab es sogar ein RZESIUGGVADSGSDSNAIIVAWK, ein Rundschreiben Zur Erläuterung Sämtlicher In Unserer Geheimen Gruppierung Verwendeten Abkürzungen, Die…“
„Schon gut Manni, schon gut“, wiegelte The Big R möglichst schnell ab. „Sag mir doch lieber, was dein Ex-Verein auf einmal wieder hier zu suchen hat. Wo bist du überhaupt gerade?“
„Ich stehe hier gerade vor dem Meteoritenmarkt in Vengard“, erklärte Manni. „Ich wollte eigentlich gerade einkaufen, als ich sah, dass das gesamte Gebäude von Ihnen besetzt wurde.“
„Vom MGS…dingens?“
„Nein, von den anderen halt! Die mit den Farben!“
„Mit den Farben?“
„Sag mal, ist irgendwas mit dir passiert? Da musst du dich doch dran erinnern können! Die letzten von denen waren die Khakigrünen, nachdem wir schon gedacht hatten, mit Aussendung der Ockergelben sei deren Verein schon auf dem allerletzten absteigenden Ast. Aber naja, denen ist halt nichts zu peinlich, ne? Aber irgendwelche von denen sind jetzt wohl da. Im Meteoritenmarkt hier in Vengard. Aber sie haben noch nicht so richtig Farbe bekannt, sag’ ich mal.“
„Verstehe…“, hauchte The Big R in den Hörer. Sein Herz fing an zu rasen, und diesmal lag das nicht an der Kombination von Alkohol und diversen Tabletten. Er hielt ein wenig inne und ließ seinen Blick aus den Augenwinkel über die junge Frau neben ihm im Bett schweifen, die schon wieder krampfhaft ihren Körper und ihren Kopf gen Wand richtete. Er nahm es jedoch nur ganz peripher wahr, war in Gedanken ganz woanders.
„Aber wie kommen denn jetzt eure Ozelotzähmer da ins Spiel?“, fragte er.
„Was für Dinger?“, raunte Manni zurück. „Du, ich versteh dich ganz schlecht, möglicherweise stellen die hier gerade Störsender auf!“
„Ich meine euren MGS… MZSIAR… ach du weißt schon!“, brüllte The Big R in den Hörer.
„Brauchst nicht so zu schreien“, gab Manni zurück. „Ja, was den MGZSMGNSZZSMGOOZ angeht, da weiß ich auch nicht so recht. Ich dachte ja erst, die wollten helfen, der Bedrohung durch die Bösen da Herr zu werden. Sollte man ja meinen, immerhin sind die so etwas wie der letzte echte myrtanische Geheimdienst. Aber Pustekuchen! Die haben wohl irgendwelche eigenen Pläne. Ich wollte denen ja eigentlich erzählen, was Sache ist, aber naja, die hören einem halt auch nicht zu, ne? Das weißt du wohl besser als ich. Wenn die einmal aus der Führungsetage ihre Befehle bekommen haben, gibt’s kein Halten mehr. Da ist denen doch scheißegal, wer Freund oder wer Feind ist. Weißt du, Rafael, genau deshalb bin ich damals auch ganz gerne gegangen. Ich meine, ich mochte es, in irgendwelchen abgehalfterten und unpersönlichen Appartements in deren Betonburgen eingepfercht zu sein. Ich mochte es wirklich. Aber weißt du, die sonstige Atmosphäre, das war einfach kein Arbeiten mehr. Wenn ich daran denke, wie ich mal mein Jokerjackett in die hauseigene Reinigung gegeben habe, und das über zwei Monate lang…“
„Schon verstanden, Manni. Ich bin in weniger als einer Stunde da.“
„Nee“, wiegelte Manni unbeirrt ab, „das ist doch jetzt nicht mehr nötig, mittlerweile habe ich mein Jokerjackett ja wieder. Du musst nicht…“
„Nein, ich meine den Meteoritenmarkt“, verkündete The Big R bestimmt. „Ich werde da sein. Gleich. In maximal einer Stunde.“
„Was, äh, Rafael“, wirkte Manni plötzlich verängstigt. „Das ist doch gar nicht nötig, ich, äh, ich meine… ich hatte doch nur angerufen, um dich wegen der Namen zu fragen! Musst dir wirklich keine Umstände…“
„Keine Widerworte“, beschied The Big R. „Bis gleich.“
Und damit hatte er auf den roten Hörer auf dem Display gedrückt und das Gespräch beendet. Er hätte dafür auch den grünen Hörer benutzen können, aber in dieser Situation war der rote Hörer die einzig richtige Wahl gewesen.
„Rita, ich muss los.“
„Ich heiße immer noch nicht Rita“, sagte die Frau neben ihm im Bett, die sich langsam wieder zu erholen schien. „Und abgesehen davon hätte ich echt nicht so viel trinken sollen…“
„Wie dem auch sei“, meinte The Big R und setzte sich rasch auf, um im Dunkeln nach geeigneten Sachen zum Anziehen zu fischen. „Ich muss los, mein Kumpel Manni braucht mich. Vengard braucht mich. Nein, ganz Myrtana braucht mich!“
„Ich habe das Telefonat mit angehört, schließlich hast du dein Heldenhandy offenbar standardmäßig auf Lautsprechermodus gestellt“, merkte die Frau an. „Ich glaube aber, du hast deinen Kumpel Manni da ein bisschen missverstanden, er wollte doch nur…“
„Keine Zeit für Diskussionen!“, schnitt The Big R ihr das Wort ab, während er im Dämmerlicht alle möglichen und unmöglichen Outfits samt technischem Zubehör aus seinem Kleiderschrank herauszerrte.
„Bleib du nur hier, in Sicherheit! Wenn du nicht spurst, muss ich dich leider zu deinen Eltern schicken!“
„Sag mal, was ist denn jetzt mit dir los?“, erwachte die Frau nun aus ihrer Lethargie. „Ich bin erwachsen, ich ziehe doch nicht mehr bei meinen Eltern ein!“
„Dann solltest du tun, was ich dir sage, und in Sicherheit bleiben! Gefahr ist im Anzug!“
„Und du bist dieser Gefahr natürlich gewachsen, wie?“
„Natürlich! The Big R ist immer noch im Rennen! Die Frauen werden mir zu Füßen liegen! Zu hunderten! Zu tausenden!“
„Achja, ist das so?“, gab sich seine unbekannte Bekannte unbeeindruckt. „Und was gedenkst du dann, mit so vielen Frauen auf einmal zu tun?“
The Big R grinste. „Das entscheide ich dann später, wenn ich mir von Baalbert meine neue Ration Vollzeitviagra abgeholt habe. Bis dann, Rita!“
„Rafael, da bist du ja endlich“, sagte Ziben, als The Big R auf dem Vorplatz des Meteoritenmarkts auftraf. „Ich dachte, du wolltest sofort losfliegen?“
„Ich bin doch auch sofort losgeflogen“, meinte The Big R, während sich sein Gleiter ganz automatisch wieder an seinem Rücken einfaltete. „Naja, quasi. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich den Gleiter anlegen und starten konnte. Weiß du, ich habe den schon so ewig nicht mehr benutzt, und man vergisst ja so einiges, ne. Ich wusste ja nichtmal mehr, dass ich ihn überhaupt noch besitze.“
„Soso“, kommentierte Ziben nur skeptisch, wie es seine Art war. Für einen Mann seines Alters benahm er sich wie üblich nur wenig altersgerecht. Und er benahm sich wenig herzlich, angesichts der Tatsache, dass er und The Big R sich schon länger nicht mehr gesehen hatten. Gefühle waren aber ohnehin nie Zibens große Stärke gewesen. Man konnte meinen, Menschen verlören ihre Gefühle, wenn sie alt wurden. Es sei denn, sie waren schwul – das war aber ein Thema, was The Big R gedanklich noch nicht anschneiden wollte, der richtige Zeitpunkt dafür würde noch kommen.
The Big R sah sich auf dem Vorplatz des Meteoritenmarkts um. Die Gegend hier war grau in grau, von überall führten gepflasterte Straßen und Wege zu dem mehr oder minder rund gebauten Gebäude, welches die Väter der Stadt aus den Überresten der einst eingeschlagenen Meteoriten bauen ließen. Später war das eigentlich als Stadthalle gedachte Gebäude durch dubiose Vorgänge in der Stadtverwaltung einer großen Versicherungsfirma überschrieben worden, nachdem diese öffentlichkeitswirksam kundgetan hatte, ihren Versicherten nicht auch nur einen Cent für die durch den Meteoritenhagel zerstörten Gebäude zahlen zu wollen. Erst nachdem das Eigentum an dem bereits hochgezogenen Gebäude aus Meteoritengestein irgendwie an die Versicherung übergegangen war, hatten vereinzelte Versicherungsnehmer auch ihre Zahlungen erhalten. Das Versicherungsunternehmen – die Windig-Wertpapier-AG – hatte dann aus dem Gebäude ein großes Einkaufszentrum gemacht, wofür im Stadtrat unter Umgehung der Vorschriften zur öffentlichen Auslage in einer Nacht-und-Nebel-Aktion der entsprechende Bebauungsplan geändert worden war. Die aus Sicht der Bevölkerung seltsamen Vorgänge waren sogar Gegenstand eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens durch die Bezirksregierung sowie schließlich einer verwaltungsrechtlichen Klage gewesen – beide Verfahren wurden jedoch eingestellt, die Vengarder Kommune nicht weiter behelligt und dem Unternehmen Windig-Wertpapier sein Einkaufszentrum belassen, welches seitdem Meteoritenmarkt genannt wurde. Obwohl weit abseits des Stadtkerns, war jeden Öffnungstag – und das bedeutete sechs Tage die Woche von acht bis vierundzwanzig Uhr – jede Menge los. Normalerweise. Aber wie The Big R bereits durch das Telefonat mit Manni erfahren hatte, war heute nichts normal. Dementsprechend herrschte eine gespenstische Stille, wie die Ruhe vor dem Sturm. All das Grau in Grau starrte The Big R an, und wenn man sich vor Augen führte, dass der graue, in den Grundfesten runde, nach oben hin aber unförmige Koloss aus mehreren der todbringenden Meteoriten gebaut war, war die Szenerie noch gruseliger. Glücklicherweise war es noch nicht allzu spät am Tag, denn sonst wären die Wege rund um den Meteoritenmarkt nicht mehr täglich, sondern nächtlich beschienen gewesen, und das hätte The Big R nun wirklich nicht mehr ausgehalten.
„Wie kommt es, dass du so schnell hier bist?“, wandte sich The Big R nun wieder an Ziben, nachdem er die Gegend nach seinem Dafürhalten ausreichend inspiziert hatte.
„Ich habe mich natürlich sofort nach deinem Anruf auf den Weg gemacht“, erklärte Ziben nicht ohne Stolz. „Allein schon, weil ich die Chance gesehen habe, unseren guten Freund Manni wiederzutreffen!“
In diesem Moment trat Manni hervor, der sich bis zu The Big Rs Erscheinen offenbar nur wenig und vor allem sehr distanziert mit dem ebenfalls anwesenden Ziben unterhalten hatte. Ihre Beziehung war stets über The Big R – damals noch Rafael – vermittelt worden, weshalb sie nach seinem Rückzug aus dem aktiven Geschäft ziemlich eingefroren war. The Big R fühlte sich nur in seinem Eindruck bestätigt, dass sich letzten Endes die ganze Welt um ihn drehte – weshalb nun folgerichtig mit seinem Erscheinen auch das Eis zwischen Manni und Ziben brach.
„Die Freude ist ganz meinerseits, Privatdozent Doktor Zuben“, erklärte Manni.
„Ziben. Nenn mich einfach Ziben.“
„Natürlich. Verzeihung, Privatdozent Doktor Ziben.“
„Nein, nein. Ziben Zuben.“
„Na was denn nun?“
„Wenn ich euer Geplänkel mal unterbrechen dürfte…“, mischte The Big R sich nun ein. „Seid ihr die einzigen, die hier sind? Ich habe nämlich außer dir, Ziben, noch…“
„Ich bin auch hier, Big R!“, ertönte plötzlich eine Stimme hinter dem Rücken des Angesprochenen. Als The Big R sich umdrehte, staunte er Bauklötze.
„Abusymbel? Du bist auch da? Was machst du denn hier?“
Der Südländer deutete eine Verbeugung an, die er mit einem zurückhaltenden Lächeln garnierte.
„Das frage ich mich allerdings auch. Naja, ich kann es erklären, aber… Big R, du weißt ja, wie es mir in letzter Zeit geht, und die Zampanozigarren konnten meine Stimmung auch nur vorübergehend heben. Als ich vorhin dann einfach mal nach Faring fahren wollte, um mir das dortige Burgfest anzusehen, habe ich mich irgendwie mit dem Bus verfahren. Naja, um ehrlich zu sein, als ich so dort saß und wusste, dass ich auf dem Burgfest allerlei glückliche Familien sehen würde, überkam mich ein ziemlich depressiver Schub, und dann konnte ich einfach nicht mehr die Kraft aufbringen, rechtzeitig zu meiner Haltestelle den Stoppknopf zu drücken. Ich bin dann einfach im Bus sitzen geblieben, und als ich die gesamte Linie fast zum dritten Mal mitgefahren war, hat mich der Busfahrer hier rausgeworfen.“
„Klingt ganz nach dir, ja“, kommentierte The Big R lakonisch, während Erinnerungen auf ihn einströmten, die Abusymbel wahlweise bei einem Sprung ins Meer mit selbstgebastelten Betonschuhen oder einer Geisterfahrt auf der Autobahn zeigten. Abusymbel hatte diese und noch viele weitere Situationen alle überlebt, da war eine Irrfahrt mit dem Bus natürlich gar nicht mehr so wild, depressive Schübe hin oder her.
„Aber ich hatte mich eigentlich gefragt, wo Sarkophas steckt, den hatte ich nämlich auch angerufen“, erklärte The Big R nun.
„Du hast Sarkophas angerufen?“, fragte Ziben erstaunt. „Na, dann ist es kein Wunder, dass er noch nicht hier ist. Es sei denn, das war schon gestern, als du ihn angerufen hast. Der Kerl müsste doch mittlerweile um die neunzig sein, da dauert das schonmal etwas länger. Zumal er ja, da er sich keinen Rollator zulegen will, jede auch noch so kurze Streckte mit seinem Helikopter zurücklegt. Das musst du dir vorstellen, ein neunzigjähriger Helikopterpilot! Und wenn man dann noch bedenkt, dass er mit dem Alter so schläfrig geworden ist, dass er seine Augenlider mittels beständiger Telekinese oben halten muss…“
„Ja, das könnte ich mir bei dem echt vorstellen“, lachte The Big R dazwischen. Er kassierte daraufhin einen sehr strengen Blick von Ziben.
„Das war kein Witz. Das ist wirklich so.“
„Oh.“
Wie gerufen schallten auf einmal aus der Ferne des Himmels die Geräusche geschäftiger Rotorblätter zu ihnen herunter. Ein guter Stoß Wind zog auf, der sich mehr und mehr intensivierte. Als The Big R und die anderen nach oben blickten, sahen sie einen irgendwie alt wirkenden Helikopter herannahen, der ab einer gewissen Höhe das Pendeln anfing, als wüsste sein Pilot nicht, was er nun weiter tun sollte.
„Wahrscheinlich kämpft er gerade wieder gegen das Einnicken an“, murmelte Ziben, was The Big R bei dem Lärm aber nur verstehen konnte, weil der Privatdozent direkt neben ihm stand.
Nach einigem weiteren unsicheren Rumgependel zog der Helikopter wieder ein Stück hoch, um dann über einen nahegelegenen Kreisverkehr zu fliegen, in dessen unbefahrener Mitte das Fluggerät schließlich landete. Es dauerte noch eine Weile, bis die Rotorblätter der Maschine zum Stillstand kamen und der Pilot sein Cockpit verließ, aber als er es dann tat, bewaffnet mit einem großen Gehstock und gekrümmt wie eine Banane, wurde offenbar, dass es tatsächlich Sarkophas war. Und er hatte einen Copiloten mitgebracht, der nun ebenfalls ausstieg.
„Hallo!“, rief dieser Copilot bereits von weitem, nicht viel weniger alt anmutend, aber deutlich fitter als sein Kollege. „Ich bin ja so aufgeregt!“
Bald hatte der Copilot seinen Gegenpart eingeholt, legte seinen Arm um ihn und half ihm ein wenig auf die Sprünge. Als die beiden nahe genug herangekommen waren, bestätigte sich The Big Rs Verdacht.
„Das ist ja Mickskwir“, stellte The Big R das Offensichtliche fest. „Die beiden können auch nichts getrennt unternehmen, oder?“
„Das geht schon seit unserer Studienzeit so“, raunte Ziben seinem Nebenmann in einem so verschwörerischen Tonfall zu, als habe er das Gefühl, eine unglaubliche Enthüllung zu machen, die ja keiner mitbekommen sollte. The Big Rs Überraschung hielt sich jedoch in Grenzen.
„Aha. Die waren damals also auch schon so alt?“
„Nein“, gab Ziben etwas enttäuscht zurück, weil sein Geflüster sich als nicht einmal halb so spannend wie vermutet entpuppt hatte. „Und den Helikopter hatte Sarkophas damals auch noch nicht. Den hat er sich erst zu seinem achtzigsten Geburtstag gekauft. Aber sonst war alles schon damals so wie jetzt.“
„Hallo, liebe Leute“, meldete sich nun auch Sarkophas zu Wort, der einige Schritte vor ihnen Halt machen musste, weil er vollkommen außer Atem war. „Ich bin eigentlich nur gekommen, um abzusagen. Aber dafür habe ich euch Mickskwir als Verstärkung mitgebracht.“
„Du siehst auch gar nicht gut aus, Sarkophas“, meinte Ziben unumwunden.
„Ja“, bestätigte der Angesprochene. „Ich habe ja auch seit Tagen nicht geschlafen.“
„Das glaube ich dir dann eher weniger.“
„Wie auch immer“, meldete sich Manni zu Wort, „bei dem, was uns bevorsteht, ist das hier sicher nicht der richtige Ort für einen… so betagten Mann wie Sarkophas. Das ist viel zu gefährlich.“
„Wieso denn gefährlich?“, fragte The Big R verwundert.
„Naja… weil… wir vermutlich kämpfen werden? Weil Bomben hin und her geschmissen werden, weil Laserwaffen ausgepackt werden, weil geschossen und gestochen wird, Explosionen, Feuer und Napalm? Und irgendwann wird sich einer mit ein paar Pillen in einen Giganten verwandeln und versuchen, uns platt zu trampeln oder so. So läuft das doch immer. Und ich lehne mich mit meiner Einschätzung vielleicht ein kleines bisschen weit aus dem Fenster, aber… ich würde sagen, das ist schon ziemlich gefährlich.“
„Raff ich nicht“, kommentierte The Big R. „Sarkophas ist doch keine Frau. Was soll schon passieren?“
„Naja, wie auch immer“, ergriff Sarkophas mit leiser Stimme Partei für sich selbst. „Ich würde es jedenfalls aus verschiedenen Gründen vorziehen, wieder in meinen Helikopter zurückzukehren.“ Er wandte sich Mickskwir zu und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. „Sieh zu, dass du mir heil wieder zurückkommst, Micksimausi.“
„Aber natürlich, Sarkospatz. Und heute Nacht halten wir dann wieder Händchen, ja?“
„Wenn ich es schaffe, bis dahin wach zu bleiben, dann ja.“
Und damit stapfte Sarkophas zurück zum Helikopter, während Mickskwir bei der Gruppe blieb.
„Ich hoffe, ich habe noch nichts verpasst!“, meinte Mickskwir gut gelaunt, während er allen der Reihe nach die Hand schüttelte.
„Hoffe ich auch“, kommentierte The Big R. „Andererseits: Es wäre schön, wenn ihr schon mehr herausgefunden hättet als ich. Manni, wie sieht es aus? Weißt du jetzt wenigstens, wer von den, äh, Bösen, geschickt wurde? Und was ist mit den Geheimdienstleuten? Sind die alle schon da drin, oder was?“
„Die Leute vom MGZSMGNSZZSMGOOZ haben den Meteoritenmarkt quasi schon gestürmt“, erklärte Manni. „Aber ich bezweifle, dass sie das getan haben, um die anderen dort zu vertreiben. Zumindest nicht in erster Linie. Da muss irgendetwas sein in diesem Markt, wonach sich die mächtigen Gruppierungen unserer Welt richtiggehend die Finger lecken.“
„Verstehe“, gab The Big R vor. „Und wer sind nun die anderen? Die Khakigrünen und die Ockergelben sind es ja wohl nicht, oder?“
„Nein, eher nicht“, bestätigte Manni. „Wenn ich meine Liste korrekt geführt habe, haben wir die ja schon längst besiegt. Es könnten allerdings die Lachsrosanen oder die Olivgrünen sein. Andererseits haben sich die Pechschwarzen in letzter Zeit ziemlich ruhig verhalten, das macht sie natürlich verdächtig. Die Zitronengelben sind auch immer für eine Überraschung gut. Das gilt auch für die Kalkweißen, aber bei denen weiß ich, dass die gerade eine Führungskrise haben, von daher werden die jetzt im Augenblick wohl nicht irgendwelche Einkaufszentren besetzen können. Da ist ein Auftreten der Aschgrauen noch wahrscheinlicher, vielleicht sogar im Verbund mit den Orangeorangenen, sofern die Kackbraunen nicht ihr Veto eingelegt haben. Und die Pantherpinken muss man auch immer auf der Rechnung haben. Kurz gesagt: Die Lage ist verzwickt. Ich habe keine Ahnung, wer dort auf uns lauert.“
„Dann gibt es wohl nur eine Möglichkeit, das herauszufinden“, sagte The Big R in einem überlegenen Tonfall gespielter Genervtheit. „Also alle auf zum Eingang!“
Die Gruppe setzte sich in Bewegung, inklusive Manni, der allerdings während ihres kurzen Weges zum Haupteingang des Meteoritenmarktes einige Einwände vorzubringen hatte.
„Aber Rafael, wir können doch nicht einfach dort hineingehen, wenn wir nicht wissen, wer dort drinsteckt! Möglicherweise befinden sich Semimeister unter ihnen!“
„Ach, papperlapapp“, winkte The Big R ab. „Sollen sie doch. Semimeister, dass ich nicht lache. Ich habe schon Sesquimeister an meinem kleinen Finger verhungern lassen, da sind doch so ein paar halbe Portionen mit einem Wimpernschlag hinweggefegt. Außerdem müssen wir ja gar nicht ahnungslos hineingehen. Ziben, wenn ich bitten darf?“
Wie, als hätte er die ganze Zeit auf sein Kommando gewartet, griff Ziben sich seinen mitgebrachten Teraturnbeutel vom Rücken, um mit einem beherzten Griff eine Art langen Stab daraus hervorzuholen. Bei näherem Hinsehen, so befand The Big R, sah dieser Stab nicht viel anders aus als der Gehstock, den Sarkophas – gerade an seinem Helikopter angekommen – benutzt hatte.
Ziben drehte ein wenig an dem oberen, runden Knaufgriff des Stocks herum, murmelte geschäftig ein paar Worte, schien zu überlegen und wandte sich schließlich an Manni, den er als besonders erstaunt wirkenden Zuschauer aus der Gruppe gepickt hatte.
„Mit diesem von mir entwickelten Gerät sind wir in der Lage, die im Meteoritenmarkt herum flatternden, unsichtbaren Wellen aufzunehmen und zu analysieren. Auf diesem Display hier oben wird uns dann mitgeteilt, wem wir – abgesehen von den Geheimdienstagenten – gegenüberstehen.“
„Versteh’ ich nicht“, meinte Manni. „Aber machen Sie mal, Privatdozent Doktor Zuben.“
„Ziben.“
„Verzeihung, Privatdozent Doktor Ziben.“
„Ziben Zuben.“
„Na was denn nun?“
„Wie oft denn noch?“, fuhr The Big R ungeduldig dazwischen. „Halte dich nicht weiter auf, Ziben! Lass knacken!“
Ziben tat, wie ihm geheißen, holte mit dem Stock in seiner Hand aus und schlug moderat gegen die Eingangstüre des Meteoritenmarktes. Das Holz – oder welches Material es auch immer war – splitterte entzwei.
„Verdammt“, fluchte Ziben. „Mir ist mein Spektralspazierstock zerbrochen! Jetzt weiß doch gar keiner mehr, wer wer ist!“
„Hätte sich das also auch erledigt“, murmelte The Big R wenig begeistert.
„Sagt mal, was ist denn eigentlich hier los?“, ertönte eine Stimme von hinten. „Ich wollte hier eigentlich ganz gepflegt was verticken, und was muss ich hier sehen? Alles leergefegt!“
„Baalbert!“, rief Ziben erstaunt. „Du hier?“
„So sieht’s aus, Alter. Also, erzählt mal! Habt ihr was mit dieser gähnenden Leere hier zu tun?“
„Wohl eher der MGZSMGNSZZSMGOOZ“, erklärte Manni. „Sie werden alle Leute evakuiert haben. Und naja, vorhin hat es schon ein paarmal ordentlich gerummst im Laden, da hat dann auch der letzte Rest die Flucht ergriffen.“
„Na klasse, dann wird das heute wohl nix mit Geldverdienen.“
„Komm doch einfach mit“, schlug The Big R vor, der dies vor allem tat, weil er Baalbert schlicht und einfach gerne um sich hatte. „Du wirst uns sicher eine große Hilfe sein“, log er dann noch hinzu.
„Was weiß ich“, meinte Baalbert. „Ich lass mich einfach treiben, weißt du doch. Wenn es was zu gucken gibt, dann gucke ich. Das war schon immer so. Also, wo müssen wir hin? Einfach hier rein?“
Und mit diesen Worten stieß Baalbert in größter Selbstverständlichkeit die beiden großen Türen zum Meteoritenmarkt auf und verschwand im Innern. Fassungslos starrte Ziben ihm nach, bis sich schließlich The Big R und auch die anderen in Bewegung setzten und den Privatdozenten so mit sich zogen.
„Das gibt’s doch gar nicht….“, murmelte The Big R, während er fassungslos auf die leblosen Körper starrte, die in nicht geringer Zahl hier und dort im großen Eingangsbereich des Meteoritenmarkts auf den schwarz-weißen Kacheln verstreut lagen.
„Die Babyblauen!“, sagte Manni mitleidig und schlug sich mit der flachen Hand auf die Stirn. „Ich hätte es wissen müssen. Die letzten Berichte, die ich noch beim MGZSMGNSZZSMGOOZ lesen durfte, sprachen bereits davon, dass diese Unterabteilung unserer ewigen Widersacher bald zur Reife gelangen würde. Das hier sollte wohl ihre Feuerprobe sein… und nun… sind sie alle tot.“
„Oh mein Gott, die armen Kleinen!“, kreischte Mickskwir und schnäubte sich am Pulli seines Vordermannes Ziben die Nase. „Und jetzt ist nicht einmal Sarkophas hier, um mir die Hand zu halten!“
„Kein Grund, so emotional zu werden, Mickskwir“, meinte Manni forsch, während er, abgestumpft von seiner vergangenen langjährigen Agententätigkeit, mit ein paar sachten Fußtritten gegen die Leichen überprüfte, ob sie denn auch wirklich tot waren. „Sie mögen vielleicht ’Die Babyblauen’ heißen, aber das sagt nichts über ihr Alter aus. Im Grunde war das eine Bande aus Quereinsteigern aller Altersklassen. Ziemlich auf der untersten Hierarchiestufe. Deshalb haben sie wohl auch nicht lange durchgehalten.“
„Manni, Mickskwir ist schwul“, raunte The Big R seinem Kumpanen zu. „Ist doch klar, dass er hier der Emotionalste der Gruppe sein muss.“
„Emotionaler noch als Frauen?“, fragte Manni zurück.
„Na klar“, antwortete The Big R. „Aber die sind ja hoffentlich alle zuhause in Sicherheit.“
„Ich blick’ da noch nicht so ganz durch“, warf Baalbert nun ein. „Aber kann auch an mir liegen, dass ich so vernebelt bin. Ich meine jetzt diese Blauen da, die es wohl dahingerafft hat. Sind da jetzt diese Agenten dran schuld, oder wie habe ich das zu verstehen?“
„Schaut mal, da vorne!“, rief Ziben auf einmal ganz aufgeregt. „Das sind ja Drohnen!“
Der Privatdozent wies mit seinem Finger auf einen herannahenden, ausgedünnten Bienenschwarm, in dem Ziben anscheinend keine einzige weibliche Biene, sondern nur männliche Exemplare zu erkennen glaubte. Der Schwarm hatte sich offenbar aus einer kleinen Tierhandlung befreien können, die hier im Meteoritenmarkt als kleines Ladengeschäft untergebracht war. Bei der Schneise der Verwüstung, die sich bei genauerem Hinsehen durch das Innere des Einkaufszentrums zog – zerbrochene Schaufenster, blockierte Rolltreppen, abgerissene Mauern und defekte Fahrstühle – war das auch kein Wunder.
„Der wieder mit seinen Drohnen“, stöhnte Baalbert. „Das war schon unsere ganze Studienzeit so. Wir haben uns den geilsten Scheiß reingezogen, und er hat irgendwelche wissenschaftlichen Texte über Honig verfasst.“
„Dafür habe ich aber irgendwann mein renommiertes Imkerinstitut gegründet“, wandte Ziben ein. „Und was hast du in deinem Leben erreicht?“
„Ist nicht in Worte zu fassen“, konterte Baalbert ungerührt. „Den Trip muss man erlebt haben.“
„Um noch einmal auf die Sache mit den Babyblauen zurückzukommen“, nahm Manni den Faden zaghaft wieder auf. „Ich denke schon, dass es der MGZSMGNSZZSMGOOZ war, der sie niedergestreckt hat. Es muss hier im Meteoriten etwas geben, woran beide Fraktionen dringend interessiert sind. Nur was?“
„Ich habe da bereits eine Vermutung“, schaltete sich Ziben wieder ins Gespräch ein, nachdem der Drohnenschwarm nach einigem harmlosen Umhergeschwirre seinen Weg aus dem Einkaufszentrum heraus gefunden hatte. „Wie ihr vielleicht wisst, benutzt Baalbert für seine… Magie, wie er es nennt, verschiedenste Erze und Substanzen.“
„Ich nenne es nicht nur Magie, es ist Magie!“, fügte Baalbert freundlich, aber bestimmt hinzu. „Kein Grund, so despektierlich darüber zu reden, Mann!“
„Und da der Versuch, diese Forschungsergebnisse vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, ja grandios fehlgeschlagen ist und sich mittlerweile an jeder Ecke irgendwelche vermeintlichen Magier herumtreiben“, fuhr Ziben unbeirrt fort, „ist dieses Wissen natürlich auch an den MGZSMGNSZZSMGOOZ durchgedrungen.“
„Ist immerhin ein Geheimdienst“, kommentierte The Big R. „Wobei, hätten sie es nicht dann schon weitaus vorher herausfinden sollen?“
„Wie auch immer“, schloss Ziben, „ich denke mal, dass sie ein großes Interesse daran haben, eine der mächtigsten Substanzen zur Herstellung von… äh, anderen Substanzen in die Finger zu bekommen, bevor es jemand anderes tut. Und diese Substanz wird nirgendwo anders zu finden sein als in der größten Ansammlung von Meteoritengestein, die es in ganz Myrtana gibt: Dem Meteoritenmarkt!“
„Nicht schlecht, Herr Privatdozent“, schallte es auf einmal von der Ebene direkt über ihnen, die nur mittels zweier kaputter Rolltreppen zu erreichen war, herunter. „Aber deine Neugier wird dir letzten Endes nichts nützen. Ganz im Gegenteil!“
Gebannt wie erschrocken starrten The Big R und seine Kumpanen hinauf auf die Galerie, die vom durch das ferne Glasdach weiter oben hineinscheinende Licht beleuchtet wurde und so die grobschlächtige Silhouette des Sprechers preisgab. Diese Umrisse konnten nur einem gehören.
„Olaf Ostgot!“, entfuhr es Manni.
„Gut erkannt, Manfred Esser!“, gab der Hüne selbstgefällig zurück. „Und nicht nur der!“
Wie auf Kommando – vermutlich war es tatsächlich auf Kommando – bauten sich oben auf dem Brückengang noch vier weitere Personen auf.
„Carmen Bushycat! Harry Offroad! Nino Nagler!“, rief Manni wie aus der Pistole geschossen, als seien auf einem Jubiläumsklassentreffen gerade die Gestalten aufgetaucht, die er am wenigsten hatte leiden können. „Und…“
„Jacque Peris“, beendete The Big R mit düsterer Stimme wie Miene die Aufzählung. „Alle Achtung, Jacques. Aus dir ist ja doch noch etwas geworden.“
„Aus dir auch, Rafael“, gab der Angesprochene akzentfrei zu Protokoll. „Nämlich ein Wrack.“
„Du hast hier keine Macht über mich!“, brüllte The Big R wie vom Donner gerührt nach oben, sodass sich Mickskwir genötigt sah, vor Schreck sein Gesicht in den Händen zu verbergen und Ziben es für ratsam hielt, The Big R beruhigend eine Hand auf die Schulter zu legen.
„Was hat es denn mit diesem Jacques Peris auf sich?“, erwachte plötzlich unverhofft Abusymbel aus seiner bisher konsequent durchgehaltenen Passivität, als wollte er nur noch mal kurz darauf aufmerksam machen, dass er ja auch noch mit von der Partie war. Baalbert hatte für diese Frage jedoch nur ein verächtliches Schnauben übrig.
„Das hat The Big R vor circa dreieinhalb Jahren schon einmal in einem Nebensatz angedeutet“, erklärte er. „Ist jetzt nicht unsere Schuld, dass du das nicht gerafft hast.“
Abusymbel ließ die Schultern hängen. „Und da wundern sich die Leute, wenn ich depressiv werde“, nölte er. „Schon gut, ich sag am besten gar nichts mehr.“
„Ihr solltet auf euren Freund hören!“, riss Olaf Ostgot mit seinem tiefen und dröhnenden Timbre die Gesprächsführung wieder an sich. „Wobei sich da noch die Frage stellt, ob das wirklich eine Absichtserklärung eures Kumpanen ist, oder nicht vielmehr eine sich selbst erfüllende Prophezeiung!“
The Big R benötigte einen Moment, um zu verstehen, was Olaf Ostgot mit diesen verklausulierten Aussagen meinte. Als er jedoch die Nanobombe in der Hand des Hünen entdeckte – eigentlich viel zu winzig, um sie zu sehen – glaubte er zumindest in etwa zu wissen, was der MGZSMGNSZZSMGOOZ-Einheitsleiter damit meinte. Leider, so musste The Big R einsehen, kam diese Erkenntnis einen Tick zu spät, denn Olaf Ostgot hatte den Finger bereits am Zünder und war drauf und dran, die Nanobombe ein Stockwerk abwärts zu ihnen zu befördern. So blieb ihm, The Big R, wie auch seinen Freunden nicht mehr viel anderes übrig, als in hilfloser Pose die Hände zur Abwehr bereit zu heben, als wären sie in der Lage gewesen, so die Explosionskraft der bald auf sie herabfallenden Nanobombe abzuwehren. Doch mit dem Motorengeräusch, welches dann auf einmal ertönte, kam alles ganz anders.
Der Urheber des Geräuschs, ein langes, aber schlankes Motorrad, schoss haarscharf und in atemberaubender Geschwindigkeit zwischen den im Erdgeschoss stehenden Kumpanen hindurch, steuerte direkt auf die rechte der beiden stillgelegten Rolltreppen zu, benutzte die abgeflachten Stufen als Rampe und flog geradezu über die Galerie, an der die MGZSMGNSZZSMGOOZ-Agenten fassungslos mitansehen mussten, wie der Mitfahrer auf dem Sozius des Motorrads zwei kleine Maschinenpistolen zückte und damit im Flug mehrere Salven auf Olaf Ostgot abfeuerte, der alsbald durchlöchert zu Boden ging. Noch bevor der Schütze erneutes Feuer eröffnen konnte, hatten sich die restlichen Agenten des MGZSMGNSZZSMGOOZ weiter hinein in die erste Etage des Meteoritenmarkts geflüchtet und waren bald außer Sicht- und Schussweite. Das Motorrad landete oben auf der Galerie, wurde rasch vom Fahrer gedreht und rumpelte die andere der beiden Rolltreppen wieder herunter, bis es direkt vor The Big R und den anderen zum Stehen kam. Niemand sagte etwas, bis der Fahrer den Helm abnahm. Es war eine Fahrerin.
„Das ist ja…“, stammelte The Big R.
„Siggy!“, vollendete Manni den Satz. „Und mitgebracht hat sie Roy mit seinen Ultrauzis!“
Nun nahm auch der Beifahrer auf dem Sozius seinen Helm ab und entpuppte sich als irgendwie unauffällig aussehender Mann – unauffällig, wären da nicht die Motorradklamotten und eben die besagten Uzis gewesen.
„Siggy?“, fragte Baalbert entgeistert. „So heißt doch keine Frau!“
„Wenn es die Koseform für Sigrid ist, dann schon“, sagte Siggy und sandte ein glockenhelles Kichern hinterher, während sie sich mit den Fingern durch ihre blonde Mähne fuhr.
„Siggy, was machst du denn hier?“, fuhr The Big R sie entgeistert an.
„Hallo, Rafael“, kicherte Siggy ihm unbeirrt fröhlich entgegen.
„Da gibt es nichts zu kichern, du solltest zuhause sein!“
„Aber wieso?“, fragte Siggy, deren bezauberndes Lächeln nun schwand. „Ich habe doch extra meine Karatekette mitgebracht! Ich werde mitkämpfen!“ Sie fasste sich zur Bekräftigung an ihre Halskette, die im Grunde aussah wie ein mehr oder minder modisches Accessoire aus dem nächstbesten Kaugummiautomaten, in The Big Rs Erinnerung aber durchaus bleibenden Eindruck hinterlassen hatte, als er sie einmal bei einem ihrer vergangenen gemeinsamen Abenteuer in Aktion gesehen hatte.
„Aber du bist eine Frau!“, schimpfte The Big R mit flehendem Unterton. „Und hier droht Gefahr! Das geht doch nicht! Ich glaube, ich sollte deine Eltern informieren…“
„Ach, jetzt geht das schon wieder los“, meckerte Siggy, schwang sich vom Motorrad, legte den Helm auf dem Sitz ab und stemmte zur Bekräftigung ihrer Empörung die Hände in die Hüfte. „Hat man da noch Worte?“
„Ich will doch nur, dass du in Sicherheit bist!“, gab The Big R wahrheitsgemäß Auskunft. Das aber besänftigte Siggy keineswegs, die sogleich einen Schmollmund aufsetzte, der seinesgleichen suchte. Daraufhin trat Manni heran, mit einem Versuch, das Thema zu wechseln.
„Wo kommt ihr denn eigentlich her? Also, besser gesagt, woher wusstet ihr, dass wir hier sind?“
„Das ist doch kein Problem mit dem Penispeiler!“, verkündete Siggy stolz.
„Mit dem… WAS?“, entfuhr es Manni.
„Ja, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden und will es glaube ich auch gar nicht“, gab Roy peinlich berührt zu Protokoll, während er vom Motorrad stieg, den Ständer ausklappte und ebenfalls seinen Helm ablegte. „Hallo zusammen, übrigens.“
„Du magst es vielleicht noch nicht gemerkt haben“, fuhr Siggy grinsend fort, „aber seit unserem letzten… Zusammentreffen trägst du einen kleinen GPS-Sender an dir dran. Und mit dem habe ich dich aufgespürt.“
„Da ist ein GPS-Sender an meinem…“, stammelte Manni entsetzt.
„Nunja“, meinte Siggy schulterzuckend, „das war die erstbeste Stelle, an der ich ihn anbringen konnte.“ Sie kicherte fröhlich, was Manni nur umso mehr die Schamesröte ins Gesicht steigen ließ, während er unter den stummen Blicken seiner Mitstreiter um ihn herum immer kleiner zu werden schien.
„Aber das erklärt ja immer noch nicht, warum du wusstest, dass du uns zur Hilfe kommen musstest!“, lenkte Manni nun ab beziehungsweise wieder auf das eigentliche Thema.
„Naja, das hatte ich wohl irgendwie im Gespür.“
„Meine Damen und Herren, ich will euer interessantes Gespräch ja nicht unterbrechen“, meldete sich Ziben zu Wort. „Aber ich glaube, wir haben Wichtigeres zu tun. Die Agenten des MGZSMGNSZZSMGOOZ befinden sich noch immer im Gebäude!“
„Also ist es wahr!“, rief Siggy erfreut. „Der MGZSMGNSZZSMGOOZ ist hier! Oh, das wird toll, all die ehemaligen Kollegen wiederzusehen!“ Sie hüpfte kichernd auf und ab und klatschte dabei in die Hände. The Big R stellte fest, dass sie sich seit ihrem letzten Treffen, was eine gewisse Zeit her war, keinen Deut verändert hatte. Er fragte sich allerdings, ob er seit diesem Treffen auch unbemerkt einen GPS-Sender an sich trug.
„Ich glaube nicht, dass das ein freudiges Wiedersehen wird“, meinte Roy. „Immerhin habe ich gerade einen von ihnen erschossen. Hast du ihn nicht erkannt, Siggy? Das war Olaf Ostgot!“
„Doch, schon“, gab Siggy zu. „Aber den mochte ich ja eh nie. Aber ihr meint, die sind jetzt alle böse, oder was?“
„Na und ob“, sagte The Big R. „Ihr beide könnt froh sein, dass ihr ebenso wie Manni den Laden längst verlassen habt. Sonst hätte er jetzt wahrscheinlich euch erschossen, oder so.“
„Also, das würde Manni doch nie tun!“, meinte Siggy nun wieder ganz empört.
„Ich mein ja nur. Jedenfalls sind die vom MGZSMGNSZZSMGOOZ jetzt die Bösen. Sogar die alleinigen Bösen, wo die Babyblauen hier schon tot und verstreut herumliegen und unseren anderen speziellen Feinden so langsam die Farbpalette ausgeht.“
„Aber wie kann der MGZSMGNSZZSMGOOZ denn auf einmal böse sein? Sollte der nicht dafür da sein, Myrtana zu schützen?“
„Naja, Geheimdienste halt“, sagte The Big R schulterzuckend. „Bei denen weiß man ja nie so recht ,was die im Schilde führen. Ich schätze, wenn man das wüsste, wären es auch keine Geheimdienste mehr.“
„Aber heißen Geheimdienste nicht eigentlich Geheimdienste, weil niemand von ihrer Existenz wissen soll?“, wandte Mickskwir ein.
„Wenn das so ist, haben sie sich jedenfalls ziemlich dämlich angestellt“, sagte Baalbert. „Geheim bleiben wollen und dann das größte Einkaufszentrum Myrtanas entern, alles klar…“
„Vielleicht wäre es wirklich besser, wenn wir diese Diskussion auf später vertagen“, bat Roy. „Olaf Ostgot mag zwar tot sein, aber so wie ich Jacques Peris kenne, wird er sich zum Einheitsleiter aufgeschwungen haben. Und das wird die Sache ganz sicher nicht besser machen.“
The Big R erschauderte bei der Nennung dieses Namens. Glücklicherweise bekam das in diesem Moment gerade niemand mit.
„Eines müssen wir aber noch klären“, klinkte sich Ziben ein. „Habt ihr beide irgendwelche Informationen darüber, was genau der MGZSMGNSZZSMGOOZ hier will?“
„Nein“, antwortete Roy. „Wir haben den Dienst ja kurz nach Manni verlassen, von daher wissen wir auch nicht mehr. Siggy hat zwar ihr Bestes gegeben, etwas aus den Agenten herauszulocken, aber naja. Es hat eben einfach nicht geklappt.“
„War aber trotzdem schön“, kicherte Siggy. The Big R warf ihr einen skeptischen Blick zu, fragte sich aber gleichzeitig auch, ob er eigentlich ihre Nummer in seinem Heldenhandy gespeichert hatte. Nur für alle Fälle.
„Wir vermuten jedenfalls, dass der MGZSMGNSZZSMGOOZ auf der Suche nach magischen Substanzen ist, die sich im zusammengepressten Meteoritenstein befinden können“, dozierte Ziben. „Glaubt ihr, das ist realistisch?“
„Ich kann es zumindest nicht ausschließen“, bekundete Roy. „Aber beim MGZSMGNSZZSMGOOZ wurden die Pläne eigentlich immer geheim gehalten. Man kannte nur die einzelnen Aufträge, hat sie ausgeführt, und das war es dann. Und es gab die offizielle Regel, dass man nicht mit anderen Einheiten über seine Aufträge reden durfte. Und an diese Regel haben sich auch alle gehalten. Immerhin wurde damit gedroht, dass man sonst von der alljährlichen Weihnachtsfeier ausgeladen wird.“
„Verstehe“, sinnierte Ziben, und The Big R konnte am Gesichtsausdruck des Privatdozenten erkennen, dass dieser noch einige andere Fragen geklärt haben wollte. Aber dafür hatten sie jetzt keine Zeit mehr.
„Genug geredet“, rief The Big R und genoss das anführerische Gefühl, dass sich dabei in ihm ausbreitete. „Während wir hier diskutieren, könnte der MG… MZ… MGZOS… der Geheimdienst schon längst auf das gestoßen sein, was er sucht, und dann sieht’s hier zappenduster aus! Wir müssen sie verfolgen!“
„Wenn ich es recht gesehen habe, sind sie auf der Galerie ein Stockwerk über uns weiter hinein in das Gebäude gelaufen, gen Süden“, schilderte Manni seine Beobachtungen.
„Gut“, nahm The Big R den Faden auf, „dann werden wir ihnen dorthin folgen. Manni und Roy, ihr bildet mit mir die Vorhut. Bewaffnet seid ihr?“
„Die Ultrauzis brennen nur darauf, benutzt zu werden“, sagte Roy und lud beide noch einmal geräuschvoll durch.
„Mein guter alter Laserrevolver mag zwar keinen spektakulären Namen haben, aber das kann seinen Opfern dann auch egal sein“, ergänzte Manni.
„Hervorragend“, lobte The Big R, dem die Aussicht auf viel Gewalt bereits das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ. „Ziben, Baalbert, Mickskwir und Abusymbel, ihr bildet eine Viererreihe hinter uns.“
Die vier angesprochenen Herren nahmen diesen Befehl mit Genicke und Gemurmel entgegen, ganz offensichtlich unsicher, wie sie darauf zu reagieren hatten und was überhaupt ihre Rolle bei der kommenden Auseinandersetzung sein sollte. Abusymbel lächelte noch dazu stumm in sich hinein, was The Big R als Anzeichen eines weiteren depressiven Schubes deutete, um den er sich nun aber nun wirklich nicht weiter kümmern konnte.
„Siggy“, beendete er schließlich seine Aufteilung, „du bleibst ganz hinten in Sicherheit. Ich behalte mir vor, dich nach Hause zu deinen Eltern zu schicken, sollte es zu gefährlich werden.“
„Aber…“
„Keine Widerworte. Schon gar nicht von einer Frau! Meine Entscheidung steht fest.“
„Na toll, schönen Dank auch“, nörgelte Siggy, der nun gar nicht mehr nach Kichern zumute war. „Ich schätze mal, mein Motorrad muss ich auch hier lassen? Ich hatte mich doch so gefreut, endlich mal wieder ordentlich das Gaspedal durchzutreten!“
„Das Gaspedal?“, fragte Manni verwundert. „Motorräder haben doch keine Gaspedale.“
„Meins schon“, sagte Siggy stolz. „Auf so doofe Drehgriffe hatte ich einfach keinen Bock mehr, deshalb habe ich mir in der Werkstatt meines Vertrauens ein Gaspedal dranmontieren lassen. Die haben mich vielleicht angeschaut!“
„Alles klar, das Motorrad bleibt hier“, entschied The Big R klar und deutlich. „Motorrad mit Gaspedal? Viel zu gefährlich!“
„Och Männo!“
Nachdem sich die Gruppe die defekten Rolltreppen hinaufgeschleppt und das erste Stockwerk mit seiner einstmals sicher sehr einladenden Galerie erreicht hatte, tat sich ihnen das ganze Ausmaß der Zerstörung auf, von dem sich im Erdgeschoss nur ein kleiner Vorgeschmack befunden hatte. Die einzelnen Ladenlokale und Nischen entlang der Galerie waren teilweise kaum noch als solche erkennbar und glichen eher Müllhalden. Zersplittertes Glas pflasterte ihre Wege und knirschte bei jedem Schritt, den sie darüber taten. Kleinere Feuer loderten noch oder glommen zumindest, der Gestank von verbranntem und verschmurgeltem Plastik, der im Erdgeschoss eine Note unter vielen gewesen war, verschlug ihnen hier stellenweise den Atem. Kleinere und größere Lichter, Neonröhren, Leuchtröhren, Scheinwerfer und LED-Anlagen flackerten und strahlten, tauchten das Stockwerk in ein unstetes Licht. In der Ferne war ein typischer Einkaufszentrumspringbrunnen zu hören, dessen Wasser vor sich hin plätscherte, als sei nie etwas Schlimmes passiert. An einigen Stellen auf dem Kachelboden waren braunrote Flecken zu erkennen, die ab und an ganz eindeutige Blutspuren, an anderer Stelle undefinierbare Muster bildeten. In einigen in Mitleidenschaft gezogenen Blumentöpfen glaubte The Big R sogar, die Überreste eines Babyblauen zu erkennen, besann sich trotz seiner Lust, das näher herauszufinden, aber auf seine eigentliche Aufgabe. Denn wenn die paar MGZSMGNSZZSMGOOZ-Agenten eine ganze Rotte ihrer Feinde derart vernichten konnten – babyblau hin oder her – dann war mit ihnen nicht zu spaßen. Und die am Meteoritenmarkt detailreich ablesbaren Folgen dieser Auseinandersetzung zeigten eindrucksvoll, was für eine Art Kampf dies gewesen sein musste. Jetzt war auch vollkommen klar, warum das Gelände rund um den Meteoritenmarkt weitläufig von allen Menschenseelen verlassen war: Die Explosionen, die hier stattgefunden hatten, mussten das ganze Stadtviertel erschüttert haben.
„Geiler Scheiß“, entfuhr es The Big R bei diesen Gedanken. Manni und Roy, in der Formation links und rechts neben The Big R aufgereiht, sahen ihn fragend an, doch The Big R kam gar nicht mehr in die Verlegenheit, seinen Ausruf erklären zu müssen, denn wieder schallten Motorengeräusche durch die Etage. Sehr laute Motorengeräusche.
„Vorsicht!“, rief The Big R noch, aber seine Worte gingen bereits in dem lauten Knattern und Rattern unter, dessen Ursprung sich bald in einem überdimensionierten Motorrad fand, welches aus der gegenüberliegenden Richtung in einem Mordstempo auf sie zugerauscht kam. Manni und Roy brachten sich, als ehemalige Partner im MGZSMGNSZZSMGOOZ immer noch eingespielt wie eh und je, sofort in Stellung, um bei Bedarf gezielte Schüsse auf das herannahende Gefährt oder seinen in einen mit Rosenquarz paillettierten Overall gehüllten Fahrer abzugeben. The Big R dagegen hatte alle Hände voll zu tun, Siggy zurückzuhalten, damit sie sich nicht auch noch agentenmäßig in Kampfeshaltung begab, was ihr alles andere als passte.
„Das ist Harry Offroad!“, schrie sie The Big R ins Ohr. „Dieser verdammte Angeber mit seinem Xenonxycle!“
„Wie bitte heißt das Ding?“, schrie The Big R ungläubig zurück, während er Siggy schon den halben Arm blau drückte, um sie aus der Gefahrenzone herauszuhalten, in die sie offenbar so gerne eingetreten wäre. Abusymbel, Ziben, Baalbert und Mickskwir hatten sich in der Zwischenzeit in den Ruinen eines ehemaligen Schuhladens in Sicherheit gebracht, um vom Galerieweg wegzukommen.
„Xenonxycle!“, schrie Siggy nochmal. „Finde ich ja auch eine Unverschämtheit! Dieser Trickser! Sowas ist doch kein gültiger Name!“
Harry Offroad war nun gefährlich nahe an sie herangekommen. Wie The Big R bemerkte, hatte er es allerdings gar nicht darauf abgesehen, sie mit seinem Xenonxycle über den Haufen zu fahren. Denn während die Gruppe um The Big R auf der Westseite der Galerie Position bezogen hatte, kam Harry Offroad ihnen auf der Ostseite entgegen, wobei beide Seiten in der Mitte getrennt waren, sodass Harry Offroad mit seinem Xenonxycle schon hätte herüberspringen müssen, um seine Widersacher zu erwischen. Das hielt The Big R zwar nicht für komplett ausgeschlossen, aber wie Harry Offroad stur geradeaus fuhr, machte es zumindest nicht den Anschein, als wollte er doch noch die Seite wechseln.
Als Harry Offroad nahe genug herangekommen war, ließ Roy seine Ultrauzis knattern, was das Zeug hielt, und auch Manni setzte mit seinem Laserrevolver einen um den anderen Schuss. Mit Schrecken mussten sie allerdings feststellen, dass die Projektile allesamt sowohl am Motorrad und dessen Reifen, wie auch an Harry Offroads Overall aus Rosenquarz abprallten.
„Verdammt!“, schrie Roy. „Er hat Nanobomben dabei!“
Kaum hatte der ehemalige MGZSMGNSZZSMGOOZ-Agent es gesagt, warf der aktuelle MGZSMGNSZZSMGOOZ-Agent schon im hohen Bogen eine Handvoll kleiner Kügelchen über die Brüstung der Ostgalerie zu ihnen herüber.
„In Deckung!“, röhrte Manni, war dabei aber ironischerweise der letzte von ihnen, der reagierte.
„Fresst Staub, ihr Pisser!“, brüllte Harry Offroad zu ihnen herüber, während die Nanobomben vielfache Explosionen auslösten, die Scherben in die Luft wirbelten und Kacheln krachend ins Nichts sprengten. An einer Stelle war sogar das Geländer der Galerie weggerissen worden, was The Big R abermals zur Sorge veranlasste, der Weg könne nun viel zu gefährlich für Siggy sein. Diese hatte sich zumindest gerade mit einer eleganten Rolle vor den Explosionen gerettet und war dabei in eine kleine Ladennische, genauer gesagt in die dortige umgefallene Grabbelkiste, gefüllt mit billigen Badelatschen, gefallen. Als sie The Big Rs Blick auffing, reckte sie nur fröhlich den Daumen in die Höhe.
„Wir können ihm mit unseren Waffen nichts anhaben!“, rief Manni. „Hat irgendjemand irgendwelche Vorschläge?“
„Ja, ich!“, fiel Harry Offroad gehässig ein, während er auf der Nordseite der Galerie wendete. „Ich kann euch ein paar meiner Nanobomben überlassen! Und für euch betätige ich sogar schonmal den Auslöser!“ Er ließ ein kehliges Lachen folgen und gab wieder Gas. Er blieb weiter auf der Ostseite und fuhr nun von Norden zurück nach Süden, und es dauerte nicht lange, da wiederholte sich das Spiel von zuvor: Während Manni und Roy aus allen Rohren feuerten oder zumindest aus den Rohren, die sie gerade in der Hand hielten, holte Harry Offroad erneut aus und deckte die Westseite der Galerie mit einer Portion Nanobomben ein. Wieder ertönten mehrere Explosionen, die Splitter zahlreicher Steine, Glasscherben, Metallteile und Blumenerde aus den Dekopflanzen durch die Luft wirbelten. The Big R konnte den teilnahmslos in der Gegend herumstehenden Abusymbel gerade noch herunterreißen, bevor er von einem heranfliegenden Küchenmesser aus einem kleinen Haushaltslädchen geköpft wurde. Er lächelte zum Dank, sagte aber nichts. The Big R brachte ihn rasch zurück in den verwüsteten Schuhladen, denn Harry Offroad war bereits wieder auf der anderen Seite angekommen und startete, sein Xenonxycle dröhnend wie ein Erdbeben, das nächste Wendemanöver.
„Ziben, hast du nichts in deinem Teraturnbeutel, was uns helfen könnte?“, rief The Big R unter den Verkaufstisch, wo der Privatdozent neben Baalbert und dem völlig aufgelösten Mickskwir kauerte.
„Wenn ich etwas hätte, hätte ich es schon längst benutzt“, gab dieser nur verärgert zurück. „Wenn ich gewusst hätte, was uns hier erwartet, dann…“
„Hätte der Hund nicht geschissen, dann hätte er den Hasen gekriegt, jaja“, fiel The Big R ihm ins Wort. „Hat denn keiner eine Idee?“
„Ich hätte eine“, brachte Mickskwir hervor, als er gerade beim geräuschvollen Abknabbern seiner Fingernägel eine Pause einlegte. „Aber ich trau mich nicht! Oh Gott, das ist alles so schlimm!“
„Spuck’s aus, was kannst du tun?“, fragte The Big R hektisch und riss Mickskwir bereits am Arm, um ihn zu sich raufzuziehen, was der alte Mann nur widerwillig mit sich machen ließ.
„Ich könnte eine Barriere mit meinem magischen Erz erschaffen, aber…“
„Was aber?“, brüllte The Big R ihn an. Den Motorengeräuschen zufolge hatte Harry Offroad gerade seine nächste Runde gestartet.
„Aber Sarkophas ist nicht hier und wenn er mir nicht die Hand hält, dann schaffe ich es einfach nicht!“, plärrte Mickskwir los.
„Vergiss Sarkophas, dann hält dir eben jemand anderes die Hand!“, brüllte sich The Big R über den donnernden Motorenlärm heiser. „Ziben!“
„Oh nein, ich gehe ganz bestimmt nicht hier raus!“
„Verdammt, dann Baalbert!“
„Schon gut, schon gut“, sagte der Guru der magischen Substanzen und quälte sich aus seinem Versteck hervor. „Aber ich halte dir nur die Hand, und nichts anderes, ist das klar?“
„Dann kommt jetzt!“, hetzte The Big R und zog die beiden älteren Männer mit sich auf den Gang. Harry Offroad war nicht mehr weit entfernt, Manni und Roy hatten das Feuer bereits eröffnet.
„Ich hoffe, es klappt“, stammelte Mickskwir, als er nun mitten auf dem Gang stand, einen hervorgeholten Brocken magisches Erz fest in der schwitzigen Hand umklammert.
„Das hoffe ich für dich auch, sonst sind wir nämlich gleich nur noch Pulver“, kommentierte Baalbert, während er die andere, ebenfalls schwitzige Hand ergriff.
„Du musst mich Micksimausi nennen, sonst kann ich nicht“, jammerte Mickskwir nervös. Baalbert verdrehte die Augen und wollte zu einer giftigen Erwiderung ansetzen, fing aber rechtzeitig den strengen Blick The Big Rs auf und tat dann einfach, wie ihm geheißen.
„Also gut, Micksimausi. Gib dein Bestes, ja? Ich glaube an dich!“
Mickskwir schloss die Augen und richtete die Hand mit dem Erzbrocken rüber zur Ostseite der Etage, auf der Harry Offroad fast auf Höhe von Manni und Roy angekommen war und bereits zum nächsten Nanobombenwurf ausholte.
Doch zum Wurf kam es nicht. Mitten auf dem Weg, direkt vor Harry Offroad, entstand plötzlich und aus dem Nichts eine blau-transparente Wand, gegen die Harry Offroad prallte und somit von seinem Xenonxycle geholt wurde. Es war ein lautes Krachen, und The Big R erwartete, dass die herunterpurzelnden Nanobomben nun alle explodieren würden, aber offenbar hatte es Harry Offroad nicht mehr geschafft, die Zünder zu aktivieren. Er selbst war nun auch alles andere als aktiviert, sondern lag regungslos auf den Kacheln der Galerie herum, während die blaue Wand vor ihm langsam verschwand. The Big R riskierte noch ein paar Blicke herüber. Das Xenonxycle war noch ganz, aber der Motor war abgestorben, sodass es friedlich – wenn man mal davon absah, dass es einen guten Teil von Harry Offroads rechtem Bein unter sich begraben hatte – und still auf dem Boden ruhte.
„Der ist wohl hinüber“, stellte The Big R lakonisch fest.
„Krasser Scheiß“, zeigte sich Baalbert begeistert, während er den mittlerweile ergrauten Klumpen in Mickskwirs Hand inspizierte. „Mit dem Erz kann man wirklich zaubern? Also so richtig, richtig im Ernst zaubern? Ich hab die Scheiße einfach immer nur weggeraucht oder durch die Nase gezogen! Wenn ich das gewusst hätte! Alle Achtung, Micksimausi!“
„Ich halte von diesem Magiezeug eigentlich nur wenig“, sagte Ziben, der sich nun mit Abusymbel im Schlepptau zurück auf die Galerie gewagt hatte. „Aber das war in der Tat beeindruckend, Mickskwir.“
„Danke“, hauchte Mickskwir und wurde ein wenig rot. Nach kurzem Schweigen trat ein allgemeiner Konsens ein, dass nun genug Komplimente ausgetauscht waren und die nächsten Aufgaben angegangen werden mussten.
„Wenn wir weiter gen Süden gehen, kommen wir zur Bootshalle“, erklärte Manni, der seinen – bisher eher nutzlos gebliebenen – Laserrevolver neu justierte. „Da sollten wir wirklich vorsichtig sein.“
„Eine Bootshalle im ersten Stock?“, fragte The Big R, erhielt aber von niemandem eine Antwort darauf, was sich die Erbauer des Meteoritenmarkts dabei gedacht hatten. Nicht einmal Mickskwir, der sich mit Erbauern aller Art auskannte, spendierte ihm eine Antwort, aber das mochte auch daran liegen, dass er noch ganz außer sich von seiner spektakulären Rettungsaktion war.
Die Gruppe setzte sich in Bewegung, und nach nur einigen wenigen Metern über die nun wirklich ruinierten Galerien – The Big R fragte sich, wie viele Bomben hier wohl schon insgesamt eingeschlagen waren – bewahrheitete sich Mannis Ankündigung. Die Galerie mündete in einer riesigen Halle, in die ein ebenso riesiges Becken eingelassen war, welches mit Wasser gefüllt war und Fahrzeuge aller Art beinhaltete. Von der kleinsten Nussschale bis hin zum handlichen Kreuzfahrtschiff war hier alles mögliche ausgestellt und wartete auf potentielle Käufer – die am heutigen Tage, Ladenöffnungszeiten hin oder her, jedenfalls nicht mehr auftauchen würden. Durch das riesige Glasdach, das die gesamte Halle überdeckte, war gut zu erkennen, dass die Sonne so langsam unterging. Nervös ließ die Vorhut – weiterhin bestehend aus The Big R, Manni und Roy – ihre Blicke über die zahlreichen Schiffe und Boote schweifen. Es war allerdings Siggy, die als erstes eine Entdeckung machte.
„Verflixt, sie haben sich die Yuppieyacht gekapert!“, rief sie verärgert. „Dass sich diese Mistkerle ausgerechnet im einzigen bewaffneten Boot dieser Halle verschanzen müssen! Ich wette, das war Carmen Bushycats Idee! Dieses verschlagene Miststück!“
„Woher kennst du dich denn so mit den Booten hier aus, Siggy?“, fragte Manni verwundert.
„Naja“, gab die Ex-Agentin nach einigem Herumdrucksen zu. „Ich habe mal den Sohn des Eigentümers… äh, getroffen. Zusammen mit Carmen. Ach, fragt lieber nicht weiter nach.“ Sie kicherte und fuhr sich durch ihr blondes Haar. The Big R konnte darüber nur noch den Kopf schütteln.
„Wie auch immer“, meinte er. „Wir sollten dann wohl wirklich auf der Hut sein.“
Wie, als hätte er es zur Bekräftigung seiner Worte bestellt, löste sich ein Schuss aus dem Gewirr von Booten und schlug direkt hinter ihnen in die Reste eines Schaufensters ein, die nun in zigtausende Teile zersplitterten. Fast synchron warf sich die Truppe um The Big R zu Boden. Erst nach einer geschlagenen Minute trauten sich die ersten, zumindest langsam in eine geduckte Hocke zu gehen.
„Das sieht gar nicht gut aus“, zischte Roy. „Wir sind geliefert!“
„Sie haben Maschinengewehrstellungen und noch viel Schlimmeres an Bord“, flüsterte Siggy. „Wir laufen ins offene Feuer, wenn wir uns der Yuppieyacht weiter nähern.“
The Big R starrte in die Ferne, wo er endlich unter all den anderen Wasserfahrzeugen den Bug der Yuppieyacht erspähen konnte. Tatsächlich sah er mehrere am Oberdeck befestigte Stellungen, von denen mindestens zwei mit Agenten des MGZSMGNSZZSMGOOZ besetzt waren.
„Wo habe ich es denn, es müsste doch…“, murmelte Ziben, der, wie The Big R nun sah, bereits einige Zeit damit beschäftigt war, in seinem Teraturnbeutel herumzukramen.
„Sag bloß, du hast jetzt doch noch was Sinnvolles für uns dabei, Ziben?“, neckte The Big R.
„Spar dir deinen Spott“, erwiderte Ziben kampfeslustig, „denn wenn du erst einmal Bekanntschaft mit dem Werkzeug unserer Rettung gemacht hast, wirst du mir zu Füßen liegen.“
„Habe ich gerade schon getan… du weißt schon, als wir uns auf den Boden geworfen haben, um in Deckung zu gehen. Klingelt’s da, Ziben?“
Der Privatdozent überging den gehässigen Kommentar, wühlte geruhsam weiter in seinem nimmervollen Behälter herum und machte schließlich große Augen, als er offenbar gefunden hatte, wonach er gesucht hatte. Er zog einen länglichen Metallgegenstand heraus, der sich alsbald als Schusswaffe entpuppte. The Big R klappte beinahe die Kinnlade herunter, denn er hätte vorher nicht gedacht, Ziben jemals derart bewaffnet zu sehen.
„Da staunst du, was?“, sagte er, während er sanft über die Waffe strich und probeweise einmal durch das Zielfernrohr spinkste. „Darf ich vorstellen: Das Gerontogewehr!“
„Das Gerontogewehr?“, fragte The Big R und wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte.
„Naja, weißt du“, begann Ziben zu dozieren, ganz offenkundig dankbar über die verwunderte Nachfrage. „Ich habe zwar noch keinen Tatter und einen Rollator benötige ich auch nicht. Aber sehen wir der Wahrheit ins Auge, irgendwann wird das noch kommen. Ich brauche mir ja nur Sarkophas anzuschauen, um zu sehen, was mir blüht. Und es hat mich einfach immer geärgert, dass es keine schlagfertigen Waffen speziell für alte Leute gibt. Da dachte ich mir: Warum weiter ärgern, wenn ich diesen Missstand doch selbst beheben kann? Bis zur angestrebten Zielsuchfunktion hat es dieser Prototyp hier zwar noch nicht gebracht, aber das Zielfernrohr ist ja schon einmal ein guter Anfang.“
The Big R blieb skeptisch. „Und du kannst dieses Ding bedienen?“
„Ich habe schon einmal ein paar Probeschüsse abgegeben“, erklärte Ziben stolz. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir möglich sein wird, die Schützen auf der Yuppieyacht außer Gefecht zu setzen.“
„Tja, wenn keiner einen besseren Vorschlag hat…“, raunte The Big R und blickte sich hilflos zu den anderen um, „… dann schieß los, Ziben!“
Ziben ließ sich allerdings Zeit. Er prüfte noch einmal die Zusammensetzung des Gewehres, sah durchs Zielfernrohr, legte die Waffe immer wieder an und ab, bis er eine für sich anscheinend komfortable Position gefunden hatte, um sie abzufeuern. Aber auch dann dauerte es noch eine Weile, in der Ziben immer wieder sein Ziel veränderte, dabei wirre Formeln murmelte und wechselnde ballistische Annahmen verbreitete.
„Ja, das müsste es sein“, sagte er dann schließlich. „Wenn ich ein paar Zoll drüber ziele, müsste das Projektil genau…“
The Big R hatte in diesem Moment gar nicht damit gerechnet, da löste sich schon geräuschvoll ein Schuss aus dem Gerontogewehr, der kaum eine Sekunde später mit einem lauten Aufschrei quittiert wurde.
„Direkt in das linke Bein dieses Jacques Peris!“, jubelte Ziben, und The Big R zuckte bei Nennung dieses Namens kurz zusammen. „Der ist schonmal außer Gefecht gesetzt!“
Schon im nächsten Augenblick musste The Big R erneut zusammenzucken, denn was folgte, war ein regelrechtes Inferno an Maschinengewehrsalven, welches nun über sie hereinbrach. Die entsprechende Vorrichtung auf der Yuppieyacht war zwar anscheinend zu keiner hinreichenden Neigung in der Lage, sodass die Kugeln über die noch immer geduckt hockenden Streiter hinwegflogen, doch dafür entwickelte sich ein wahres Sperrfeuer, welches jegliches Vorankommen verhinderte.
„Ja los!“, rief The Big R über den Lärm hinweg Ziben zu. „Du musst nachlegen! Vorher hören die nicht mehr auf!“
„Das würde ich ja gerne!“, schrie Ziben zurück, der dabei ganz seinen wissenschaftlichen Habitus verlor. „Aber der Prototyp des Gerontogewehrs ist nicht darauf ausgelegt, mehrere Schüsse hintereinander abzufeuern!“
„Machst du etwas Witze?“
„Nein, ganz und gar nicht! Es ist eben so, dass die Austrittsgeschwindigkeit für das Material, dass ich verwendet habe, zu hoch ist, und die entstehende Reibungshitze den Lauf zu seinem Ende hin verzieht, sodass…“
„Ich fasse es nicht!“, brüllte The Big R dazwischen. „Dann ist dein scheiß Altherrengewehr ja komplett nutzlos!“
„Ich habe immerhin einen Treffer gelandet!“, verteidigte Ziben sich, sah dann aber offenbar selber ein, dass damit nicht viel gewonnen war. „Und nun?“, fragte er nach einer Weile.
„Ich werde mich für euch opfern!“, schrie Abusymbel auf einmal und wollte schon aufspringen, wobei er so gerade noch von The Big R davon abgehalten werden konnte. „Gebt mir eine Waffe! Ich werde die Yuppieyacht stürmen und euch so den Weg frei machen!“
„Du bist doch bescheuert!“, rief The Big R kopfschüttelnd. „Wie stellst du dir das bitte vor? Wie soll das funktionieren?“
„Rafael hat recht“, sprang Manni ihm bei. „Du würdest doch sofort dabei umkommen!“
„Ich habe so das Gefühl, dass er genau das damit bezweckt“, meinte Baalbert. „Aber ich gebe euch trotzdem recht, ich habe keinen Bock, von seinen umhersprotzelnden Innereien getroffen zu werden. Abusymbel, du bleibst hier!“
Zur Bekräftigung seiner Absicht schlang sich Baalbert nun um Abusymbel, um ihn an jeglicher weiteren Bewegung zu hindern.
„Na toll“, gab der Südländer in unzureichender Lautstärke zu Protokoll. „Dann will ich mich einmal nützlich machen, und dann lässt mich doch keiner. Ich wollte doch auch einfach nur mal der Held sein. Vielen Dank. Und da wundern sich alle, dass ich depressiv werde.“
Abusymbel murmelte noch einige Sachen in seinen nicht vorhandenen Bart hinein, aber The Big R hörte gar nicht mehr weiter hin. Für ihn war das Thema erledigt. Ganz und gar nicht erledigt waren allerdings nach wie vor die nicht enden wollenden Salven aus dem Maschinengewehr auf der Yuppieyacht, die ihnen noch immer den Weg versperrten. The Big R räusperte gerade seine vom vielen Schreien bereits schmerzhaft strapazierte Kehle, um die anderen nach Lösungsvorschlägen für ihr Problem anzuschreien, da trat auch schon eine neue Lärmquelle hinzu, die es The Big R einerseits unmöglich gemacht hätte, sich noch hörbar zu artikulieren, andererseits aber auch seine Frage nach Lösungen mehr oder minder überflüssig machte.
In einem Moment der Überraschung, da durch den Gewehrlärm in seinen Rotorgeräuschen ungehört, senkte sich ein Helikopter über dem Glasdach herab, den die anwesenden Streiter rund um The Big R schnell als den Helikopter Sarkophas’ identifizierten. Noch bevor einer der Beobachter sein Erstaunen irgendwie ausdrücken konnte, stürzte der Helikopter schon durch das Glasdach herab, durchbrach scheppernd die Scheiben und landete direkt auf dem Oberdeck der Yuppieyacht, die dadurch so schwer beschädigt wurde, dass sie bereits im nächsten Moment das Sinken begann. The Big R konnte es zwar nicht sehen, aber da das Maschinengewehrgedonner von einer Sekunde auf die andere aufhörte, ging er davon aus, dass die feindlichen Agenten die Yuppieyacht fluchtartig verlassen hatten. Trotzdem wollte er sich nicht in falscher Sicherheit wiegen und die anderen entsprechend zur Vorsicht mahnen, wurde bei diesem Vorhaben aber von dem für sein Alter erstaunlich flink losstürmenden Mickskwir sabotiert.
„Sarkophas!“, rief er, während er unbedacht auf das Bootsbecken zurannte. „Mein Sarkospatz, ist dir etwas passiert?!“
The Big R blieb nicht einmal die Zeit, sich über diese unbedachte Aktion Mickskwirs irgendwie zu mokieren. Er tat es den anderen aus der Gruppe gleich und rannte Mickskwir hinterher. Nach einiger Zeit waren sie am Rande des Bootsbeckens angekommen, an dem Mickskwir atemlos und die Hände auf die Oberschenkel gestützt verharrte. Glücklicherweise musste sein angestrengtes Herz nicht noch einen Schock verdauen, denn aus dem Cockpit des Helikopters lehnte sich Sarkophas heraus, in voller Pilotenmontur, winkte ihnen zu und reckte einen Daumen in die Höhe.
„Keine Sorge, nichts passiert!“, rief er mit brüchiger Stimme zu ihnen herunter. Gleichzeitig war der Ausdruck des Erstaunens in seinem Gesicht über die Landung auf einer Yacht so deutlich, dass er selbst aus der Distanz gut zu erkennen war.
„Sowas habe ich auch noch nie gemacht“, bekundete er dabei leicht amüsiert. „Aber mir ist wirklich nichts passiert… sagte ich bereits, oder? Ich weiß auch nicht, ich muss eingeschlafen sein während des Flugs, und auf einmal höre ich einen Knall und finde mich auf diesem Boot wieder! Sachen gibt’s!“
„Und dir geht es auch wirklich gut, Sarkospatz?“, fragte Mickskwir immer noch leicht besorgt.
„Aber ja doch, Micksimausi“, kam die Antwort zurück, so gut gelaunt, dass es den Magier tatsächlich etwas beruhigen konnte. „Aber ich fühle mich nur so… so müde…“
„Und da ist er auch schon wieder eingepennt“, kommentierte Baalbert.
„Und was machen wir jetzt?“, fragte Manni besorgt. „Wir können ihn ja schlecht einfach in seinem Helikopter sitzen lassen!“
„Ach, wieso denn nicht?“, fragte Siggy kichernd. „Er sieht so friedlich aus!“
„Sehe ich ähnlich“, merkte The Big R an. „Die Yuppieyacht scheint jedenfalls nicht weiter zu sinken. Sie wird auf Grund gelaufen sein – das Schaubecken hier ist nicht so tief. Und der Helikopter hat sich bombenfest an der Reling verkantet. Ich glaube, da ist Sarkophas gerade sicherer als an jedem anderen Ort.“
„Und die Agenten scheinen jetzt ohnehin wieder ein Stockwerk tiefer ihr Unwesen zu treiben“, meinte Roy und wies auf die geöffnete Tür zum schmalen Treppenhaus, welches sich auf der Ostseite der Halle befand. „Die haben ’nen Abgang gemacht.“
„Dann müssen wir ihnen hinterher“, entschied The Big R. „Mickskwir, mach dir bitte keine Sorgen, Sarkophas geht es gut, siehst du doch.“
Mickskwir war noch etwas bleich und wusste wohl nicht so recht, wie er sich verhalten sollte, schlussendlich aber rang er sich zu einem Nicken durch und machte sogar die ersten paar Schritte in Richtung des Treppenhauses – freilich nicht ohne dann und wann noch einmal einen kontrollierenden wie besorgten Blick auf den im Pilotensitz schlafenden Sarkophas zu werfen.
„Seht ihr, an dem könnt ihr euch ein Beispiel nehmen“, sagte The Big R mit einer gehörigen Portion Ernst in der Stimme und machte sich ebenfalls auf den Weg zum Treppenhaus. Dann setzte sich auch der Rest der Gruppe in Bewegung.
Ganz offensichtlich trieben die Agenten des MGZSMGNSZZSMGOOZ nicht nur ein, sondern gleich zwei Stockwerke tiefer, mithin im Kellergeschoss, ihr Unwesen. Das enge Treppenhaus, das The Big R an verwandte Treppenhäuser in schäbigen Parkhäusern erinnerte, zeigte eindeutige Spuren, welchen Weg die feindliche Agenten genommen haben mussten, und tatsächlich stand die Tür zum Ausgang in den Keller noch offen, als die Gruppe sie nach ihrem kleinen Gänsemarsch hinunter erreichte. Als The Big R die Tür durchschritt, fühlte er sich nur umso mehr an schäbige Parkhäuser erinnert – denn er stand nun auf einem noch viel schäbigeren Parkdeck.
„Wir sollten wirklich vorsichtig sein“, flüsterte Roy, während er nach The Big R und Manni das Treppenhaus verließ. „Es sähe dem MGZSMGNSZZSMGOOZ nicht unähnlich, wenn er die ein oder andere Falle für uns vorbereitet hätte.“
„Alle Achtung, Roy!“, schallte eine Stimme zu ihnen durch die Betonwüste aus Parklücken, Abgasen und vereinzelten Autos. „Der Kandidat hat hundert Punkte! Da haben sich die ganzen Lehrgänge ja doch noch gelohnt, wenn es schon nicht für eine Führungsposition beim MGZSMGNSZZSMGOOZ gereicht hat, was?“
„Nino Nagler!“, stieß Roy aus, und bezeichnete dabei den Mann, der gerade so gehässig von oben auf sie herab gesprochen hatte – und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Agent stand auf der Ladefläche eines Pickups, während er mit einer vorkriegselektronisch anmutenden Fernbedienung herumwedelte.
„Nino, wie kannst du das nur tun!“, schimpfte Siggy, die sich dem allschützenden Klammergriff The Big Rs entwunden hatte und nun nach vorne in die erste Reihe stürmte. „Ich dachte immer, du seist ein guter Kerl!“
„Und ich dachte, der MGZSMGNSZZSMGOOZ sei dazu da, um die Menschen zu beschützen“, fügte Manni vorwurfsvoll und mit grimmigem Blick hinzu. Nino Nagler hatte dafür nur ein hämisches Lachen übrig.
„Dann habt ihr die Unternehmensbeschreibung wohl nicht richtig gelesen“, höhnte er. „Wir sind ein Geheimdienst. Wir machen, was wir wollen. Und davon wird uns auch kein gescheiterter Ex-Agent abhalten können. Auch nicht drei davon. Da könnt ihr zu dreihundert kommen, ihr habt einfach keine Schnitte. Seht es ein!“
The Big R ignorierte den schurkischen Monolog Nino Naglers so gut es ging und nestelte an seinem Gürtel herum, um den in seiner Wohnung eingesteckten Ionenbums hervorzuziehen, doch was dann geschah, ließ ihn erstarren. Denn Nino Nagler hatte auch nicht lange gefackelt, war vom Pickup heruntergesprungen und hatte auf die altmodische Fernbedienung gedrückt. Mit einem Mal und unter lautem Gequietsche und Geknirsche schoss der Pickup mit seiner Vorderachse voran in die Höhe, und am unteren Ende der Ladefläche verformte sich das Metall zu zwei Stümpfen, die so etwas wie Standfüße bildeten. Auch der Rest des nun aufrecht stehenden Kraftwagens transformierte sich nun, bildete zwei Armstümpfe und einen durch das Führerhaus geformten Kopfstumpf aus und nahm so mehr und mehr humanoide Formen an.
„Viel Spaß mit dem Oberoschi!“, lachte Nino nur, als sich aus dem eingangs harmlos erscheinenden Pickup nun ein wahrer Kampfroboter gebildet hatte, dessen Pose nichts anderes als den – natürlich vorher einprogrammierten – Willen zur Vernichtung ausdrückte.
„Oh nein, sie haben den Oberoschi dabei“, kommentierte Siggy etwas redundant. „Der macht uns platt!“
The Big R wollte solche Bedenken nicht hören, immerhin war er The Big R, und seinem Ionenbums hatte noch nie etwas standgehalten. Er richtete die gezogene und auf Maximum eingestellte Waffe direkt auf den noch bewegungslosen Oberoschi und drückte ab. Einmal, zweimal, dann dreimal. Noch zweimal. Bis der Ionenbums leer war. Und ja, es hatte gescheppert. Radkappen von umherstehenden Autos waren abgeflogen, Metallgitter klapperten ob der immensen Druckwellen, auch Fensterscheiben waren zersplittert. Aber abgesehen davon war genau folgendes passiert: Nichts. Selbst Nino Nagler, der von den Stößen eigentlich bis ans Ende des Parkdecks oder sogar noch durch die Wand hinaus hätte geschleudert werden müssen, trat feixend hinter dem Oberoschi hervor, den er rasch zur Deckung genutzt hatte. Und der Oberoschi selbst war nicht nur einen Millimeter nach hinten verschoben worden.
„Gravitationsmanipulator“, erklärte Nino Nagler knapp. „Habe ich selbst eingebaut. Gut, was?“
The Big R biss derart wütend die Zähne aufeinander, dass er um ihren Verlust bangen musste, aber das war ihm gerade vollkommen egal. In diesem Moment schwor er sich, nie wieder Steuern zu bezahlen, wenn die Gelder in so einen vermaledeiten Geheimdienst und dessen Tötungsmaschinen flossen. The Big R hatte zwar prinzipiell nichts gegen Tötungsmaschinen, ganz im Gegenteil. Aber wenn sie nicht auf seiner Seite standen, lagen die Dinge nun einmal ganz grundsätzlich anders.
„Ich hoffe, ihr habt euer Testament bereits gemacht“, rief Nino Nagler. „Patientenverfügungen und Organspendeausweise werden jedenfalls nicht notwendig sein. Denn wenn euch der Oberoschi erst einmal zerquetscht hat, ist von euch nichts mehr übrig!“
Nino Nagler rüttelte etwas theatralisch – vielleicht war es aber auch der verbauten Technik geschuldet – an der Fernbedienung und ließ den Oberoschi auf die Gruppe um The Big R zu stampfen. Dabei achtete er trotz seiner zur Schau gestellten Überlegenheit peinlich genau darauf, hinter dem Pickup-Roboter zu bleiben und ihn so weiterhin als Schutzschild vor eventuellen Schüssen seiner Gegner zu benutzen. Angesichts der nun ausgebreiteten Arme des Oberoschis wollte weder The Big R noch jemand anderes aus der Gruppe den Versuch wagen, um ihn herumzulaufen und Nino Nagler von der Seite zu attackieren.
„Wir sind geliefert“, murmelte Manni, dessen Worte teilweise in den rhythmischen Stampfern des Oberoschis untergingen. „Wieder einmal.“
Auch die anderen Mitstreiter The Big Rs blickten ratlos wie fassungslos drein. Siggy war derart bedröppelt, dass sie sich nicht einmal darum bemühte, ihre ins Gesicht gefallene Haarsträhne wegzustreichen. Abusymbel lächelte in sich hinein und offenbarte so auf seine ganz eigene Art tiefste Verzweiflung. Roy und Manni sahen sich in so aktionistischer Weise um, dass sie damit sofort verrieten, dass sie keinen rettenden Plan auf Lager hatten. Ziben versuchte nicht einmal, ein rettendes Etwas aus seinem Teraturnbeutel hervorzuziehen. Mickskwir standen die Tränen in den Augen, während er vermutlich gerade daran dachte, wie sein oben friedlich schlafender Sarkophas ihn nie mehr wiedersehen würde – zumindest nie mehr in dem Volumen, in dem er sich jetzt noch befand. Und Baalbert – der ging ein paar Schritte auf Mickskwir zu und klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter.
„Ey sag mal, Mickskwir“, sagte er mit viel zu lässigem Tonfall. „Du hast doch sicher noch ein paar Reservebrocken vom Erz übrig, oder? Keine Angst, ich will nix schnorren! Ich meine ja nur… das mit deiner Zauberbarriere vor hin, das war echt ganz großes Damentennis. Meinst du nicht, du könntest den Move nicht nochmal bringen? Einmal um diesen Oberfuzzi drumrum? Dann kann der stark sein so viel wie er will, aber er wird niemals an uns rankommen.“
„Und in der Zeit“, fing The Big R begeistert die Worte auf, „in der Zeit kümmern wir uns um Nino Nagler!“
„Und beschaffen uns die Fernbedienung!“, fügte Ziben hinzu, der dabei sogar noch die Nerven hatte, wissenschaftliches Interesse durchklingen zu lassen.
„Ich… ich glaube“, stammelte Mickskwir und war gewohnt unschlüssig, wurde dabei aber von Baalbert – ungewohnt geistesgegenwärtig – schnell noch energischer motiviert.
„Nicht glauben!“, sagte er entschlossen. „Du schaffst das! Ging doch vorhin auch! Mach deinen Sarkospatz stolz! Und wenn es dir hilft, ich kann auch wieder deine Hand halten. Ach was, ich halte dir alles, was du willst! Wenn du nur eine Barriere um diesen ausgetickten Pickup zauberst, die sich gewaschen hat! Hau rein, Mann! Ich zähl’ auf dich!“
„Na… na gut“, seufzte Mickskwir und wurde ganz bleich, während er seine Ärmel raffte und gleich zwei Brocken Erz aus der Innentasche seines Mantels hervorholte. Er zitterte dabei und schien auch zu schwanken, sodass The Big R sich genötigt fühlte, den ihm angestammten Platz in der ersten Reihe vor dem herannahenden Oberoschi zu verlassen und sich hinter Mickskwir zu stellen, um diesen bei Bedarf aufzufangen. Aber dergleichen war nicht nötig. Mickskwir ergriff nicht einmal die Hand, die Baalbert ihm als sanftes Angebot ausgestreckt hielt – was wohl in erster Linie daran lag, dass Mickskwir beide Hände benötigte, um in jeder einen Erzbrocken zu halten. Gerade in dem Moment, als The Big R befürchtete, den mit geschlossenen Augen abwartenden Mickskwir hätten doch noch die Kräfte und der Mut verlassen, riss dieser beide Arme in die Höhe und seine Augen wieder auf. Zwei zuckende Blitze entwichen den nun blau glühenden Erzbrocken und trafen sich in etwa eine Schrittlänge – gerechnet in Oberoschischritten – vor dem transformierten Pickup, was Nino Nagler zu einer weiteren gehässigen Bemerkung verleitete.
„Was auch immer ihr für bemitleidenswerte Magie in petto habt“, ätzte er, „wenn euer Haus- und Hofzauberer nicht einmal richtig zielen kann, dann wird das sowieso nichts!“
Das prätentiös schurkische Lachen Nino Naglers erstarb jedoch, als er mit ansehen musste, dass der Oberoschi – nun umhüllt in einem glitzernden, blau-transparenten Kasten aus reiner Energie – nicht mehr von der Stelle kam und gegen eine undurchdringliche Wand anlief. Auch das hektische Herumdrücken auf den großen Knöpfen der Fernbedienung brachte Nino Nagler nicht den gewünschten Erfolg. Denn auch wenn er es fertig brachte, den Oberoschi einmal nach links, einmal nach rechts und schließlich einmal um die eigene Achse zu drehen, so blieb der gigantische Roboter auf Kraftwagenbasis in dem blauen Kasten gefangen.
„Klasse Mann!“, johlte Baalbert zu Mickskwir gewandt, der dies in seiner angestrengt-konzentrierten Haltung aber gar nicht so richtig wahrzunehmen schien. „Das isses!“
„Das Spiel ist aus, Nino Nagler!“, rief Siggy triumphierend, während sich auf Nino Naglers Stirn Schweißperlen bildeten, die denen auf Mickskwirs Haupt in Nichts nachstanden. Sie, die Schweißperlen, flogen ein wenig durch die Gegend, während Nino Nagler mit vollen Körpereinsatz auf seiner Fernbedienung einhackte, unfähig zu erkennen, dass selbst das beste Steuerungsmodul an seiner Situation nichts geändert hätte.
„Auf ihn!“, brüllte The Big R nun, ganz in seinem Element und rasch wieder in der vordersten Reihe, während er zusammen mit Manni, Roy und nun auch der wie entfesselten Siggy auf Nino Nagler losstürmen wollte – als er seinen überstürzten Ausfall auch sogleich wieder bereute, weil sein Übereifer ihn glatt in eine Kette aus Explosionen hineingeritten hätte, die durch einen Schwung Nanobomben ausgelöst wurde. Er konnte seinen Lauf gerade noch rechtzeitig abbremsen und zudem den Stoß, denn Siggy ihm mangels rascher Reaktion versehentlich in den Rücken versetzte, abfangen. Einen Schritt weiter, und seine Füße wären zu Klump gesprengt worden. Da nahm er die Asphaltsplitter, die in sein Gesicht gepeitscht kamen, als Ersatz für ein Untergehen in den populärsten Sprengstoffen der Postmoderne gerne in Kauf.
„Ihr habt doch wohl nicht geglaubt, dass wir es euch so einfach machen, oder?“, lachte eine hohe Frauenstimme. Die Blicke der Gruppe gingen allesamt nach links. Dort stand eine Frau in einem formschönen Agentenanzug, die offenbar aus dem kleinen Kabuff herausgekommen war, welches unter normalen Umständen einem Parkhauswächter als Aufenthaltsraum gedient hätte. Die getönte Scheibe, die in beispielloser Weise alle fünf von The Big R abgegebenen Maximalstöße mit dem Ionenbums überlebt hatte, ließ vermuten, dass die Frau ihre Auseinandersetzung mit Nino Nagler die ganze Zeit beobachten haben musste. The Big R ärgerte sich, dass er diesen Raum nicht viel eher in den Blick genommen hatte.
„Carmen Bushycat!“, übernahm Roy weniger aus Höflichkeit denn aus Entsetzen die Pflicht, die Agentin vorzustellen. Dieser gefiel ihre Rolle offenbar blendend, denn sie warf gekonnt ihre rote Mähne zurück über die Schulter und richtete ihre gut sichtbaren Hüften wie zwei Scheinwerfer auf die Gruppe aus, als erwartete sie, dass die Meute jeden Moment ihre Fotoapparate zücken und wildestes Knipsen anfangen würde. Carmen Bushycats Gesichtsausdruck war zwar zu entnehmen, dass sie nicht wirklich an das Entstehen so einer Szene geglaubt hatte. Dass nun aber gar keine weitere Reaktion von ihrem Publikum kam, das stieß ihr erkennbar sauer auf.
„Na gut, na gut!“, höhnte sie. „Warum auch selber viel reden, wenn das auch jemand anderes übernehmen kann, nicht wahr?“
The Big R wusste nicht mehr, worauf er sich noch konzentrieren sollte. Auf den vor Anstrengung bebenden Mickskwir im Kampf mit dem eingesperrten Oberoschi, der weiter auf der Stelle herumstampfte; oder auf den seine Fassung und sein breites Grinsen wiedergewinnenden Nino Nagler, der das hektische Herumtippen auf seiner Fernbedienung endlich aufgegeben hatte; oder auf Manni und Roy, die ebenfalls nicht wussten, ob sie nun einfach wie wild um sich schießen oder lieber doch noch die Lageentwicklung etwas abwarten sollten. Die Entscheidung wurde ihnen jedoch umgehend abgenommen.
„Viel Spaß mit unserer Quasselquelle“, rief Carmen Bushycat und ließ den aus ihrem umgehängten Beutel hervorgezogenen quaderförmigen Gegenstand mit ein wenig Schwung aus ihrer Hand gleiten.
Die kleine Box stolperte geräuschvoll über den rauen Boden, kam irgendwann zum Stehen, rumpelte und wackelte ein wenig hin und her und öffnete sich dann oben in der Mitte. Sofort erfüllte ein ohrenbetäubender Lärm das gesamte Parkdeck.
„JAAAAA DAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALS NE“
Der Schalldruck riss die Gruppe um The Big R von den Füßen und warf sie zu Boden. Der überraschte Mickskwir musste seinen Fall dabei sogar leider mit seinem Gesicht abbremsen, was neben einem gedämpften Schrei auch das sofortige Zusammenbrechen des von ihm geschaffenen Barrierenkäfigs zur Folge hatte.
„FRÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜHEEEEEEEEEEEEEEEEEEER DAS WAR NOCH WAS NEEEEECH“
„Ach du Scheiße, was ist das denn?“, rief Baalbert zum neben ihm auf dem Betonboden liegenden Big R, der sich hilflos die Ohren zuhielt und seinen Mitstreiter im Grunde nur durch Lippenlesen verstehen konnte.
„Verdammt, das sind Schreie der Vergangenheit!“, formte er mit den Lippen, in Unkenntnis darüber, ob tatsächlich auch Worte aus seinem Mund kamen, was angesichts des raumfüllenden Lärms aber ohnehin ohne größere Bedeutung war. „Diese Schweine! Dass sie so weit gehen müssen!“
„DAS WAAAAAAAREN NOCH ZEEEEEEEITEEEEEEN ICH ERINNERE MICH GENAUUUUUUUUUUUU“
Hektisch suchte The Big R nach dem in akademischer Hinsicht Höchstqualifizierten der Gruppe, bis er ihn schließlich direkt hinter dem sich in einer gequälten Grimasse die Zähne förmlich aus dem Mund beißenden Manni fand.
„Ziben, wir haben keine Chance“, gab The Big R ihm zu verstehen. „Verteil das Omniohropax an alle, schnell!“
„Rafael, das geht nicht“, artikulierte Ziben zurück. „Sie haben doch schon den Oberoschi bei sich! Der Buchstabe O ist bereits besetzt!“
„Ach, verdammte Scheiße“, knurrte The Big R in sich hinein, halb aus Ärger über ihre aussichtslose Situation, zur anderen Hälfte darüber, dass er darauf nicht selbst gekommen war. Sie hätten das Omniohropax einfach schon vorsorglich benutzen sollen, dann wäre ihnen diese Bredouille erspart geblieben.
„ALS WÄR ES GESTERN GEWESEN DU ALS WÄR ES GESTERN GEWESEEEEEEEEEEN“
Zu allem Überdruss nutzte Nino Nagler gewohnt hämisch grinsend – und wie seine Agenten-Kollegin wohl mit Gehörschutz versorgt – die Gelegenheit, um den nun wieder befreiten Oberoschi erneut auf seine hilflosen Widersacher zu hetzen. Jeder Schritt des gewaltigen Roboterkolosses bedeutete eine heftige Erschütterung, die die am Boden liegenden Streiter um The Big R nun besonders intensiv wahrnahmen. The Big R selbst jedoch wollte sich nicht damit abfinden, zwischen dem gekörnten Boden eines Parkdecks und dem kaltgewalzten Aluminium des Fußes einer gigantischen Tötungsmaschine zerquetscht zu werden.
„RAFAEEEEEEEEEEEEEEEL WAR ES DENN DAMALS NICHT VIEL SCHÖÖÖÖÖNEEER MIT RIIIITAAAAAA“
The Big R unterdrückte die Panik, die die Schreie der Vergangenheit in ihm hervorrufen wollten. Wenn sie jetzt derartige Erinnerungen auspackten, würde er in Nullkommanichts vollkommen auf dem Zahnfleisch gehen. Das musste er verhindern. Und wie er mit einem Seitenblick erkennen konnte, brauchte er dabei nicht auf die Hilfe seiner Mitstreiter zählen, die sich, von den Schreien der Vergangenheit gequält, auf dem Boden krümmten und wanden, bis auf weiteres außer Gefecht gesetzt. Jetzt lag es mal wieder an ihm, The Big R. An ihm allein. Dem Mann, der selbst tausend fähigste Agenten auf einen Streich besiegen konnte, einfach, weil er nun einmal The Big R war. Das war seine Rolle, das war seine Bestimmung. Wenn ihm jetzt nicht einfiel, wie er den Kampf noch drehen konnte, dann war alles aus.
„SO SCHÖÖÖÖÖÖÖÖÖN WAR DIE ZEIIIIIIIIIIIIIIIT“
Und natürlich fiel ihm etwas ein. The Big R war so stolz auf seine Idee, dass er hätte grinsen können, wenn er nicht gewusst hätte, dass er zur Umsetzung seines Plans nun gleich mindestens eine Hand von den Ohren nehmen musste, und ihm dann bei den ungefilterten Schreien der Vergangenheit höchstens schmerzhafte Grimassen möglich sein würden. Aber das nahm er in Kauf. Er war ständiges Gekreische von Ritas blöder Schwester gewohnt, oder zumindest mal gewohnt gewesen. Dann würde er die paar Sekunden der Schreie der Vergangenheit auch ungeschützt ertragen können. Hoffte er.
„ES WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR EINMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL“
Der Oberoschi war nun auf wenige Schritte an die herumliegenden Leiber der Truppe um The Big R herangekommen, als dieser seine rechte Hand vom Ohr nahm und sie nach oben hin ausstreckte. Jetzt oder nie.
„RAFAAEEEEEEEL EIN SCHWANK AUS ALTEN TAAAAAAAAGEN KOMM LEG LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS“
The Big R spürte, wie seine Ohren zu bluten begannen und bangte um sein Gehirn, das von den Lärmsalven physisch spürbar traktiert wurde. Er musste durchhalten, er musste seine Hand oben halten, nur noch wenige Sekunden, nur noch wenige… und dann kam es. Mit einer gewaltigen, ungeahnten Geschwindigkeit schoss der Gegenstand seiner Begierde von irgendwoher durch die eigentlich undurchdringliche Meteoritenfassade des Einkaufszentrums und die begrenzenden Außenwände des Parkdecks, durchlöcherte im Vorbeiflug wie eine diamantenharte Kugel die Mitte des schon zum finalen Stampfer ansetzenden Oberoschis und landete mit einem gewaltigen Knall auf der Quasselquelle, setzte dabei eine kleine Flamme frei und trat von dort schließlich den Flug in The Big Rs Hand an. In dem Moment, indem sich seine Finger um das Fernfeuerzeug schlossen, wusste er, dass sein Plan aufgegangen war.
„HILFE! ICH BRENNE! AAAAAAAAAaaaaaahhh“
Die Quasselquelle hatte Feuer gefangen und schmolz dahin, und mit ihr die Schreie der Vergangenheit. Der Oberoschi dagegen, mit einem britzelnden Loch in der Brust und in seiner Stampfbewegung erstarrt, geriet ins Wanken und kippte vornüber, um dort auf den Steinboden aufzuschlagen, wo einige Augenblicke vorher noch die Mitstreiter von The Big R gelegen hatten, die jedoch bereits einige Meter weiter weg in Sicherheit geflohen waren. Der Knall des metallenen Oberoschis auf dem Funktionsbeton hallte mehrfach an den Wänden wider. Und dann war es erst einmal still auf dem Parkdeck.
Die Stille währte nur bis zu den Geräuschen einer gezielten Salve aus Roys Ultrauzis und einem donnernden Schuss aus Mannis Laserrevolver. Diesmal hatten sie die erstbeste Chance genutzt. Weder Carmen Bushycat noch Nino Nagler hatten Gelegenheit, zu einem finalen Schurkenmonolog anzusetzen. Stattdessen sackten beide – beinahe synchron – tödlich getroffen in sich zusammen.
„Gute Arbeit“, lobte The Big R, während er befriedigt beobachtete, wie sich Blutlachen unter den reglos am Boden liegenden Leichnamen der beiden MGZSMGNSZZSMGOOZ-Agenten bildeten. Ein Anblick, der Mickskwir dagegen zu hemmunglosem Schluchzen veranlasste, welches er dann doch noch irgendwie hemmte, indem er sein Gesicht in Baalberts Kleidung vergrub.
„Das war’s dann wohl“, brummelte Siggy erstaunlich ernst. „Zwei Ex-Agenten mehr, würde ich mal sagen. Schade, dass es so enden musste. Und schade, dass ich meine Karatekette jetzt gar nicht benutzen konnte.“
„Wir werden sehen“, sagte The Big R nur ruhig und lenkte seine Schritte zum Kabuff, aus dem vor einigen Momenten noch die nun tot herumliegende Carmen Bushycat herausgestürmt war. Seine Mitstreiter blickten sich stumm an und folgten ihrem Anführer dann zaghaft. Es lag irgendetwas in der Luft, und das obwohl Baalbert die mitgebrachten Zampanozigarren noch gar nicht verteilt hatte. Und dieses Etwas war auch nicht nur die versengte Quasselquelle oder das angeschmolzene Metall des Oberoschis. Da war mehr. Und The Big R wollte diesem Mehr nun auf die Spur gehen.
Der kleine Sicherheitsbungalow bestand tatsächlich aus nicht mehr als ein paar veralteten Bildschirmen, die Überwachungskameraaufnahmen zeigten, einem Mikrofon sowie einer Mikrowelle, was so gar nicht zu der High-Tech-Welt passen wollte, die The Big R gewohnt war und die er so genoss. Dementsprechend wandte er seinen Blick schnell vom Kontrollpult mit den Bildschirmen ab und entdeckte sogleich im rechten Teil des Raumes auf dem Boden eine offenstehende Luke, die von der Machart und Größe her eher an etwas erinnerte, was man in U-Booten oder großen Kriegsschiffen zu Gesicht bekommen würde. Dazu passten auch die eingelassenen Eisenstreben unterhalb der Lukenöffnung, die eine lange Treppe durch die Röhre ins Dunkel formten. The Big R zögerte nicht und stieg herab. Seine Gefährten blieben oben alleine zurück.
Stufe um Stufe legte The Big R zurück, durchstieg so einige dunkle Flecken auf seinem Weg nach unten, bis er schließlich in karmesinrotes Licht aus vergitterten Wand- und Deckenleuchten getaucht wurde. Nachdem er die letzten paar Stufen genommen hatte, ließ er sich das restliche Stück fallen und landete in einem schlauchförmigen Raum, den er der Breite nach in etwa drei großen Schritten durchmessen konnte. In die Länge dagegen brauchte er gut zwanzig Schritte, bis er an einem gut ausgeleuchteten, eingedellten Relief ankam, welches sich als ein Krater aus Meteoritengestein entpuppte, welcher wiederum wie von einem kleineren Meteoriten verursacht aussah. Der Krater selbst war nicht leer, auch wenn The Big R spürte, dass etwas aus ihm entfernt worden war. Übrig blieb ihm hier nur, den im kleinen Krater befindlichen Zettel herauszufischen und die feinsäuberliche Schrift im roten Dämmerlicht zu entziffern.
0151 105 317 83
Ruf mich an.
The Big R zögerte nicht lange und angelte sich sein Heldenhandy aus der Tasche. Er hatte genügend Empfang für einen Anruf. Seine Finger zitterten, als er die Nummer eintippte. Wie er sich das Telefon dann ans Ohr hielt, ertönte bereits das Freizeichen. The Big R fühlte das Blut durch sein Gesicht pulsieren, während er dem monotonen Signal lauschte. Er hatte eine schwere Vorahnung, wer am anderen Ende der Leitung abnehmen würde. Es knisterte kurz.
„Jacques Peris am Apparat. Schön, dass du dich so schnell gemeldet hast, Rafael.“
The Big Rs Kehle schnürte sich zu, als er die Stimme und den Namen hörte. Er war nicht in der Lage, auch nur einen Mucks zu erwidern.
„Leider muss ich dir mitteilen, dass du zu spät gekommen bist“, erklärte Jacques Peris in einem geradezu gruselig anmutenden Tonfall. „Ihr habt wohl geglaubt, ihr könntet uns aufhalten. Aber das könnt ihr nicht. Die anderen Agenten der Einheit waren nur Marionetten in einem Spiel, dem sie nicht gewachsen waren. Ihr Tod bedeutet nichts. Und für mich müsst ihr euch schon etwas Besseres einfallen lassen, als einen Schuss ins Bein. Das hält mich nicht auf.“
„D… Du…“, brachte The Big R heiser hervor, aber Jacques Peris schien ihn gar nicht gehört zu haben.
„Ihr habt mich vielleicht für immer verkrüppelt, und trotzdem bin ich euch zuvorgekommen. Die im Sicherheitskeller des Einkaufszentrums gelagerten Meteoritensalze habe ich bereits an mich genommen. Damit bin ich im Besitz der wohl mächtigsten Substanz der Welt. Ich kann damit Dinge anstellen, die ihr euch nicht einmal vorstellen könnt.“
„Du übernimmst dich“, zischte The Big R. „Auch du wirst scheitern.“
„Putzig“, erwiderte Jacques Peris schnodderig. „Und du glaubst, das bringt mich jetzt von der Vollendung des Plans ab? Aber gut, ich dachte mir bereits, dass du mich gewaltig unterschätzt. Deshalb habe ich eine kleine Kostprobe meiner neu gewonnen Macht für euch vorbereitet. Der Clou daran: In dem Moment, in dem ihr wisst, was es ist, ist es auch schon wieder vorbei. Clever, was?“
„Was… was hast…“
„Lebe wohl, Rafael. Du hast dafür noch genau eine Sekunde.“
Die Stimme am anderen Ende verstummte, die Leitung brach in sich zusammen. The Big R steckte das Heldenhandy nicht mehr weg. Er konnte es nur noch fallen lassen.
Das Heldenhandy, in der Luft, beschienen in einem Karmesinrot von allen Seiten, wie es langsam und anmutig um die eigene Achse rotierend gen Boden strebte: Das war das Letzte, was Rafael sah.
Geändert von John Irenicus (26.02.2016 um 12:32 Uhr)
-
Sie marschierten an einer der Teeküchen vorbei, aus dem das Gewirr vieler Stimmen drang, und für eine kurze Zeit mischte sich der Duft einer ganzen Kaffeestube unter den Geruch, der in den Fluren hing – den charakteristischen Geruch jeder Behörde, jene ganz eigene Mischung aus PVC, Toner, altem Papier und Amtsschimmel, die Thobart und Marlene nun schon den halben Tag begleitete und die sie trotzdem immer noch als genau so intensiv und geruchsnervenaufreibend wahrnahmen, wie bei ihrem Eintreten ins Rathaus am Morgen.
Als sie an der Teeküche vorbei waren, blieb Thobart kurz stehen, und wandte sich in gebrülltem Flüstern an Marlene.
„Jetzt schickt man uns schon den ganzen Tag durch die Flure, und nirgendwo lernt man richtig zaubern!“
„Aber Schatz … wieso zaubern? Wir wollen doch heiraten!“
Thobart blickte in Marlenes Augen, die irgendwo zwischen Amüsement, Verwirrtheit und Besorgnis pendelten. Erst nach einer Weile fiel ihm auf, was er wohl versehentlich gesagt haben musste.
„Äh ja, richtig, heiraten!“, korrigierte er sich dann und verfiel rasch in ein Schweigen, um weitere Worte Marlenes zu unterdrücken. Es klappte jedoch nicht, denn als sie um die Ecke bogen, fing seine Freundin wieder an.
„Du hast es immer noch nicht verwunden, was?“
„Was?“, zischte Thobart ein wenig zu scharf zurück, weil er keine Lust mehr hatte, seinen Frust zu verhehlen – zumindest, wenn er mit Marlene sprach, vor der er im Gegensatz zu dem knapp zwei Dutzend Verwaltungsbeamten Gelderns, bei denen sie heute schon vorgesprochen hatten, nicht den Bittsteller und Buckler geben musste.
„Die Sache mit deiner Karriere als Magier damals“, antwortete Marlene. Sie klang dabei sehr sanft, ungewöhnlich sanft sogar, und das Gefühl, beruhigt zu werden, machte Thobart nur noch unruhiger. „Du solltest endlich loslassen. Ich habe das auch geschafft, und ich … ja, ich brauchte es wohl noch viel mehr als du. Dachte ich damals zumindest. Aber irgendwann ist mir klar geworden, dass man so etwas doch nicht braucht. Und immerhin haben wir uns an der Zaubereischule kennengelernt. Ich denke, das ist das Beste, was wir aus der ganzen Sache mitnehmen konnten. Oder findest du nicht?“
„Das eine hat mit dem anderen nur wenig zu tun“, befand Thobart, während er den Blättern eines lästigen Gummibaums auf dem Gang auswich. „Wenn ich daran denke, wie sehr wir da verarscht worden sind. Kaninchen aus dem Zylinder ziehen, die man vorher dort hereingepackt hat. Das kann doch jeder! Oder irgendwelche Täubchen fliegen lassen … eine unglaubliche Aufschneiderei. Und dann diese ganzen wirren Anweisungen, ich hätte dem Kerl am liebsten -“
„Du regst dich wieder zu sehr auf“, hauchte Marlene.
Ein bebrillter Beamter mit einem Stoß Papierwerk unter dem Arm kam ihnen entgegen und zog seine Augenbrauen hoch, als er sie passierte. Er war so viel Betriebsamkeit offenbar nicht gewohnt.
„Wann sonst soll ich mich aufregen, wenn nicht jetzt?“, meinte Thobart. „Ich verstehe gar nicht, wie du so ruhig sein kannst. Früher wärst du bei so etwas doch auch sofort in die Luft gegangen.“
„Eben“, meinte Marlene. „Früher. Als ich noch Marl hieß. Und jetzt hilf mir mal bitte, den Raum zu finden, den uns der letzte Sachbearbeiter genannt hat. Zweihundertdreiundzwanzig … zweihundertvierundzwanzig … zweihundert … ah!“
Marlene blieb abrupt vor dem Raum mit der Nummer Zweihundertfünfundzwanzig stehen. Es war kein Büro. Es war die Kantine.
Marlene blickte sich ratlos um. „Er hatte doch zweihundertfünfundzwanzig gesagt, oder?“
„Hatte er“, brummte Thobart zurück.
In der Kantine herrschte reges Treiben. Sie war groß, und an einer Vielzahl von Tischen verteilt saßen so viele Beamte und Beamtinnen sowie Angestellte und Angestelltinnen, dass Thobart arg daran zweifelte, dass in diesem Gebäude überhaupt genügend Arbeitsplätze für sie vorhanden waren – geschweige denn genügend Arbeit. Zusammen machten sie beim Essen einen gackernden Lärm, der Thobart an die Hühner seiner Großeltern damals in Silden erinnerte, und wie sich eine nicht unbeträchtliche Schlange an Menschen vor der Essensausgabe wartend an die lange Theke schmiegte, kam Thobart nicht umhin, sich wiederum an Hühner auf der Stange erinnert zu fühlen.
„Ich habe wenig Hoffnung, ausgerechnet in diesem Gewirr den Verwaltungsdirektor zu finden. Und noch weniger Hoffnung habe ich, dass er uns dann auch hilft.“
Marlene zuckte mit den Schultern. „Mehr, als es versuchen, können wir nicht.“
Sie traten in die Kantine ein, die sie vorher nur vom Flur aus betrachtet hatten. Der Gesprächslärm drang nun ganz ungefiltert an ihre Ohren. Thobart fragte sich, wie hier überhaupt jemand auch nur sein eigenes Wort verstehen konnte. Er selbst konnte sich ja nicht mal mehr denken hören. Aber es half ja alles nichts.
„Wir suchen Verwaltungsdirektor van de Loo“, versuchte Thobart, sich über den Kantinenlärm hinweg Gehör zu verschaffen. Es glückte ihm, denn von einem Tisch unweit der Eingangstür winkte ihn jemand herbei. Thobart und Marlene setzten sich in Bewegung.
„Van de Loo, freut mich“, sagte der Herr, der sich etwas von den Mitsitzern an seinem Tisch – ausnahmslos Männer – abhob, aber optisch wie auch gefühlsmäßig in ihrer Mitte saß.
„Ich hätte nicht gedacht, dass jemand wie ein Verwaltungsdirektor mit … anderen Mitarbeitern einfach so in der Kantine speist“, tat Thobart seine Überraschung kund. Er bekam dafür einen bösen Blick von Marlene. Nicht jedoch vom Verwaltungsdirektor, der ihn weiterhin aufmerksam und unbetrübt ansah.
„Ich will mich eben mit meinen Mitarbeitern vertraut machen. Ich speise jeden Tag an einem anderen Tisch – und zahle am Ende auch die Rechnung. Zwischendrin gebe ich dann manchmal Fragebögen heraus, um meine Mitarbeiter ein bisschen besser kennenzulernen: Name, Herkunft, Sexualität, Kontonummer … man sollte die Männer eben kennen, die man in den Papierkrieg schickt.“
Die Mitarbeiter um ihn herum nickten eifrig. Sie alle hatten, offenbar vor lauter Ehrfurcht vor den Worten ihres Verwaltungsdirektors, ihre Mahlzeit unterbrochen.
„Ein nobler Zug“, sagte Thobart, während er ziemlicher Schwachsinn dachte. Marlene neben ihm schien ähnlich zu denken.
„Wir wollen auch gar nicht lange stören“, übernahm sie nun die Gesprächsführung. „Aber einer der Sachbearbeiter unten hat gemeint, Sie könnten uns weiterhelfen. Sein Name war …“
Marlene brach ab und blickte zu Thobart, aber der konnte ihr auch nicht helfen. Bei all den flüchtigen Bekanntschaften, die er hier gemacht hatte, hatte er über die Namen längst den Überblick verloren, mochten sie auch noch so klangvoll gewesen sein.
„Vielleicht Herr Görink?“, half Verwaltungsdirektor van de Loo aus. „Der könnte es gewesen sein, der kommt nie in die Kantine, der hat immer seine Stullenbox dabei. Wir nennen ihn deshalb auch scherzhaft den Brotmeister, und das ist noch der harmloseste Spitzname, den wir für ihn in petto haben.“
„Hm … also Brotboxen habe ich da eigentlich keine gesehen“, antwortete Marlene grübelnd, wobei ihr das Grübeln bei dem Gesprächslärm um sie herum sichtlich schwer fiel.
„Ich auch nicht“, meinte Thobart, der nichts Besseres zum Gespräch beizutragen wusste.
„Herr Görink teilt sich das Büro noch mit jemand anders, mit Herrn Molkewicks. War es denn ein Doppelbüro?“
„Nein, das nicht“, befand Marlene, und klang dabei viel sicherer, als Thobart sich angesichts dieser Behauptung fühlte. Er wusste jedenfalls nicht mehr, ob im letzten Büro, in dem sie drin waren, nun zwei Leute gesessen hatten oder doch nur einer oder vielleicht sogar drei.
„Außerdem“, wandte einer der Männer am Tisch ein, „sitzt Görink doch gar nicht mehr mit dem Molkewicks in einem Büro. Deren Büro wurde doch aufgelöst, da sitzt doch jetzt dieser Datenschutzbeauftragte drin, der, wie heißt der noch …“
„Quitten-Altmark“, meldete sich ein weiterer Mitarbeiter zu Wort, der sich in Stimme, Persönlichkeit und Aussehen von seinem Vorredner kaum zu unterscheiden schien. „Der war ja vorher noch Demographiebeauftragter in Teilzeit, aber das hat ja jetzt die, äh … von Kropf übernommen. Sogar Vollzeit! Dabei hätten wir im Bauamt viel dringender eine weitere Vollzeitstelle gebraucht.“
„Dass ich nicht lache“, mischte sich nun ein Dritter vom Tisch ein, ein schmächtiger Herr mit Brille. „Wenn hier einer eine weitere Vollzeitstelle braucht, dann doch wohl wir von der Rechnungsprüfung! Seit die Helena Breidings im Mutterschutz ist, bricht da doch alles zusammen!“
„Aber ihr habt die Stelle wenigstens nominell!“, kam von irgendwoher der Einwand – Thobart wusste nun schon längst nicht mehr, wer was gesagt hatte. „Wir haben die Stelle gar nicht!“
„Achja, die Personaler mal wieder!“, schallte es vom anderen Ende des Tisches herüber. „Ihr habt’s gut, euer Abteilungsleiter, der Oberhof-Waldbache, der hat doch so gute Kontakte zu der Leonie Hackepeter von der Compliance-Abteilung, die lässt dem doch alles durchgehen! Ihr könnt euch doch die Stellen selbst schaffen, wie ihr wollt!“
„Wartet nur ab, bis der Kämmerer, der Altglas, aus seinem Sabbatjahr wieder zurückkommt, der macht das eh alles rückgängig!“
„Der? Der war doch schon vor seiner Kur zu nix mehr fähig, dann wird das nachher auch nicht besser sein! Ich nehme mal an, die Stelle wird bald intern neu ausgeschrieben, und die besten Chancen darauf hat dann der Waldemar Busenhof, und der wird …“
„ES REICHT!“
Die Gespräche, nicht nur am Tisch, sondern in der gesamten Kantine, verstummten für einen Augenblick. Wenige Sekunden später wurden sie wieder aufgenommen, aber leiser als zuvor. Verwaltungsdirektor van de Loo sah Marlene, die sich nicht mehr hatte zurückhalten können, gütig an.
„Ich kann verstehen, dass Sie dafür nichts übrig haben. Sie hatten ja ein Anliegen. Was genau … ?“
„Wir wollen heiraten“, sagte Marlene erleichtert und deutete auf Thobart, der zustimmend nickte. „Aber den zuständigen Standesbeamten haben wir bisher nicht ausfindig machen können. Stattdessen hat man uns von Büro zu Büro geschickt … bis wir hier gelandet sind. Bei Ihnen.“
„Hm, für das Standesamt ist eigentlich der … ja, der Armin Dering-Kalbstill zuständig. Ist der denn nicht da?“
„Der ist im Urlaub, und Vertretung macht aushilfsmäßig die Tochter vom Brechmert, aber die hat heute Schulung für …“
„Schon gut, schon gut, so genau wollen wir es wahrscheinlich gar nicht wissen“, unterbrach Verwaltungsdirektor van de Loo seinen hilfsbereiten Mitarbeiter und lächelte Marlene dabei einen Tick zu charmant an, wie Thobart befand.
„Also, wenn gar keiner Zeit hat, dann machen wir das auf dem kurzen Dienstweg, würde ich sagen“, sagte er dann nach einer Weile kurzentschlossen. „Als Verwaltungsdirektor kann ich das selber auch machen. Ich würde vorschlagen, wie treffen uns um … naja, sagen wir, in einer Viertelstunde bei mir im Büro. Das ist im dritten Stock, Raumnummer …“
„Tut mir leid, wenn ich unterbreche“, ertönte plötzlich eine Männerstimme von hinten, deren Urheber sich nun an Thobart und Marlene vorbeidrängelte. „Verwaltungsdirektor van de Loo, ich grüße Sie.“
„Herr van Kampstatten!“, grüßte der Verwaltungsdirektor vergnügt zurück. „Wollen Sie sich auch noch schnell dazumogeln, damit ich Ihnen das Essen zahle?“
„Vielleicht, aber dafür bin ich ursprünglich nicht hier“, sagte van Kampstatten eher ernst. „Thomas Ropenhaar hat vorhin angerufen.“
„Der Landrat? Was will der denn?“, platzte es wenig jovial aus dem Verwaltungsdirektor heraus.
„Der Landrat wünscht, über die Lage an den Bezirksgrenzen und den Verlauf der Umweltverträglichkeitsprüfungen im Rahmen der Neubauten zwecks Erfüllung des Landesentwicklungsplans informiert zu werden.“
Das brachte van de Loo zum Stirnrunzeln. „Das wird er. Ich lasse regelmäßig Berichte versenden.“
„Das stimmt. Doch der Landrat ist unzufrieden mit diesen Berichten. Einfach gesagt, sie bleiben hier im Haus zu lange liegen, bis sie endlich mal verschickt werden. Und wenn sie mal verschickt werden, dann sind sie schon zu alt. Ganz zu schweigen davon, wie alt sie erst sind, bis sie in der Kreisverwaltung durch alle zuständigen Stellen hin zu Ropenhaar selbst gewandert sind. Das geht so nicht.“
„Ja wie, das geht so nicht?“, fragte van de Loo ernsthaft verwundert. „Das machen wir doch schon seit Jahren so! Und bisher hat das immer so funktioniert! Gründlichkeit vor Schnelligkeit, sage ich immer!“
„Und noch was: Sie sind der Kreisstadt seit mehr als zwei Jahren ferngeblieben“, erläuterte van Kampstatten ungerührt. „Das missfällt dem Landrat.“
„Dem Landrat missfiele es sicher noch weit mehr, wenn plötzlich die Trelianer vor Geldern stünden. Die wollen nämlich schon seit Jahren mit uns zusammengelegt werden, um von unseren Gewerbesteuereinnahmen zu profitieren. Aber wenn das passiert, dann sinkt de facto die Kreisumlage. Damit das nicht geschieht, verbringe ich meine Zeit lieber hier in der Kantine als dort im Speisesaal.“
„Belassen wir es dabei, dass Ihre Abwesenheit vom Kreistag bemerkt wurde“, überging van Kampstatten van de Loos Argument. „Und Ihnen sollte bewusst sein, wie bedeutsam dieses Jahr ist. Die Krönung von Ropenhaars Vater zum Schützenkönig jährte sich zum zwanzigsten Mal, ebenso wie die Hochzeit des damaligen Schützenkönigspaares. Zu beiden Anlässen sind Sie nicht erschienen, ebenso wenig wie zur Vermählung der einzigen Tochter unseres guten Landrats mit ihrem Cousin, obwohl Sie jedes Mal eingeladen worden sind.
Verwaltungsdirektor van de Loo wurde sichtlich ungeduldig. „Jedes Mal hielt ich es, bei allem gebührenden Respekt, für wichtiger, auf Vorlage gegen die Anträge aus Trelis vorzugehen, auf dass wir noch den dreißigsten Hochzeitstag des Schützenkönigspaars werden feiern können und nicht vom Land blöde Nachfragen kriegen, was denn mit unserer Kreisumlage los ist. Gewiss hat der Landrat Verständnis dafür.
„Ach, kommen Sie.“ Van Kampstatten machte eine wegwerfende Handbewegung. „Diese Trelianer sind keine Bedrohung. Sie können weder Nemora noch Montera eingemeinden. Was halten sie schon? Ein stillgelegtes Kohlekraftwerk in Nordmar und die großen Ebenen mit niemals fertiggestellten Windparks. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir denen über die Bezirksregierung einen Sparkommissar schicken können.“
Van de Loo gluckste, während er sich mit seiner Serviette den Mund abtupfte. „Wie es der Zufall so will, habe ich die Frage, ob die Trelianer schon im Nothaushalt sind, gerade erst mit meinen Mitarbeitern erörtert.“
„Ja, das war gewiss sehr … erhellend.“
„Nun, ich darf Sie daran erinnern, dass diese Trelianer schon einmal den Großteil der Weldritz und des Suldgaus eingenommen hatten und direkt an der Grenze zu Geldern einen Bebauungsplan für ein Outlet-Center bewilligt hatten.“
„Meinethalben, aber Sie haben den B-Plan mit Verweis auf das interkommunale Abstimmungsgebot gemäß Paragraph zwei Absatz zwei Baugesetzbuch zurückgeschlagen. Und wir werden sie über den Landesentwicklungsplan bald schon ganz aus dem Umland gedrängt haben.“
„Das ist in der Tat mein Ziel. Und um dieses Ziel zu erreichen, werde ich hier bleiben und sämtliche Einladungen in die Kreisstadt höflich ablehnen müssen. Aber Sie können dem Landrat sagen, dass ich zuversichtlich bin, den Trelianern im kommenden Jahr einzuheizen. Ich habe einen Verhinderungsplan für diverse Gebietsumwidmungen ausgearbeitet, den ich im nächsten Frühjahr ausführen möchte. Die Details werde ich dem Landrat noch in diesen Tagen zukommen lassen.“
„Der Landrat zöge es vor, wenn Sie diese Details persönlich mit ihm besprechen würden. Wie ich Ihnen bereits sagte, genügen ihm schriftliche Berichte nicht länger. Er wünscht, ein genaueres Bild von dem zu erhalten, was Sie hier eigentlich machen.“
„Na, das gleiche, was er auch macht“, entgegnete van de Loo nun auf einmal wieder sehr schalkhaft. „In der Kantine sitzen, und wenn nicht hier, dann im Büro vor der Kaffeemaschine.“
Seine Mitarbeiter am Tisch brachen in ein kurzes, aber schallendes Gelächter aus.
Van Kampstatten war sichtlich bemüht, ein Grinsen zu unterdrücken. „Wie Sie meinen“, sagte er. „Sie sind wohl nicht so leicht zu überzeugen, was?“
„In der Sache jedenfalls nicht“, bestätigte der Verwaltungsdirektor mit einem gewinnenden Lächeln.
„Es bleibt jedenfalls dabei“, wiederholte van Kampstatten unbeirrt, „der Landrat bestellt Sie ein. Es mag kein formelles Verfahren sein, das Sie in die Kreisstadt zitiert, aber ein solches sollte auch nicht nötig sein, wenn Herr Ropenhaar ein informelles Gespräch mit Ihnen führen will. Frau Ropenhaar übrigens auch.“
Verwaltungsdirektor van de Loo machte große Augen. „Die Frau des Landrats?“
„Gewiss, Frau Ropenhaar teilt den Wunsch ihres Gatten. Sie ließ mich noch wissen, dass es ihr ausdrücklicher Wunsch sei, ihren Retter, dem sie verdankt, dass sie überhaupt die Baugenehmigung für die Gartenlaube damals in der Scharnhorststraße bekommen hat, mal wieder zu treffen. Auch sie hofft, dass Sie endlich mal wieder in die Kreisstadt kommen.“
„Was, echt?“, brach es auf einmal aus dem Verwaltungsdirektor heraus. „Ja leck mich doch fett! Boah, das ist eh schon lange her dass ich die Alte mal richtig durchgewemmst habe. Die hat es wieder nötig, wa? Ja, trifft sich gut, ich nämlich auch. Alles klar, für mich ist die Entscheidung gefallen, ich fahre sofort los, bin eh fertig mit dem Essen und habe schon seit Dienstagmittag die Arbeit für die ganze Woche fertig. Jawoll ey, so einen Feierabend habe ich mir schon lange mal wieder gewünscht!“
Thobart blickte nervös zu Marlene, aber die machte nur große Augen. So ganz hatten sie beide nicht verstanden, was nun geschehen war, aber in ihrem gemeinsamen Sinne war es sicher nicht.
„Moment mal, was ist denn jetzt mit uns?“, fragte Thobart deshalb.
„Achso, ja, richtig“, sagte Verwaltungsdirektor van de Loo, der schon vom Tisch aufgesprungen war, nun aber wenigstens wieder etwas Haltung annahm. „Nun, Sie haben es ja gehört: Ich muss mich leider auf eine wichtige Dienstreise begeben. Aber ich kann Sie nicht nur vertrösten, sondern hoffentlich auch im tatsächlichen Sinne trösten. Für solche Fälle sieht unser Geschäftsverteilungsplan nämlich vor, dass der Behördenleiter sich der Sache annimmt. Ja, Sie haben richtig gehört: Sie haben heute den richtigen Tag erwischt und das Glück, dass der Behördenleiter höchstselbst Sie trauen wird!“
„Aber ich dachte, Sie wären der Behördenleiter“, bemerkte Marlene verständnislos.
„Aber nicht doch, Gott bewahre. Ich bin der Verwaltungsdirektor.“
„Na dann.“
„Wo müssen wir denn da hin?“, fragte Thobart, bevor ihnen der Verwaltungsdirektor endgültig entschwand.
„Dritter Stock, Raum … dreihundertachtundvierzig, ja. Dreihundertachtundvierzig. Von hier direkt gegenüber ins Treppenhaus, eine Treppe hoch, dann nach rechts den Flur entlang bis ums Eck, und dann können Sie den Raum kaum noch verfehlen. Alles Gute wünsche ich Ihnen!“
„Äh, ja … Ihnen auch“, erwiderte Thobart, als Verwaltungsdirektor van de Loo an Ihnen vorbei aus der Kantine eilte.
Thobart wandte sich zu seiner Verlobten. Er war froh, dass Blicke nicht töten konnten, denn sonst hätte es heute wohl ein wahres Massaker gegeben.
„Nummer dreihundertachtundvierzig. Wir sind da.“
„Scheint so. Willst du klopfen?“
Marlene klopfte. Niemand meldete sich. Marlene öffnete trotzdem die Tür und trat einfach ein. Eher unzufrieden, aber wenig überrascht, dackelte Thobart ihr hinterher. Marlene war allerdings gar nicht sehr weit eingetreten und relativ früher wieder zum Stehen gekommen. Irgendetwas musste sie ziemlich irritieren. Nachdem Thobart sich an ihr vorbeigeschoben hatte, wusste er auch, was. Dieses Büro war anders als die anderen.
Natürlich: Auch hier gab es einen Schreibtisch und hohe Schränke, in denen sich Aktendeckel an Aktendeckel schmiegten; Kopierer und Drucker standen in fast zärtlicher Umarmung bereit und die Blätter eines Gummibaums schmusten, ihre Spitzen sinnlichst ausgefahren, liebevoll mit der Wand. Aber: Zwei dicke rote Vorhänge waren an der Fensterfront angebracht und ließen nur durch einen kleinen Spalt Licht durch. Hinter dem Schreibtisch waren drei rot angestrichene Pfähle in einer Reihe angeordnet. Auf dem mittleren Pfahl kauerte eine kleine Gestalt, nahezu bewegungslos im Schneidersitz, in rotem Gewand gehüllt, und hatte in dieser Pose irgendwie etwas Tierisches. Fast wie dieser Orang-Utan, den wir gestern noch im Zoo gesehen haben, dachte Thobart. Muss dann wohl der Behördenleiter sein.
Dann, völlig unerwartet, schwebte der gerade noch sitzende Mann mit einer Langsamkeit, die Thobart wie der schiere Protest gegen alle Gesetze der Schwerkraft vorkam, von seinem Pfahl und wischte einmal mit der Hand über den Schreibtisch. Mit zwei winzig kleinen Wurfgeschossen in der Hand verpasste er erst Thobart, dann auch Marlene jeweils einen bedeutungslosen Treffer mit ausgedienten Tackerklammern. „Das ist dafür, dass Sie einem Beamten des höheren Dienstes keinen Respekt entgegenbringten!“, bellte er. Thobart war noch völlig perplex, da sprach der Mann auch schon weiter.
„Was wünschen Sie von mir? Ich bin schwer beschäftigt. Wie Sie vielleicht sehen können.“
„Verwaltungsdirektor van de Loo schickt uns“, übernahm Marlene, die sich von all dem offenbar nicht sehr beeindrucken ließ, wieder einmal die Gesprächsführung. „Wir sollten uns beim Behördenleiter melden. Sind Sie …?“
„Ich bin Stadtdirektor Günther Hochschwang-Rumsschocke. Weshalb suchen Sie mich auf? Ich muss das wissen, damit ich zunächst meine Zuständigkeit prüfen kann, bevor ich irgendetwas anderes tue.“
„Wir wollen heiraten“, sagte Thobart, auch, um zu verdeutlichen, dass er nicht nur ein Mitbringsel Marlenes war. „Verwaltungsdirektor van de Loo hat gesagt … ey!“
Zwei weitere Tackerklammern, die Stadtdirektor Günther Hochschwang-Rumsschocke in Windeseile vom Tisch gefischt hatte, trafen Thobart an seinem Rollkragenpullover.
„Nicht alles auf einmal“, mahnte der Stadtdirektor. „Vom Allgemeinen ins Spezielle. Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Sie wollen also einen Antrag stellen.“
Niemand sagte etwas. Thobart nicht, weil er sich nicht so recht traute. Dieser Stadtdirektor schien auch an irgendeinem Punkt in seinem Leben vom Allgemeinen ins Spezielle übergegangen zu sein.
Der Stadtdirektor nickte irgendwann. „Gut. Dann stellen Sie Ihren Antrag.“
„Ich, Marlene, will diesen Mann, Thobart …“
Einen Augenblick später wurde Marlene von drei weiteren Tackerklammern getroffen, diesmal sogar gefährlich nahe am Gesicht.
„Antragstellen. Nicht reden.“
„Wie sollen wir denn einen Antrag stellen, wenn wir nicht einmal reden dürfen?“
Thobart kniff die Augen zusammen, weil er die nächsten Tackerklammern auf sich einprasseln befürchtete, aber nichts dergleichen geschah.
„Wie soll ich aus Ihnen Mann und Frau machen, wenn Sie das schon längst sind?“, fragte der Stadtdirektor dann zurück.
Thobart wusste darauf erst einmal nichts zu sagen, aber zum Glück half Marlene aus.
„Es geht darum, dass wir als Mann und Frau verheiratet sein wollen. Heirat. Ehe. Der ewige Bund fürs Leben. Klingelt’s da?“
„Wenn Sie auf ewig in Treue und Verbundenheit miteinander leben wollen“, begann der Stadtdirektor langsam, „dann kann ich Ihnen nicht helfen. Das müssen Sie selbst tun.“
„Heißt das etwa, Sie weigern sich, uns miteinander zu verheiraten?“, giftete Marlene, die nun ein paar Schritte näher an den Schreibtisch herantrat. „War der ganze Tag heute für die Katz, oder was?“
Günther Hochschwang-Rumsschocke schüttelte langsam den Kopf. „Sie befinden sich in einem Verwaltungsverfahren und sind an einem Verfahrenshindernis angelangt, welches Ihr Antragsbegehren versperrt. Die Stadtverwaltung ist nicht allzuständig, auch wenn sie oft dafür gehalten wird. Sie ist eine Behörde. War es vergebens, nach einer Behörde zu suchen, um das Verwaltungsverfahren in Gang zu setzen? Nein. War es nötig? Nein. Denn Sie hätten an anderer Stelle auch eine Behörde finden können. Sie hätten auch umkehren können. Doch stattdessen fanden Sie diese Behörde. Wenn Sie es beantragen, werde ich Ihnen vorbehaltlich Ihrer Mitwirkungspflicht und gegen die üblichen Gebühren helfen.
„Das wünschen wir nicht“, antwortete Marlene ohne zu zögern. „Wir wollen einfach nur heiraten. Und wenn das in Ihren Kopf nicht reingeht, dann beschweren wir uns ’an anderer Stelle’. Nämlich bei Ihrer Aufsichtsbehörde.“
Thobart sah, wie Günther Hochschwang-Rumsschocke die nächsten Tackerklammern vom Schreibtisch angelte und schon mit seiner Wurfhand ausholte, da spürte er hinter sich plötzlich jemanden ins Büro eintreten.
„Herr Meier? Sie schon wieder? Raus hier!“
Hinter Thobart und Marlene war eine irgendwie seltsam anmutende, aber umso resoluter wirkende Frau aufgetaucht.
„Aber ich habe doch nur …“, protestierte Günther Hochschwang-Rumsschocke, der allerdings schon mit sehr schuldbewusster Miene hinter dem Schreibtisch hervorkam.
„Die Stadtverwaltung ist keine Plattform für Ihr Theater. Sie haben Hausverbot für einen Monat. Am liebsten würde ich Sie für immer verbannen, das muss ich mir noch überlegen.“
Günther Hochschwang-Rumsschocke erhob keine weiteren Einwände und huschte mit wehendem roten Gewand an Thobart, Marlene und der aufgetauchten Frau vorbei aus dem Büro heraus.
„Das ist schon das dritte Mal in diesem Quartal“, sagte die Frau und bahnte sich sodann den Weg hinter den Schreibtisch. „Muss wohl an diesem Raum hier liegen.“ Sie ging zu den roten Vorhängen und zog sie auseinander. Das rote Zwielicht in dem Raum löste sich zugunsten einer gleich viel vertrauenserweckenderen Beleuchtung auf.
„Die hier haben unsere Mitarbeiter im Außendienst vor einiger Zeit von so einer religiösen Sekte beschlagnahmt“, fuhr die Frau unbeirrt fort und räumte die drei Pfähle weg, um sie an einer Ecke des Raumes neben dem Kopierer wieder abzustellen. „Aber damit ich Ihnen das erzähle, sind Sie wahrscheinlich nicht hier.“ Sie atmete einmal tief durch. „Hanna Wogenplatz-Medici mein Name. Was kann ich für Sie tun?“
Thobart schaute Marlene an. Marlene schaute Thobart an. Dann sprach sie.
„Wir sind hier, weil wir heiraten wollen“, sagte sie zum nun sicher zwanzigsten Mal an diesem Tag, war aber diesmal so optimistisch, direkt die vorbereiteten Unterlagen aus ihrer Tasche zu fischen und sie der Frau vorzulegen. „Leider hatten wir dabei bisher nicht so viel Glück, also hier in der Verwaltung, meine ich. Aber wir haben Verwaltungsdirektor van de Loo getroffen, und der meinte, wir sollten zum Behördenleiter. Können Sie uns da weiterhelfen?“
„Ja, sicher“, sagte die Frau, während sie die Unterlagen von Marlene entgegennahm. „Ich bin der Behördenleiter.“ Sie schaute kurz auf, und ihr Blick verriet, dass sie die überraschten Mienen von Thobart und Marlene bereits erwartet hatte. „Oder eben die Behördenleiterin. Aber die Amtssprache kennt nur den Behördenleiter. Mir ist das egal, ich sehe mich sowieso mehr als die Hüterin der Rathausgemeinschaft.“ Sie lachte hell auf.
Nach einer Weile, in der die Behördenleiterin stumm die Unterlagen durchgesehen und einige ergänzende Akten aus den Rollkästen unter dem Schreibtisch zurate gezogen hatte, meldete sie sich wieder zu Wort. „Sie sind Marlene?“, fragte sie dann. Die Angesprochene nickte. „Sie sind gesetzt“, erklärte Hanna Wogenplatz-Medici lakonisch. „Gegen Thobart gibt es Einwände. Ich würde Herrn Kewen akzeptieren.“
„Wie meinen?“, fragte Thobart atemlos, und zupfte sich dabei beiläufig eine übrig gebliebene Tackerklammer aus dem Pullover.
„Sie sind Thobart?“, fragte Hanna Wogenplatz-Medici zurück, wartete aber auf keine Antwort. „Sie lehne ich ab.“ Dann wandte sie sich wieder an Marlene. „Warum steht denn der Herr Kewen nicht mehr zur Auswahl? Es liegt hier doch noch ein Antrag von früher herum. Zwar längst verfristet, aber mit dem ginge es.“ Sie zuckte wie ratlos mit den Schultern, während sie das sagte. So ratlos, wie Thobart sich gerade fühlte – und Marlene ebenso, wie ihr Gesichtsausdruck verriet.
„Wollen Sie mir gerade sagen, dass Marlene heiraten darf, ich aber nicht?“, fragte Thobart dann nach einer Weile.
„Das ist korrekt“, sagte Hanna Wogenplatz-Medici, und zog nochmal eine der Akten hervor. „Ich habe hier einen Sperrvermerk. Thobart kann nicht heiraten, er stand vor zweieinhalb Jahren mal mit einer Kutsche im Halteverbot. So jemanden können wir hier nicht zum Ehemann machen. Marlene kann heiraten.“
„Bitte was?“, echauffierte Thobart sich, und kam dabei sogar Marlene zuvor. „Das ist doch wohl keine Begründung!“
Hanna Wogenplatz-Medici hob die Hand, um Thobart Schweigen zu gebieten. „Korrektur“, sagte sie. „Marlene geht auch nicht. Ist gemeldet mit einer Fake-Adresse. Also kann sie/er kein Ehepartner werden. Sie haben also keine Wahl mehr.“
„Wie bitte?“, war nun Marlene an der Reihe, sich aufzuregen. „Was denn bitte für eine Fake-Adresse? Ich bin noch bei meinen Eltern gemeldet, na und? Was kann ich denn bitte dafür, dass die Adresse ausgerechnet Im Moleratstall 5 heißt? Sie von der Stadtverwaltung hatten doch vor Jahren diese glorreiche Idee, alle Straßen im Ortskern Gelderns nach lustigen Tiernamen zu benennen!“
Hanna Wogenplatz-Medici schaute sie aus kleinen, verengten Augen an. Hätte sie eine Brille aufgehabt, sie hätte sie jetzt zurechtgerückt.
„Naja, es ist grundsätzlich nicht üblich, dass Ehepartner gewählt werden von anderen potentiellen Ehepartnern. Eigentlich ist das Prozedere so: Erstens – der Verwaltungsdirektor der Kommune macht Vorschläge. Zweitens – bei übergeordneten Verwaltungseinheiten wird im Kreistag ein Antrag gestellt, der drei Tage zur Diskussion steht. Dass das hier manchmal anders läuft, haben wir ja auch zunächst toleriert, aber wenn hier Leute zu Ehepartnern vorgeschlagen werden, die bereits ordnungsbehördlich verwarnt wurden, dann geht das eben einfach nicht. Und ich werde das hier ganz sicher nicht diskutieren. Ich bitte also darum, ab jetzt den normalen Weg einzuhalten. Ihr Verwaltungsdirektor ist Herr van de Loo. Er wird die Entscheidungen treffen oder mit seinen Kollegen diskutieren. Für mich ist das Thema erledigt.“
„Für mich aber nicht!“, beschied Thobart, dem so langsam aber sicher der Kragen platzte. „Ich sage es mal so: Demokratie ist natürlich ein bloßes Schlagwort und man müsste sich schon darüber verständigen, was man darunter eigentlich versteht. Ich bin keineswegs der Ansicht, dass jeder Firlefanz im privaten Rahmen oder der Schule oder einem Unternehmen oder sonst wo durch eine Wahl der Beteiligten entschieden werden sollte. Wohl aber bin ich dafür, dass man andere Menschen, auch und gerade, wo es ein Machtgefälle gibt, als gleichwertig betrachten und ihnen auf Augenhöhe begegnen, dass man stets zuerst den Dialog suchen und sich, gerade, wenn man in irgendeiner Form in einer Machtposition ist, um den Frieden bemühen sollte. Ebenso bin ich für Transparenz und für Grundprinzipien eines modernen Rechtsstaats, etwa dass man nicht willkürlich, sondern angemessen straft, dass man zwischen seinem Amt und seiner Privatperson trennt und keine persönlichen Animositäten in seine Entscheidungen einfließen lässt oder dergleichen, dass man sich an die eigenen Regeln hält und dass man konsequent bleibt.“ Thobart atmete tief durch. Vielleicht musste er noch einen draufsetzen, damit diese Staatsdiener es endlich mal kapierten. „Aber gut, klar, so gesehen: Ich weiß echt nicht, warum wir jetzt nicht einfach mal alle akzeptieren, dass die Verwaltungsbeamten einfach unfehlbar sind und über so banalen Dingen wie Dialogbereitschaft, Kritikfähigkeit, Transparenz oder auch schlichtweg einem höflichen Umgangston stehen. Wenn es euch nicht passt, dann geht doch nach Trelis! Das scheint ja zu sein, was gewünscht ist. Denn die Stadtverwaltung hat ja schon in der Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen, dass sie kein Problem damit hat, Dutzende von Bürgern aus der Stadt zu vergraulen und trotzdem noch felsenfest von sich selbst überzeugt zu sein. Hm, wenn ich so nachdenke, kann ich plötzlich wieder ein bisschen nachvollziehen, dass man hier Angst hat, Leute könnten in gewisse andere Kommunen abgeworben werden …“
„Hören Sie“, ergriff Hanna Wogenplatz-Medici nun wieder das Wort. Sie schien kurz davor zu sein, wütend auf den Schreibtisch zu hauen. „Ich habe jetzt entschieden und fertig. Hier ist alles gesagt. Ihre letzten Worte sind für mich auch nur noch gefühlter Widerstand gegen Verwaltungsbeamte, die tragen nichts zu einer Ehepartnerfindung bei. Relevante Anträge wurden keine mehr gestellt. Ich sehe die Diskussion daher für mich als abgeschlossen an. Schönen Tag noch.“
Thobart wollte etwas sagen, aber Marlene bedeutete mit einem Griff an seinen Arm, dass er es damit gut sein lassen sollte. Dann ging Marlene näher zum Schreibtisch heran, beugte sich vor – und verpasste Behördenleiterin Hanna Wogenplatz-Medici eine schallende Ohrfeige.
„Ihnen auch einen schönen Tag noch“, sagte sie dann noch zur verdattert dreinblickenden Behördenleiterin, packte Thobart am Arm und zog ihn mit sich aus dem Büro heraus.
Ab diesem Tage war ihnen klar, dass es ihre Beziehung nicht wert war, durch so etwas wie eine Ehe bemakelt zu werden.
-
I. Jessy. Ein Glückskind ist geboren.
Jessy war vom diesjährigen Blockflötenkonzert noch ganz erschlagen, als sie nach Hause zurückkehrte, und das konnte man durchaus wörtlich nehmen, denn nachdem der letzte Ton der Vorstellung verklungen war und das bis dahin furios musizierende Quartett kollektiv die Hände in die Luft gerissen hatte, hatte sich ausgerechnet die größte der vier Flöten aus den Händen des entsprechenden Flötisten gelöst und war mit nicht zu unterschätzender Wucht ins Publikum geflogen. In der nächsten Sekunde hatte sich schlicht das bewahrheitet, was Charonia, einzige Hebamme (und Kräuterhexe) damals in dem kaum bekannten Dorf nahe Silden, bei Jessys Geburt mit fröhlichem Gestus, der so echt gewesen war wie ihr tremor alcoholicus, prophezeit hatte: Ein Glückskind ist geboren, dem über viele Lebensjahre hinweg die unfassbarsten Zufälle geschehen werden. Und so kam es, dass Jessy erst, als sie die lieblichen Daunen ihres vertrauten Himmelbetts unter sich fühlte, wieder wach wurde – mit einer Flöte in der Hand und einer Beule auf dem Kopf.
„Mein Gott, Jessy“, erklang die Stimme ihrer Schwester aus dem Dunkel. Jessy machte die Augen auf und blickte in ein besorgtes Gesicht, das sich wie eine Maske
eine Totenmaske
über denjenigen Ausdruck der Belustigung gelegt hatte, den Jessy normalerweise erwartet hätte.
„Mein Gott, Cassy“, spielte Jessy den Ball in der Verwirrung ihres Erwachens
Auferstehung
recht plump zurück. „Ist wirklich das passiert, was ich gerade denke?“
„Ich weiß ja nicht, was du gerade denkst“, gab Cassy wiederum zurück. Jessy nahm wahr, wie sich die Gesichtszüge ihrer Schwester wieder entspannten.
„Ich denke, dass das das langweiligste Blockflötenkonzert war, dass ich je erlebt habe.“
„Dann ist wirklich das passiert, was du gerade denkst.“
Jessy lächelte und setzte sich auf. Ihre Glieder waren etwas steif,
Leichenstarre
aber nach einigem Recken und Strecken
Streckbank
war sie schon wieder ganz voller Tatendrang. Unter dem nun eher teilnahmslos gewordenen Blick ihrer Schwester schwang sie sich zur rechten
linken
Seite ihres großzügigen Bettes hinaus, fischte erst nach ihrem linken
rechten
Hausschuh, dann nach ihrem rechten
linken
Hausschuh und stand
starb
- „Sag mal Cassy, kannst du den Unsinn jetzt mal sein lassen?“, fuhr Jessy ihre Schwester etwas harscher an, als sie eigentlich vorgehabt hatte. „Ich weiß ja, dass du an deiner Bauchrednerkarriere arbeiten musst, aber könntest du das vielleicht mit jemand anderem machen? Ich versuche gerade, wach zu werden, da irritiert sowas ungemein.“
Cassy zuckte schuldbewusst, aber ohne großes Unrechtsbewusstsein die Schultern. „Sei doch wenigstens froh, dass es eine Bauchrednerkarriere ist und keine Blockflötenkarriere. Sonst hättest du jetzt vielleicht noch eine Beule mehr.“
„Jaja“, murrte Jessy, wusste nicht, ob sie nun der Tenorblockflöte in ihrer rechten Hand oder der Beule auf ihrem Kopf Beachtung schenken sollte, und verwendete deshalb erstere um letztere zu kratzen. Es tat weh, aber nicht zu sehr. Cassy schien das auch so zu sehen.
„Wenn du fit bist, dann können wir ja doch noch in einer Stunde zu Onkel Ewald“, sagte sie. „Hattest du denn jetzt eigentlich ein Geschenk besorgt?“
Jessy war gerade richtig aufgestanden, da ließ sie sich auch schon wieder auf das Bett zurück plumpsen.
„Das Geschenk!“, rief sie aus, und verzichtete angesichts ihres lädierten Schädels darauf, sich mit der flachen Hand auf die Stirn zu klatschen. „So ein Mist, Cassy … du hattest es mir gesagt, aber es war so viel los die letzten Tage, da …“
Cassy winkte ab. „Schon gut, gibt Schlimmeres. Wer weiß, vielleicht ist er dann deshalb so beleidigt, dass er uns diesmal früher gehen lässt.“
Jessy stand nun wieder, die Hände in die Hüfte gestemmt. „Er ist unser einziger noch lebender Verwandter“, sagte sie. „Wir sollten also nett zu ihm sein.“
„Seit es keinen Goldzahn mehr gibt, den er uns vermachen könnte, sehe ich da ehrlich gesagt nur noch wenig Grund zu“, gab Cassy tonlos zurück. „Mal ganz abgesehen davon, dass du damals als kleines Mädchen fast blind geworden bist, als er dich gezwungen hat, mit ihm in die Sonnenfinsternis zu gucken.“
„Da fand ich die Sache mit ihm, dir und der Mondfinsternis damals im Winter oben auf dem Leuchtturm aber noch schlimmer“, erwog Jessy.
Cassy zuckte abermals mit den Schultern. „Mag sein, das macht es dann aber insgesamt nur umso schlimmer.“
„Bin ich froh, dass er noch nichts von der kommenden Supernova gehört hat, die die Astronomen in Geldern vorhergesagt -“
- „Wenn du ihm das nachher erzählst, bist du dran“, fauchte Cassy dazwischen. „Ich hab von Onkel Ewald und seinen scheiß Himmelsphänomenen echt genug. Soll er sich doch seine Fensterscheiben oben auf der Hütte schwarz anmalen und den ganzen Tag rausgucken, da hat er Finsternis und dämmeriges Licht genug.“
„Schon gut, schon gut“, bemühte sich Jessy, ihre Schwester zu beruhigen. Cassy hatte wieder diesen Blick bekommen, den Jessy den Harpyienblick nannte. Dabei hatte sie noch nie eine lebende Harpyie gesehen. Aber eine tote, ausgestopfte, in Orlans Taverne. Die tote Harpyie war Orlans wertvollster Besitz, hatte er ihr einmal erzählt, nachdem er sich mit seinem eigenen abgestandenen Bier betrunken hatte; genug Mut zusammengesammelt, um sich ihr auf nicht ganz so ziemliche Weise zu nähern und sie mit allerlei Geschichten über sich und andere zu beeindrucken. Und Orlan hatte in dieser Nacht, die Jessy eigentlich nur in der Taverne verbracht hatte, um Onkel Ewald dort abzuholen, so Einiges erzählt. Von seiner Taverne, dem Präparator der Harpyie, dessen Frau er es während der Zeit ihrer gemeinsamen Geschäftskontakte „jeden Sonntagmorgen von vorne bis hinten besorgt“ hatte, von seiner eigenen Frau, die es einfach nicht mehr brachte, so frigide, wie sie war, von seinem riesengroßen Glied, welches nunmal eben seinen regelmäßigen Auslauf brauchte, dabei aber eine gewisse jugendliche Enge als besonders geeignet emfpand – und so weiter und so fort. Jessy hatte sich das alles duldsam angehört und auf einige Nachfragen Orlans, wie sie denn so zu dem Ganzen stand, am liebsten erwidert, dass Orlan ein widerlicher Dreckskerl sei und er sie mit seinen Alte-Männer-Gelüsten in Ruhe lassen sollte. Aber das war Jessy nun nicht ganz damenhaft vorgekommen, weshalb sie weiter geschwiegen und in unregelmäßigen Abständen genickt hatte. Sie hatte sich nicht in der Position gesehen, einen Mann – noch dazu einen älteren – zu kritisieren. Schon gar nicht deshalb, weil er ungepflegt, schwitzig und ganz allgemein einfach nur ekelig war. Männer waren eben so – Onkel Ewald ja auch. Das hatte die Gesellschaft nun einmal so vorgesehen, und Jessy hatte damals wie heute nicht den Wunsch verspürt, nur, um einmal kräftig auf den Tisch zu hauen, direkt ihre Damenhaftigkeit aufs Spiel zu setzen.
„Knöpf den obersten Knopf besser auch zu“, riet Cassy, die sich neben Jessy vor dem Kleiderschrank aufgebaut hatte. Jessy, die langsam aus der Erinnerung in das Hier und Jetzt ihrer Tätigkeit zurückkehrte, tat, wie ihr geheißen.
„Er kann zwar nicht mehr allzu gut sehen, weil er zu oft in die Sonne gelinst hat, aber naja … es gibt sowas wie partielle Sehfähigkeit, wenn du verstehst, was ich meine.“
„Weiß ich“, gab Jessy zu Protokoll, während sie vor dem angelaufenen Spiegel noch einmal den korrekten Sitz ihrer Kleidung prüfte. „Damals in Silden, als ich noch in Ellys Kneipe ausgeholfen habe, gab es da auch so einen Kerl. Blind wie ein Grottenolm, angeblich eine alte Kriegsverletzung, die Augen versengt durch Schwarzmagie. Die mussten den zu seinem Platz führen. Aber das Bier auf seinem Tisch, das hat er immer gefunden.“
„Dann bist du ja gewarnt“, sagte Cassy etwas abwesend, während sie ihr eigenes Kleid noch etwas zurechtzupfte. „Hoffentlich gibt es heute nicht wieder diesen ekelhaften Tee …“
II. Zwischenspiel. Hinab in die zumindest wünschenswerterweise ewig währende Sphäre unseres ruhmreichen Herrngotts und ehrenvollen Beschützers und alten Freund und Kupferstechers Adanos.
Es war nur eines von vielen Geräuschen, das sich ins angespannte Gemurre des Waldes einfügte. Unterhalb der mächtigen Baumkronen lagen noch immer die nächtlichen Zecher im Gras. Rauschmenschen strichen durch die Morgendämmerung, um den Weg wiederzufinden, den sie unvorsichtig und mit mindestens drei Litern Wacholder pro und im Kopf verlassen hatten.
Der Kater war nicht mehr fern und im Osten verblassten die ersten Mienen, denn von dort kam die Sonne und ließ Blitze in die brummenden Köpfe schießen. In die Geräusche des Erwachens mischte sich das Plätschern der ersten erleichterten Blasen. Mit Dreck unter den Fingernägeln berührten ausgezehrte Männer ihren nicht mehr ganz so rosigen Kopf. Das Morgengrau verdunkelte zu schwarzen Punkten vor den Augen. Ein alter Kerl erbrach, und das tiefe Matschbraun des Waldbodens verwandelte sich in Beige. Die milde Gicht des Alten ließ das Gebaren wie einen Ausdruckstanz erscheinen. Der Wind trug unzählige Düfte mit sich, Dunkles Paladiner, halb verdaute Salami, Klabusterbeeren.
Es roch nach Schweiß und ein rauchiger Sumpfkrautnebel lag in den Tälern der neu geborenen Insel. Eine gelbe Jauche floss über ein großes grünes Blatt und warf ein paar Schaumkronen auf. Ein Geschöpf mit zähen, häutigen Tränensäcken fiel aus den Baumkronen hinab, packte im Sturze direkt in den gegilbten Matsch und schoss über dem Wasser dahin, das sich in einem schmalen Bett schäumend und strudelnd durch die Wildnis dieser neuen Welt wälzte. Der Strom donnerte und brauste unter ihm dahin, als ein riesiger, rot-weiß-grau gepunkteter Mann zunächst in unglaublich hohem Bogen zu den Schnellen beitrug, dann aber vergebens nach dem eigenen Halt auf dem rutschigen Waldboden schnappte und sich sodann selbst in das glitzernde Wasser riss.
Ein paar der Aufgewachten bekamen dies mit und lachten heiser, erst nur ein oder zwei Dutzend, dann immer mehr, schließlich so viele, dass dichtes Männergejohle die Lichtung erfüllte. Ein zartgliedriger Jüngling mit braunem kurzem Haar erbrach sich im Dickicht und floh nach Südosten.
Etwas würde geschehen.
Wieder raschelte es im Gebüsch, und weitere Männer kamen zum Vorschein. Schluckspechte marschierten fluchend gen Süden. Dann trat Stille ein wie vor einem bösartigen Gewittersturm, wenn sich der Magen erst völlig legt und die Gesichter der Trinker eine unheimliche, widernatürliche Farbe annehmen.
Die Sonne hing am Himmel wie Brot in einem halb geschmolzene Käsefondue, ein bröckelnder Kloß, umgeben von märchenhaft klebrigen Schmelzbahnen.
Etwas verdrängte die Stille.
Der Himmel wurde dunkler und nahm einen seltsamen Gelbton an, und vom westlichen Horizont näherte sich rasch ein dunkles Gebilde, das ständig größer wurde. Manche nannten es Wolken.
Es war eine stetige, leichte Vibration, die eher zu fühlen als zu hören war und allmählich stärker wurde. Sie hatte keinen Klang. Es war nur ein seelenloses, tonloses Geräusch. Manche nannten es Kopfweh.
Auf den zartgrünen Blättern der üppigen Pflanzen erschienen dunkle kleine Punkte, dann wurde es noch düsterer und merklich kühler, Blüten schlossen sich, die Sonne verdunkelte sich und die kahlen Häupter der älteren Mitglieder der Khoriner Schützengesellschaft leuchteten zwischen den Wolkenbergen und -tälern hindurch wie alte Kohlrabi auf einem klapperigen Pferdewagen.
Die Vibration wurde stärker und stärker und bekam eine Stimme – ein tiefes, rollendes Dröhnen, das zu einem zerschmetternden Crescendo anschwoll. Manche nannten es Blähungen.
Etwas schoss mit unglaublicher Geschwindigkeit vom Himmel herab, der jungen Erde entgegen, etwas Glänzendes, Farbloses. Es kam Wind auf, ein kalter, schneidender Wind. Als die farblosen Geschosse ihren Weg nach unten antraten, wechselten sie mehrmals ihre Gestalt, waren mal Blasen und mal Bindfäden und waren alles in allem doch ohne Form. Sie stürzten sich herab auf die Welt und befleckten sie, jeder Aufprall eine kleine Explosion, unablässig, wieder und wieder, Millionen von kaum sichtbaren Nadelstichen, Tropfen voller Wasser in Reih und Glied. Manche nannten es Regen.
Es folgte eine alles zermalmende Erschütterung, ein sengendes Klirren, und eine gewaltige Duftwolke stieg aus dem viereckigen Krater hervor, der sich schmatzend in den Matsch gegraben gegraben hatte. Der Wind trieb den Geruch des müffelnden Hopfens vor sich her.
„Ach – du – Scheiße.“
Es war nicht mehr Abend, und es war Morgen: Der Tag danach.
„Jungs, ich hab den Kasten fallen gelassen! Wird wohl nix mit Konterbier!“
III. Jessy. Echte und unechte Dämonen.
Jessy hielt die Flöte fest in der Hand, während Cassy an die Tür klopfte. Es war ein Geräusch, wie wenn einer gar nicht eintreten will. Einen Augenblick später war die Tür auf. Onkel Ewald kam zum Vorschein – und mit ihm ein beißender Geruch nach Tee aus Kräutern. Ein Geruch, wie wenn einer nicht mehr leben will. Oder schon gar nicht mehr lebte.
„Hallo, meine Damen“, sagte Ewald und strahlte über das ganze Gesicht – unterbrochen freilich von der Zahnlücke, die sein Gebiss verfinsterte. Früher hatte dort ein Goldzahn geglänzt. Mit der Zeit war er immer matter geworden, bis er schließlich irgendwann ganz verschwunden war. Onkel Ewald hatte auf Nachfrage behauptet, es sei einfach über Nacht geschehen, vielleicht habe einer der Ratten rund um seine Hütte den Zahn nachts sanft herausgebrochen und dann versteckt. Anderslautenden Gerüchten zufolge aber war Ewald in der Zeit rund um seinen Zahnverlust bei Mondschein volltrunken im Wald gesichtet worden, im Gespräch mit einer anderen Person, die in Wahrheit aber gar nicht da gewesen war. Dabei, so sagte man, musste er sich wohl auch den Zahn ausgeschlagen haben.
„Kommt doch rein, der Tee ist gleich fertig“, sagte Ewald und kehrte seinen beiden Nichten sodann auch schon wieder den Rücken zu, um zurück in seine Holzhütte zu eilen. Es war eine schöne Wohnlage. Nah am Wald, aber nicht so nah, dass man befürchten musste, regelmäßig´Opfer von Wildschweinangriffen zu werden. Jessy erinnerte sich allerdings daran, wie sie und Onkel Ewald einmal von einer Bache aufgescheucht worden waren, als sie …
„Der Tee riecht so, als wäre er schon mehr als nur fertig“, flüsterte Cassy und weckte Jessy damit aus ihrem Gedankenstrom. Die Schwestern nickten sich gegenseitig schicksalsbetroffen zu und traten in das kleine Häuslein ein.
„Setzt euch, setzt euch“, rief Onkel Ewald aus der kleinen Küchenkammer hinaus in den Hauptraum des Hauses, der Wohn- und Essraum zugleich war. An einem nicht allzu großen, aber für drei Personen mehr als ausreichenden Tisch waren drei grob gehäkelte Platzdeckchen drapiert, auf ihnen jeweils eine Teetasse samt Untertasse mit bereitgelegtem Löffel plus ein kleiner Porzellanteller, in ihrer Mitte ein zerbeultes Tablett, auf dem peinlich genau portionierte Tortenstücke bereitlagen.
Cassy ließ sich auf einem leise ächzenden Holzstuhl nieder, ohne dem Gedeck große Aufmerksamkeit zu schenken. Sie verschränkte ihre Arme zwar nicht, sah aber ansonsten genau so aus, als täte sie es.
Jessy blieb noch ein wenig stehen. „Woher kommt denn der Kuchen, Onkel Ewald?“, rief sie in die Küche hinein, in welcher der untersetzte ältere Herr den Geräuschen nach zu urteilen gerade offenbar noch eifrig herumwerkelte. Cassy ließ ein verächtliches Brummen auf die Frage ertönen, welches Jessy aber gar nicht richtig wahrnahm.
„Den habe ich gebacken“, kam ein etwas atemloser Ruf aus der Küche. „Da staunt ihr, was? Da fängt der liebe Onkel Ewald auf seine alten Tage noch an zu backen!“
„Wie kommt’s?“, rief Jessy ehrlich interessiert zurück.
„Ach, wisst ihr“, schallte es erneut aus der Küche, „wenn man das Leben so Revue passieren lässt, das Leben verliert
da erinnert man sich ja doch eher an die schönen Momente als an die schlechten. An was ich heute nicht schon alles gedacht habe! Heute Morgen im Bett
Totenbett
musste ich an eine alte Bekannte denken, Mutter Kindleria, eine Ordensfrau, die es aber faustdick hinter den Ohren hatte! Davon abgesehen machte sie immer diesen wunderschönen Kuchen, mit diesem ganzen wunderbaren Rohrzucker
Rohrstock
und dem Zuckerguss
Bluterguss
… so viel, dass mir damals fast noch sämtliche andere Zähne ausgefallen wären, hätte ich sie nicht verlassen,
getötet
bevor es zu ernst wurde! Der Geschmack des Kuchens lag mir jedenfalls den ganzen Tag
Tag des Jüngsten Gerichts
auf der Zunge, und da habe ich mich einfach mal daran versucht. Ich hoffe, er schmeckt euch, greift ruhig schon einmal zu! Ich bin gleich
tot
bei euch!“
Jessy warf ihrer Schwester einen vorwurfsvollen Blick zu, aber die zuckte nur unnachgiebig mit den Schultern.
„Hör halt auf, ihn so eine Scheiße zu fragen, dann höre ich auch auf“, zischte sie leise.
„Nanana, wer flüstert, der lügt“, sagte Onkel Ewald, der gerade aus dem Küchenraum zurückgekehrt war, ein angelaufenes Silbertablett in der Hand, auf ihr eine noch angelaufenere Teekanne, die aber bestimmt nicht aus Silber war. Ewald grinste, präsentierte erneut seine Zahnlücke. Ein schwarzes Loch inmitten sonst gelblich-weißen Mauerwerks aus Schmelz. Jessy wusste nicht, woher sie den Gedanken nun wieder hatte, und er überraschte sie auch in seiner Dramatik, aber: Wenn irgendwo die Dämonen wohnten, dann in diesem Loch.
Oder im Kräutertee, den Ewald nun in aller Seelenruhe einschenkte, sich selbst zuletzt. Die Kanne stellte er sodann wieder aufs Tablett, welches er bereits auf dem Tisch abgelegt hatte. Dann setzte er sich, auf die andere Seite, gegenüber seiner beiden Nichten.
„Ich freue mich, dass ihr gekommen seid“, sagte er dann etwas zu förmlich, wie, als würde er sie gerade erst in Empfang nehmen.
„Danke für die Einladung“, sagte Cassy pflichtschuldig, und das Spiel ihrer Finger um die Tasse mit dem dampfenden Inhalt verriet ihrer Schwester, dass das Dankeschön nicht nur unehrlich war, sondern vor allem keinesfalls ein Dankeschön auch für den Tee einschloss, nicht einmal ein geheucheltes.
„Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag“, fügte Jessy, etwas zu spät, hinzu. Onkel Ewald nahm es mit einem gutmütigen Lächeln entgegen. Es wirkte alles etwas steif. Das war bei Onkel Ewald aber auch nichts Ungewöhnliches.
„Vielen Dank“, antwortete Ewald nach einigem freundlichen Nicken dann noch einmal mechanisch. Sie alle waren so still, dass man das Dampfen des Tees schon hören konnte.
„Wir haben dir diesmal auch ein ganz besonderes Geschenk mitgebracht“, fuhr Jessy fort und griff sich an den Bund ihres Rocks, in dem sie ihr Mitbringsel zwischenzeitlich verstaut hatte. Ewalds Augen blitzten auf, wie zwei Sonnenfunken in der totalen Finsternis.
„Was ist es denn?“, fragte Ewald zwischendrin nach, sodass Jessy schon glaubte, Ungeduld in ihm zu spüren. Aber sicher war sie sich nicht.
Endlich hatte sie die Flöte hervorgekramt und hielt sie nun, das Mundstück voran, ihrem Onkel entgegen.
„Oh, eine … eine Blockflöte“, tat Ewald das Offensichtliche kund, während er das Geschenk eher zögerlich entgegennahm. Jegliche Anzeichen von Ungeduld, wenn es denn welche gegeben hatte, waren nun auf einmal wieder erloschen, wie Jessy bemerkte. Sie war nicht sonderlich verwundert – mit einer Flöte konnte sie auch nicht viel anfangen, deshalb verschenkte sie sie ja.
Onkel Ewald drehte das Instrument ein wenig in den Händen hin und her. „Sie ist hübsch“, stellte er irgendwann fest.
„Sie wurde sogar schonmal von einem echten Flötisten gespielt“, fügte Cassy in gespieltem Überschwang hinzu, sodass es Jessy geradezu leid tat, wie ihr Onkel von diesem Theater in die Irre geführt wurde.
„Ach, ist das so?“, fragte Ewald zurück, ohne auf die ohnehin vorgezeichnete Antwort zu warten. „Ich würde sie gerne mal hören, ja …“ Er hielt kurz inne, streckte das beige Holzrohr dann zurück zu Jessy aus. „Jessy“, hauchte er, „Würdest du auf meiner Flöte spielen?“
So schwer, wie Onkel Ewalds Atem auf einmal war, wunderte es Jessy zwar nicht, dass er gerade nicht selbst spielen konnte. Dass sie selbst dieses Ding in den Mund nahm, kam aber auch nicht in Frage.
„Vielleicht nach dem Essen“, sagte Jessy so aufrichtig, wie sie es nur spielen konnte. Ihre Schwester zollte ihr daraufhin mit einem kurzen Seitenblick Anerkennung.
„Ja, das wäre vielleicht … vielleicht …“
Ewald brach ab, die Flöte krampfhaft umklammert. Seine Hand zitterte und seine Augen weiteten sich, das knochige Gesicht war plötzlich seltsam dunkel und verzerrt, wie einmal gespiegelt. Als er wieder zu sprechen begann, hatte sich seine Stimme seinem Äußeren angepasst: Auch sie war nun dunkler, verzerrt, ein wenig fremd. Und unter seinem Hemd, vollständig asynchron zu seinen gesprochenen Worten, erhob sich auf Höhe der Brust ein Etwas, unförmig, nicht allzu groß, aber … beweglich. Lebendig.
„Ich hatte ja ganz vergessen … ich sehe die Messe schon vor mir … gelbes Gas wird herabwehen auf uns Menschen, und wir werden allein und schutzlos sein … aber vielleicht will ich das ja, ich … nein, ihr müsst mir nicht applaudieren … geht weg … das Feuer wird auf die Erde fallen und unsere Leiber verpesten … der Marktplatz und die Häuser fortan bevölkert von wandelnden Toten … jedes Atmen wird nur noch ein Gluckern sein … denn er kommt … der … der Fluch.“
Ewald hatte kaum geendet, da durchfuhr ihn auf einmal ein schreckliches Zucken, die Flöte fiel mit dem Mundstück in die eierschalenfarbene Teetasse und entlockte ihr ein paar Spritzer, Ewalds Augen wurden ganz starr und sein Körper schließlich ganz schlaff. Aus seiner Brust ragte nun die Spitze einer gezackten Klinge hervor, deren ursprüngliche Silbrigkeit von dunklem Blut und herausgerissenen Fleischfetzen verdeckt wurde, eingerahmt von einer gallertartigen Masse, die vielleicht zum Teil freigesetzter Mageninhalt Onkel Ewalds war, vielleicht auch irgendetwas anderes. Jedenfalls war klar: Irgendetwas stimmte hier nicht.
„Seid ihr unverletzt?“, fragte der Mann hinter Onkel Ewald, während er mit einem schmatzenden Geräusch die Klinge aus dem toten Leib herauszog. Jessy bemerkte erst spät, dass es der Mann selbst war, der das schmatzende Geräusch ganz aktiv verursachte, indem er auf irgendetwas herumkaute. Dem Geruch nach mochte es Kautabak sein, und auch von seinem sonstigen Aufzug her passte das gut: Mit seinem breitkrempigen Filzhut, den dicken Stiefeln und dem Halstuch sah der Mann aus wie ein einsamer Reiter aus dem fernen Westen – was immer im fernen Westen auch sein mochte. Und über seiner Schulter trug er einen Bogen, bereit zur Jagd.
„Wir schon, Onkel Ewald nicht“, stellte Cassy nüchtern fest, den Blick fest auf die klaffende Wunde in Ewalds Oberkörper gerichtet. „Was sollte das?“, fragte sie dann, wieder aufblickend.
„Hier stimmt etwas entschieden nicht“, stellte der Mann das fest, was Jessy wenige Augenblicke zuvor auch noch gedacht hatte – und da hatten sogar noch deutlich mehr Dinge gestimmt als jetzt.
„Das glaube ich auch“, gab Cassy zurück. „Warum tötest du unseren Onkel? Und vor allem: Warum jetzt? Hättest du das vor zwanzig Jahren schon getan, uns wäre Einiges, nicht nur Geburtstage, erspart geblieben.“
„Da diente ich noch im Orkkrieg“, erklärte der Mann ungerührt. „Wie alle echten Männer.“
„Das beantwortet noch immer nicht die eigentliche Frage.“
„Euer Onkel war längst nicht mehr euer Onkel. Das muss euch nicht entgangen sein. Der Dämon in ihm stand kurz vor einem Ausbruch.“
„Naja“, sagte Jessy, sich aus Verlegenheit ratlos am Kopf kratzend. „Onkel Ewald hat halt mal wieder dummes Zeug erzählt und hatte sein Wenn-der-Rum-den-ich-vorher-noch-genascht-habe-erst-so-richtig-anschlägt-ist-in-meinem-Hirn-Finsternis-Gesicht, aber sonst war doch nichts. Das ist doch gerade typisch für ihn.“
„Aber seine Brust!“, rief der Mann aus.
„Ja, da ist jetzt ein Loch drin“, stellte Cassy fest. „Aber das war ja erst, nachdem du kamst.“
„Aber sie bewegt sich noch immer! Ein Dämon muss ihn sich als Wirt ausgesucht und ihn dann besessen haben!“
„Wer nichts wird, wird Wirt“, murmelte Jessy. Wenig später bahnte sich eine kleine Ratte den Weg durch die Lücken, die das zugeknöpfte Hemd Ewalds ließ, schüttelte sich kurz und hüpfte auf den Tisch, um sich den Kuchenkrümeln zu widmen.
„Weiche!“, rief der Fremde und hielt das blutüberzogene Schwert vor sich. „Willst du der Zweite sein?!“
„Aber das ist doch nur Fergie, Onkel Ewalds Haustier“, sagte Jessy, streckte die Hand aus und ergriff die Ratte, die sich ihrem Schicksal bereitwillig fügte, nicht ohne sich vorher noch ein größeres Bröckchen vom Kuchen zu krallen.
„Meinen Informationen nach ist dies keine gewöhnliche Ratte, sondern ein Erzdämon“, setzte der Mann seine eigene Erklärung durch, wie es eben nur ein Mann tun würde. „Sein Name ist Krushak.“
Cassy, die bis eben noch gebannt den mit halboffenem Mund auf seinem Stuhl hängenden Ewald begutachtet hatte, prustete nun beinahe in die Wunde ihres Onkels hinein. „Krushak?“, jauchzte sie. „Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Du glaubst wahrscheinlich auch noch an die Geschichte vom toten Admiral im Reisschnaps, was?“
„Wie, was? Wieso? Krushak gibt es wirklich, ehrlich, und ’Toter in Reisschnaps’ war in meiner Jugend mein Lieblingsgetränk!“
„Ach komm“, winkte Cassy ab, Ewalds Hausratte im Arm. „Jeder weiß doch, dass Krushak bloß eine Erfindung von ein paar Jugendlichen ist, die nach einer wilden Strand-Orgie inmitten eines gewaltigen Nachhalls an Eifersucht irgendwie aus Versehen einen Mann verbrannt haben und für all das dann eine Erklärung brauchten. Erzdämon, dass ich nicht lache. Scherzdämon wohl eher.“
Jessy musste ein Lachen unterdrücken. Es konnte schon witzig sein, wenn ihre Schwester zu den richtigen Leuten fies war. Dennoch tat ihr der Mann ein wenig leid. Gut, er hatte zwar ihren Onkel getötet, aber das hatte er ja auf eine durchaus spektakuläre und morbid-ästhetische Art getan und außerdem noch zur rechten Zeit. Aber Cassy hatte durchaus schon ganz recht: Der Kerl hätte ruhig mal viel eher in ihr Leben treten dürfen.
„Wisst ihr was? Vergesst die Sache mit Krushak einfach. Ihr versteht es ja eh nicht. Aber jammert ja nicht rum, wenn er euch dann doch mal in der Brust sitzt.“
Der Mann rückte seinen Bogen zurecht und rieb sich dann mit der Hand die linke Wange. Es war erkennbar eine Verlegenheitsgeste, die wohl so etwas wie angestrengtes Nachdenken vortäuschen sollte. Jessy ließ sich davon nicht beeindrucken. Die meisten Männer konnten nicht einmal wirklich nachdenken, geschweige denn auf eine angestrengte Weise.
„Aber ihr habt doch auch gehört, was er gesagt hat“, begann der Mann dann wieder.
„Onkel Ewald redet viel, wenn der Tag lang ist“, kommentierte Cassy. „Wie schon gesagt.“
„Aber, aber … er hat von ihm geredet. Vom … Fluch!“
Jessy lief es kalt den Rücken herunter, und auch an der sonst so gefassten Cassy ging das nicht spurlos vorüber.
„Seid ihr euch denn nicht gewahr“, fuhr der Mann fort, „dass das Feuerblütenfest kurz bevor steht?“
„Doch, natürlich“, gab Cassy an. „Feuerblütenfest. Mittlerweile nur noch alle fünf Jahre, weil die Stadt nicht mehr genug Geld hat. Man kennt das ja. Aber dann: Spiel und Spaß für die ganze Familie, plärrende Kinder, Tanz und Musik. Also, wenn du uns einladen willst …“
„Versteht ihr denn nicht?“, flehte der Mann nun beinahe schon. „Versteht ihr nicht, was das heißt, Feuerblütenfest? Was es für mich und hunderttausende andere Menschen bedeutet, wenn diese verfluchten Scheißpflanzen alle auf einmal anfangen zu blühen? Wenn ich nichts anderes mehr tun kann als mich im hinterletzten Loch einzuschließen, alles nur wegen dieser verdammten Pollenallergie?!“
„Ach herrje, der Fluch!“, rief Jessy nun unwillkürlich aus, während sie – nicht bedeutend gewillkürter – vom Stuhl aufsprang. „Das hatte ich ja schon ganz verdrängt! Der Fluch! Cassy, hast du etwa auch nicht mehr daran gedacht?“
Sichtlich bemüht, jegliche Anzeichen von Schuldgefühl zu verbergen, blickte Cassy zu ihrer Schwester hinauf. „Jessy“, sagte sie. „Du weißt, dass es für mich kein Thema ist. Wie für die meisten Leute auf Khorinis ebenso nicht. Die meisten, wohlgemerkt.“
„Wie meinen?“, fragte der Mann, offenbar äußerst irritiert vom Verlauf, den das Gespräch nun genommen hatte. Jessy wiederum konnte zunächst nicht anders, als diesem Verlauf teilnahmslos zu folgen. Der Gedanke, dass in wenigen – ja, wie lange war es noch, Wochen, Tage? – alle ihre wilden Albträume wahr würden, hielt sie gelinde gesagt dann doch ein wenig in Atem. Sie blickte auf den Leichnam ihres Onkels. Sie beneidete ihn nicht, keineswegs, aber immerhin blieb ihm so erspart, was Jessy bald erdulden müssen würde. Es war ein offenes Geheimnis, dass Onkel Ewald auch zu dieser seltsamen Erblinie in ihrer Sippschaft gehörte, denen die reine Sildener Landluft über Generationen hinweg die Resistenz gegen Pollen, Blütenstaub und pflanzliches Befruchtungsmaterial jeglicher Art aus den Genen geweht hatte. Jessy hatte diese Schwäche ebenso vermacht bekommen. Cassy, die Glückliche, nicht.
„Du kommst wohl nicht von dieser Insel, oder?“, schloss Cassy. „Gebürtig, meine ich.“
„Das ist korrekt“, sagte der Mann. „Ich bin damals mit der Armee hierhin gekommen. Um gegen die Orks zu kämpfen. Alles lief gut, aber als ich Heimaturlaub bekommen sollte, bin ich irgendwie auf der falschen Kutsche eingeschlafen und nicht mehr rechtzeitig zum Hafen gekommen. Wenige Tage später erlebte ich das Feuerblütenfest zum ersten Mal. Die Feuerblütenpest, besser gesagt.“
„Und du bist all die Jahre hiergeblieben?“, fragte Jessy. „Hast du denn nie wieder darüber nachgedacht, diese Insel einfach zu verlassen?“ Jessy bemerkte, dass sie sich diese Fragen selbst genau so stellen konnte.
„Das Schicksal ist ein Rad“, sagte der Mann etwas mechanisch. „Ich kann nicht gehen, ehe ich dieses Übel beseitigt habe. Lacht über meinen Erzdämon, aber ich glaube, er ist es, der für die gelbe Pest verantwortlich ist.“
„Bei der Sache mit den Bienchen und Blümchen hast du damals nicht so richtig aufgepasst, stimmt’s?“, warf Cassy ein.
Der Mann schüttelte, wenig getroffen, den Kopf. „Ich glaubte, ihn in eurem Onkel zu finden. Aber möglicherweise hat er sich tatsächlich längst wieder einen neuen Wirt gesucht. Die Ratte ist es nicht. Ihr seid es auch nicht. Aber irgendwo, irgendwo lauert er. Und was wäre, wenn er noch hungrig wäre?“
„Das klang jetzt auch wie irgendwo abgelesen“, murmelte Jessy unbemerkt in sich hinein. Ihr Blick war nun wieder über ihren toten Onkel Ewald gewandert. Das Blut hatte mehr gespritzt, als sie im ersten Moment wahrgenommen hatte. Ein Teil der Kuchenstücke auf dem Tisch war außerdem mit ein paar roten, gallertartigen Stücken besprenkelt, die irgendwo aus dem Innern Onkel Ewalds hervorgeschossen sein mussten, als er von der Klinge des Fremden durchbohrt worden war. Fergie zeigte durchaus Interesse an ihnen, die Ratte wurde jedoch zu ihrem Leidwesen von Cassy davon abgehalten, sich die zerteilten Innereien Ewalds einzuverleiben. Ewalds Hemd klebte an seinem Oberkörper und schien mit der klaffenden langsam zu verschmelzen. Zudem hatte sich vor einigen Minuten noch ein kleines Blutrinnsal seinen Weg aus dem Mund von Ewald gebahnt, welches aber mittlerweile an seinem Kinn getrocknet war.
„Du nimmst die Sache mit diesem Erzdämon wirklich ernst, was?“, sagte Cassy nach einer Weile.
Der Mann nickte. „Es gibt ihn, ich muss es euch nicht beweisen. Er wird sich seinen Wirt suchen, wenn er ihn nicht schon gefunden habt. Es dürfte jetzt, wo das Feuerblütenfest kurz bevor steht, immer schwieriger werden, seine Existenz zu leugnen. Spätestens, wenn die Toten wieder anfangen zu wandeln, werdet auch ihr das erkennen. Aber dann ist es zu spät.“
„Du meinst, es wird bald wieder ein vermehrtes Aufkommen von Untoten geben? Auch so richtig mit Zombies? Die finde ich nämlich am besten!“
„Am besten?“, spie der Fremde sichtlich schockiert aus. „Weißt du überhaupt, wovon du redest?“
„Klar weiß ich das“, gab Cassy kühl zurück. „Als Jessy und ich noch jung waren, da gab es ja noch richtig viele von denen. Wenn unsere Eltern nicht aufgepasst haben, sind wir dann in der Dämmerung in die Wälder geschlichen, um sie zu sehen. Manche von ihnen hatten bereits den Kopf von Maden zerfressen, andere wiederum gingen nur noch auf ihren Beinstümpfen, viele fraßen sich gegenseitig das Fleisch von den Rippen … und wenn man Glück hatte, konnte man sogar beobachten, wie einer von ihnen, nunja, den Geist aufgab. Die gluckern dann immer so schön. Oder, Jessy?“
„Jau“, stimmte Jessy zu. „Das war noch was, früher. Heute muss man ja eher Glück haben, um einen noch lebenden Zombie oder so zu finden. Da könnte dieser Erzdämon ruhig mal wieder nachlegen. Andererseits: Wenn der wirklich für diese furchtbaren Pollen verantwortlich ist …“
„Ist er“, bestätigte der Fremde hektisch, gleichwohl etwas schockiert. Jessy konnte sich nicht länger des Eindrucks erwehren, dass hinter der rauen und unrasierten Schale dieses Mannes eine ziemliche Mimose steckte. In der Tat war ihr auch schon aufgefallen, dass der Fremde seinen Blick meist am toten Ewald vorbeilenkte – wie, als könne er kein Blut sehen. Jessy wollte ihn aber nicht darauf ansprechen – sie konnte sich vorstellen, wie peinlich das sein musste, gegenüber Blut und Gedärm solch vorsintflutlichen Ekel zu empfinden. Indes: Wenn es denn wirklich so war, dass dieser Mann ein Problem mit solchen Dingen hatte, dann ging er überaus duldsam damit um, das musste man ihm lassen.
„Gibt es denn keine Möglichkeit, diese Polleninvasion aufzuhalten?“, fragte Jessy dann.
„Genau diese Frage ist es, die mich nun schon seit Jahren auf dieser Insel fesselt“, sagte der Fremde. „Meine Theorie ist: Man kann den Dämon bannen, wenn man seinen aktuellen Wirt zerstört und ihm gleichzeitig die Möglichkeit nimmt, einen anderen Wirt zu befallen. Krushak kann sich dann noch eine Zeitlang selber am Leben erhalten, doch die mangelnde Stofflichkeit wird ihm nach und nach die Kräfte aussaugen, bis er schlichtweg absterben wird. Und mit ihm ein für allemal diese furchtbare Blütenpest.“
„Hast du für diese Theorie Belege?“, fragte Cassy.
„Nein.“
„Hast du eine konkrete Idee, wie du diese theoretischen Überlegungen, selbst wenn sie zutreffend sein sollten, in die Tat umsetzen willst?“
„Nun … nein.“
„Und trotzdem hieltest du es für nötig und sinnvoll, hier hereinzustürmen und unseren – vermeintlich! – besessenen Onkel aufzuspießen.“
„Ich dachte, ich muss euch helfen! Und da das Küchenfenster ohnehin offen stand …“
„So wirst du deinen Dämon nie gebannt kriegen“, schloss Cassy.
„Hast du denn einen besseren Vorschlag?“, fragte der Fremde nun etwas verärgert.
„Ich vielleicht nicht“, raunte Cassy, während sie Ewalds Hausratte über ihren Arm bis rauf zur Schulter klettern ließ, wo das Tier sichtlich zufrieden Platz nahm. „Aber wenn einer etwas über Dämonen, Bannzauber und andere abseitige Dinge weiß, dann ist es wohl Professor Buchanan. Also, andere Magier und Gelehrte wissen natürlich auch über solche Dinge Bescheid, aber die wohnen entweder nicht auf Khorinis oder wollen Geld dafür.“
Der Fremde schien kurz abzuwägen, ob er auf diesen Vorschlag eingehen wollte, und wieder hatte Jessy das Gefühl, dass ihn vor allem zu irritieren schien, in welcher Rolle er sich hier befand: Zunächst als Retter durchs Küchenfenster hineingestürmt, jetzt auf einmal von Cassy geschulmeistert. Und schon musste er für jeden Satz, den er sagen wollte, erst einmal mehrere Sekunden überlegen.
„Wo finde ich diesen Professor?“
Jetzt war es an Cassy, zu überlegen. Sie spielte ein wenig mit den Barthaaren von Fergie herum, ließ ihren Blick über Jessy, den toten Ewald, den Fremden und wieder zurück zu Jessy schweifen.
„Meine Schwester bringt dich hin. Ich glaube, sie hat ja auch ein eigenes Interesse daran, dem Blütenstaub zu entfliehen, oder, Jessy? Und wenn euer Fluch da schon nicht dadurch gestoppt werden kann, dass irgendwelche absurden Bannrituale mit ausgedachten Erzdämonen durchgeführt werden, dann hat Professor Buchanan ja vielleicht eine andere Lösung. Oder vielleicht ein abgeschottetes Kämmerlein, in dem ihr den ganzen Frühling verbringen könnt. Was sagst du, Jessy?“
„Klingt jetzt gar nicht mal so schlecht“, sagte Jessy mehr pflichtbewusst denn überzeugt. „Aber was machst du denn dann so lange, Cassy? Und was ist mit Onkel Ewald?“
„Um den kümmere ich mich schon“, winkte Cassy lässig ab und setzte Fergie zurück auf den Tisch. „Geht ihr nur. Ich wünsche euch viel Glück!“
„Tja, dann … sind wir jetzt wohl Reisegefährten“, merkte der Fremde etwas unbeholfen an.
„Kein Ding“, meinte Jessy, die selber noch nicht so recht wusste, was sie von der Sache halten sollte. Sie blickte noch einmal zu Cassy, die gerade eine frische Gabel aus einer Schublade gefischt hatte.
„Wie ist denn eigentlich dein Name?“, fragte Jessy dann zum Fremden gewandt.
„Roland. Roland der … ach, nenn mich einfach nur Roland.“
IV. Immer noch Jessy. Hörner.
Scheiße …
Jessy kam aus dem unruhigen Wasser empor wie jeden Morgen aus ihrem tiefen Schlaf. Zuerst herrschte pechschwarze, brüllende Verwirrung, als befände sie sich im Inneren eines tosenden Strudels – was wohl auch der Wahrheit entsprach, da sie eben diesen Strudel selbst geschaffen hatte. Jessy spürte Glibber im Nacken und Stiche in den Schultern. Ihre Muskeln dort schienen in einem Krampf erstarrt zu sein. Sie hoffte, dass Letzteres bloß Auswuchs der geringen Wassertemperatur war und nicht etwa eine Folge der Blutegelbisse. Nun, eigentlich dachte sie in dem Moment aber gar nicht so viel nach. Sie wollte nur raus, und all ihr Denken war auf dieses eine einzige Ziel gerichtet.
Sie kämpfte sich mit aller Kraft ihren Weg hindurch, wohlwissend, wo sie war und warum es die beste Idee war, schnell wieder hier herauszukommen. Dann, eine wärmere, ruhigere Schicht. Sie wünschte, es wäre bloß ein Albtraum gewesen, denn dann wäre er wohl jetzt schon vorbei, endgültig und für immerdar. Aber dieses Glück war ihr – Glückskind hin oder her – nicht vergönnt.
Als sie noch näher an die Oberfläche gelangte, kam eine weitere kalte Schicht: Der Gedanke, dass die Wirklichkeit, die sie erwartete, genauso schlimm war wie irgendein Albtraum. Möglicherweise sogar noch schlimmer.
Sie weigerte sich, darüber nachzudenken. Zumal es ja doch recht ironisch war: Jetzt fürchtete sie sich noch vor dem Gestank, in einigen Tagen würde sie dank verschlossener Nase vermutlich gar nichts mehr riechen können. Sie erwog, einfach umzukehren, wieder in die Tiefe hinabzutauchen, in das kühle und brackige, gleichwohl vor Blütenstaub schützende Wasser. Das hieße ertrinken oder stinken, aber vielleicht bedeutete das Leben an Land im Frühling von Khorinis für sie vielleicht auch irgendwann ersticken. Aber so oder so, die Vorstellung, dass entweder der betäubende Geruch von frisch aufgegangenen Feuerblüten oder aber der Gestank von verflüssigter Kuhscheiße das letzte sein könnte, was sie in ihrem Leben wahrnahm, war ihr unerträglich.
Obwohl sie im Wasser schwamm, fühlte sie sich völlig trocken. Trocken, aber umso dreckiger. Ihren Mund hielt sie dementsprechend nicht nur wegen des Wassers selbst geschlossen, sondern vor allem wegen dem, was in diesem Wasser noch so alles sein Unwesen trieb.
Jessy schwamm verbissen weiter nach oben; über Hygiene würde sie sich Gedanken machen, wenn sie den Wasserspiegel durchbrochen hatte und frische, klare Luft in ihre Lungen strömen würde.
Die letzte Schicht, durch die sie schwamm, war warm und furchteinflößend zugleich, wie frisch vergossenes Blut – Cassy hätte ihre schiere Freude daran gehabt. Sie wusste plötzlich, warum sie ihre Finger nicht mehr spürte, warum ihr Hände und Handgelenke so schlimm schmerzten.
Jessy keuchte und schlug die Augen auf. Ihre Arme zuckten unkontrollierbar in einem nervösen Stakkato von Nadelstichen. Das metallische Klirren, das sie dabei über sich hörte, verschaffte ihr die letzte Gewissheit.
„Ich dachte mir, jetzt am Schluss helfe ich doch mal nach. Ich will schließlich noch irgendwann bei diesem Professor Buchanan ankommen.“
Jessy blickte zu Roland auf. Der Mann hatte nun die Hände in die Hüfte gestemmt und sah so aus, als wollte er in dieser Position für immer stehen bleiben. Als er sich zum Tümpelloch heruntergebeugt hatte, war sein am Gürtel steckendes Schwert gegen diverse metallene Schnallen geprallt, wie es die Klinge schon auf dem ganzen Weg bis hierhin beständig getan hatte.
Jessy rappelte sich auf und strich sich über die Kleidung. Sie war nass und dreckig, aber letzteres viel, viel weniger, als sie zuvor noch befürchtet hatte. Eine kurze Geruchsprobe wollte ihr versichern, dass sie auch nicht stank, zumindest nicht besonders, aber nachdem sie nun einmal ihre Nase in dieses vergüllte Brackwasser getaucht hatte, konnte sie ihr nicht mehr ganz trauen.
„Du hättest mir auch ruhig mal eher helfen können!“
Roland schüttelte den Kopf. „Ich hätte, aber es wäre falsch gewesen. Selber schwimmen oder untergehen.“
„Dir ist schon bewusst, dass ich gerade beides gemacht habe, und zwar in umgekehrter Reihenfolge?“
„Mag sein. Du hättest besser aufpassen müssen. Dann hättest du gesehen, dass dort kein Weg ist, sondern lediglich ein Tümpel voller Unrat, dessen Oberfläche mit Heu bedeckt ist. Oder war.“
„Spar dir dieses Gerede!“ Jetzt war Jessy es, die sich die Hände in die Hüfte stemmte, und das sicherlich mit deutlich mehr Energie, als der Mann vor ihr es gerade tat. „Im Nachhinein kannst du natürlich auf schlau tun. Aber selber zig Jahre hier auf dieser Insel verbringen und den Weg zu Professor Buchanan nicht kennen, was?“
Roland sagte nichts, sondern rieb sich die linke seiner beiden unrasierten Wangen. Es war wieder diese Nichtgedanken-Geste.
„Ich wollte doch nur eine Abkürzung nehmen, damit wir uns nicht totlatschen!“, setzte Jessy nach.
„Der kürzeste Weg ist nicht immer der sicherste.“
Jessy musste sich ein Lachen verkneifen. Es war dieses Lachen, das sich manchmal seinen Weg bahnen wollte, wenn sie sehr wütend war. Wenn alles so ärgerlich, aber gleichzeitig so absurd war, das Wut und verzweifelte Amüsiertheit kollidierten, in einen unauflösbaren Konflikt miteinander gerieten.
„Ja, genau, hau sie weiter raus, deine verdammten Sprüchlein“, knurrte Jessy. „Das hat bisher ja schon so super geholfen. Bei Innos, hätten wir doch nur einfach die Kutsche genommen … aber das wolltest du ja auch nicht!“
„Von Kutschen und Wagen habe ich genug – sie haben mich bisher immer ins Unglück gefahren“, erklärte Roland kaum gerührt. „Außerdem hat uns diese Frau am Mietstand doch von der Sache mit dieser einen Kutsche erzählt, die mal diesem Till gehört haben soll, der sich darin das Leben genommen haben soll und wo seine Mutter …“
„Du glaubst auch wirklich noch der hinterletzten Gruselgeschichte, was? Was denn noch alles? Der Lieferant, der seinen Kunden Gift ins Essen mischt? Der betrunkene Mondputzer? Der große Lurkerhoden-Betrug? Das doppelte Löschen? Der schreckliche Handkäse? Die Geschichte vom Wassermagier und dem Dschinn? Die Ausgestopften in der Herberge ’Zum schlafenden Geldsack’? Die Legende vom Großen und Schrecklichen Molerat? Der folgenschwere Umzug des kleinen Guy? Die Sage vom magischen Ulu-Mulu?“
„Hä, was? ’Die Geschichte vom Wassermagier und dem Dschinn’? Ach komm, das hast du dir jetzt aber ausgedacht. Es gibt in Wirklichkeit doch gar keine Dschinns!“
Jessy widerstand dem Drang, sich mit der flachen Hand auf die Stirn zu hauen oder sonstwie ihr Gesicht zu vergraben. Stattdessen wandte sie sich wieder sich selbst zu und pflückte noch ein paar von diesem strengen Gemisch aus Regenwasser und Gülle getränkten Grashalmen von ihrer Kleidung. Das war immerhin messbarer Fortschritt.
„Wenn wir eine Abkürzung wollen, dann sollten wir einfach über diese Kuhweide gehen“, sagte Roland schließlich nach einer Weile, in der sich Jessy fast vollständig von den greifbaren Überresten ihres unfreiwilligen Tauchgangs befreit hatte. „Dort, wo die Kühe gehen, wird man als Mensch wohl kaum einsinken. Wir müssen uns nur einen Weg zwischen den Haufen durch bahnen.“
Jessy wurde jetzt, da Roland wieder sehr gefasst auftrat, auf einmal auch ganz ernst zumute. Sie spürte den Funken eines Verlangens, Rolands Hände in die ihrigen zu nehmen und bekräftigend zuzudrücken.
„Aber dort auf der Wiese, zwischen den ganzen Kühen, da lauert ein Bulle. Und er hat Hörner“, sagte sie.
Roland sah Jessy fragend an. Er tat dies, indem er seine linke Augenbraue hochzog, so, wie nur er es konnte.
Jessy räusperte sich. „Hörner. Er hat Hörner.“
„Na und?“
„Was, na und?“, sagte Jessy, und spürte mit einem Mal wieder sehr deutlich die unangenehme Nässe ihres Kleides. Es war, als drückte die klatschnasse Hand eines Fischmenschen auf den Stoff ihrer Oberbekleidung, einen durch das Auge nicht wahrnehmbaren, aber schwer lastenden Abdruck hinterlassend.
„Was, na und na und?“, führte Roland das Spiel fort.
„Na, beunruhigt dich das denn nicht? Wenigstens ein bisschen?“
„Ich wüsste nicht, wieso.“
„Und ich wüsste nicht, wieso nicht.“
„Vielleicht ist es ja noch nicht der richtige Tonfall. Sag’s nochmal, Jessy.“
„Dort lauert der Bulle … und er hat [/I]Hörner.[I]“
Roland blickte sie weiterhin mit dieser hochgezogenen Augenbraue an. Wie ein Triumphbogen aus Haaren thronte sie über seinem Auge.
„Das ist es vielleicht schon eher“, sagte er. „Aber da fehlt noch was. Versuch’s noch einmal!“
„Hörner … [I]Hörner[I], … [/I]Hörner[/I] …“, probierte Jessy herum. „Hörner.“
„Woah“, rief Roland aus. Wie an einem unsichtbaren Angelhaken gezogen fuhr nun auch noch seine rechte Augenbraue hoch. „Das isses! Jetzt läuft’s mir kalt den Rücken herunter.“
„Ja, mir auch“, pflichtete Jessy ihm in einer Mischung aus Aufregung und Betroffenheit bei. „Schrecklich, oder?“
„Ja“, bestätigte Roland erneut und rieb sich das unrasierte Gesicht. „Aber bei mir bist du sicher.“
Jessy warf sich Roland in die Arme. „Danke“, seufzte sie. „Aber ich vertraue lieber auf den Zaun, der ihn von uns trennt.“
„Wie wahr, wie wahr“, grummelte Roland.
V. Schon wieder Jessy. Zweimal eins macht drei.
„Da wären wir“, sagte Jessy zufrieden, als sie und Roland vor dem großflächig angelegten, in der Mitte mit einer Kuppel versehenen Gebäude auf der grasigen Anhöhe zum Stehen kamen. „Professor Buchanans wissenschaftlich-magisches Institut.“
Jessy konnte verfolgen, wie Rolands Blick über den gesamten Gebäudekomplex schweifte und schließlich über dem rauchenden Schornstein, der an der Seite der Kuppel angebracht war, verharrte.
„Wissenschaftlich-magisches Institut? Mir sieht das eher nach einem Krematorium aus.“
„Krematorium und Leichenhalle!“, fügte Jessy vergnügt hinzu. „Wenn dir also jemand bei deinem Erzdämon-Zombie-Wirtskörper-Problem helfen kann, dann wohl Professor Buchanan. Er ist zwar manchmal etwas verwirrt, aber er ist vom Fach!“
Jessy marschierte zum großen Tor und ließ Roland einfach stehen. Er folgte ihr nur langsam nach und schien sich ein wenig zu zieren, die steinerne Schwelle zu betreten. Jessy störte sich nicht daran, ergriff den massiven Türklopfer, der in der Form einer Harpyienklaue daherkam, und klopfte dreimal gegen das dunkle Eichenholz. Es dauerte nicht lange, da klappte ein Torflügel nach innen und ein hochgewachsener, hagerer Mann trat heraus.
„Wie kann ich Euch … oh, Jessy!“
„Guten Tag, Professor Buchanan!“
„Jessy, welch Freude!“ Das eingefallene Gesicht bekam auf einmal Farbe. „Und den werten Herrn Begleiter darf ich auch begrüßen. So kommt doch rein!“
Jessy tat wie geheißen, und diesmal sprang auch Roland schnell bei Fuß. Im Innern des Institutsgebäudes erwartete sie zunächst das dunkle, stille Foyer und spendete ihnen Kühle. Jessy hoffte, dass Professor Buchanan nicht zu nahe an sie herankam. Mochte sie selber auch nichts mehr an sich riechen, man konnte doch nie wissen. Gestank war drinnen immer schlimmer als draußen.
„Jessy, ich nehme mal an, du bist hier, um deine Tante zu sehen, und ich kann verstehen, dass du da ungeduldig bist. Ich muss dich aber darauf hinweisen, dass das Plastinat eine sehr gebrechliche Konstitution hat. Es zerfällt schon bei geringsten Erschütterungen in seine Einzelteile. Ich habe sie ja schon seit drei Monaten hier bei mir, ich weiß, wovon ich rede. Man sollte sich von ihrem soliden Erscheinungsbild also nicht täuschen lassen. Vor allem der Kopf macht noch Probleme. Von daher hielte ich es für besser, wenn du mir vielleicht noch einige Wochen Zeit gibst, damit …“
„Professor Buchanan?“
„Äh … ja bitte?“
„Meine Tante ist doch gar nicht hier bei Ihnen.“
„Wie … nicht?“ Professor Buchanan wischte nervös seine Hände an seinem Leibrock ab.
„Nee“, bekräftigte Jessy. „Da müssen Sie etwas verwechselt haben.“
„Aaaach, ja, sicher“, sagte Professor Buchanan nun und zupfte sich seine Fliege zurecht. „Richtig, das war ja gar nicht deine Tante. Sondern die deiner Schwester.“
Stille. Sie passte zu dem Ort. Auf der gegenüberliegenden Seit des Foyers waren ein paar Schaukästen angebracht, in einer Reihe mit einigen kunstvolleren Vitrinen. Jessy sah herüber und erkannte doch nichts. Das tat sie einige Zeit lang. Die Verlegenheit, die in der Luft lag, war greifbar. Professor Buchanan bemerkte trotz allem nichts.
„Professor Buchanan?“
„Ja?“
„Die Tante meiner Schwester wäre auch meine Tante.
„Oh, stimmt ja!“, erkannte nun auch Professor Buchanan und rieb sich verlegen die knochigen Finger. „Also ist es doch deine Tante, die ich hier habe! Da wolltest du mich wohl reinlegen, Jessy!“
„Es ist weder meine Tante noch Cassys Tante.“
Professor Buchanan schaute nun sehr skeptisch. Er konnte das gut, tat es aber meistens dann, wenn er falsch lag, und nie dann, wenn es angebracht war.
„Aber irgendwer muss die Tante doch hergebracht haben!“
„Das ist richtig, aber meine ist es nicht. Meine, unsere Tante hat nach langem Überlegen, ob sie im Sarg beerdigt, in der Urne eingeäschert oder doch konserviert werden will, einen etwas … anderen Weg gewählt, der eine Schwarzdestillerie und zwei Fuhrwerke beinhaltete … grob beschrieben jedenfalls. Von meiner Tante ist jedenfalls nichts mehr übrig, und das ist sehr lange her. Tut mir leid, Professor Buchanan, aber von mir wird es keine Tante für Sie geben.“
„Och“, machte Professor Buchanan daraufhin bloß. Nun war er wieder ganz bleich und hager, ein bisschen, als wollte er nun selbst ersatzweise den Platz dieser ominösen Tante einnehmen.
„Ich kann Ihnen aber einen Onkel anbieten“, sagte Jessy deshalb rasch. „Er ist erst … vor kurzem gestorben und noch nicht … also …“
Jessy brach ab, denn vor ihrem geistigen Auge erschien ihr toter Onkel Ewald und Cassy, wie sie sich um ihn kümmerte. Vielleicht hatte sie, Jessy, den Mund etwas zu voll genommen – und Cassy womöglich auch. Sie wollte dem Professor lieber nicht voreilig etwas versprechen, was sie dann nicht halten konnte.
„Warum ist er denn dann noch nicht hier?“, fragte Professor Buchanan, der seine Aufregung ganz offenbar unterdrücken wollte, es aber nicht konnte. „Ich meine“, fügte er hinzu, „das ist sicherlich ein tragischer Verlust, aber … hm … woran ist er denn … ?“
„Wir, äh … Cassy ist gerade noch dabei, ihn … zu untersuchen, was denn die Todesursache war. Er ist beim Essen einfach zusammengesackt … ja. Aber wenn sie mit ihm fertig ist, dann bringt sie ihn bestimmt hierher … wenn sie will … also, ich muss mit ihr da noch einmal drüber reden, ja.“
„Das muss ich respektieren“, sagte Professor Buchanan nun sehr gefasst. „Scheut euch aber nicht, mich zu konsultieren, solltet ihr Hilfe dabei brauchen. Mit Todesursachen kenne ich mich zwar nicht so gut aus wie mit deren Ergebnis, aber ein bisschen was bleibt bei den ganzen morbiden Studien schon hängen, sage ich mal … auch ohne Galgen, wenn ihr versteht, was ich meine!“
„Wir verstehen“, sagte Jessy rasch. „Wenn es geht, dann werden wir Onkel Ewald herbringen. Aber versprechen kann ich nichts!“
„Ein Versprechen verlange ich von dir auch nicht“; sagte Professor Buchanan milde. Nach einer Pause, in der er sich erneut die Fliege zurechtrückte und zudem auch noch ein leises professorales Räuspern ertönen ließ, fuhr er fort: „Dann muss es aber einen anderen Grund geben, warum du hier bist, Jessy. Oder ist das tatsächlich einfach nur ein Besuch um des Besuchens willen? Nicht, dass mich das nicht freuen würde – ganz im Gegenteil!“
„Ja, doch, wir kommen aus einem besonderen Grund … aber das kann dir vielleicht Roland hier besser erklären.“
Jessy wies auf ihren Begleiter, der sich die ganze Zeit über geradezu schüchtern im Hintergrund gehalten hatte, nun aber, der Aufmerksamkeit bewusst, Haltung annahm, breiter Stand, Brust raus, eine Pose wie vor Beginn eines Duells.
„Das ist korrekt. Professor Buchanan, ich bin aus einem bestimmten Grund zu Ihnen gekommen. Wie Sie vielleicht wissen, ist bald …“
„Ah, aber bitte, bitte, machen Sie sich doch keine Umstände!“, schnitt Professor Buchanan ihm das Wort ab und legte um ein Haar den Arm um die Schultern seines Gastes, entschied sich aber augenscheinlich im letzten Moment noch einmal anders. Sein Grinsen allerdings blieb ganz breit, was ihn im Zusammenspiel mit seinen eingefallenen Schläfen seltsam aussehen ließ, wie durch einen Spiegel ein verzerrtes Bild.
„Ich freue mich über jeden neuen Besucher, und auch, wenn Sie mich ein wenig überrascht haben, so will ich Ihnen doch ein gutes Programm bieten, wenn Jessy Sie schon hergebracht hat. Sehen Sie, die Ausstellung hier im Foyer ist zwar noch nicht ganz fertig, aber das mag sie für Sie nur umso exklusiver erscheinen lassen: Sie sind dann schließlich der erste, der sie, außer mir natürlich, zu Gesicht bekommt, mag sie auch noch unvollständig sein. Ich hoffe, das ist in Ihrem Sinne!“
„Es geht mir nicht darum, ob Ihre Ausstellung vollständig oder unvollständig ist, mir geht es -“
„Gut, sehr gut, habe ich es mir doch gleich gedacht!“, folgerte Professor Buchanan, der mehr und mehr aufblühte und nun wieder besonders viel Farbe im Gesicht hatte, sodass es um seine Nase herum beinahe für ein helles Grau reichte.
„Mir fällt gerade auf, dass ich mich Ihnen noch gar nicht vorgestellt habe. Lassen Sie uns diesen formalen Teil doch schnell abschließen, ja? Ich begrüße Sie rechtherzlich im größten Krematorium und Leichenschauhaus auf ganz Khorinis – wir haben ja auch nur das eine, müssen Sie wissen! Mein Name ist Professor Buchanan, ich leite dieses Institut nun schon einige Jahre. Mit der Historie dieser Einrichtung und ihrer und meiner Erfolge will ich Sie nicht langweilen. Seien Sie sich aber bewusst, dass dies hier eine führende Forschungsstelle ist, die inselweit – ich sagte es schon – ihresgleichen sucht.“
Roland rieb sich die Schläfe, er schien zu überlegen. „Bei all den Forschungen, haben Sie da vielleicht auch etwas über -“
„Alles, alles!“, rief Professor Buchanan aus. „Mehr, als Sie sich vorstellen können! Wie gesagt, die Ausstellung hier im Foyer ist noch nicht ganz fertig, aber Sie bietet bereits eine große Vielfalt an Exponaten, alle mehr oder minder aus den hiesigen Forschungsarbeiten resultierend. Kommen Sie mit, es ist gleich da drüben, ich werde Sie herumführen. Sie werden staunen!“
„Aber -“
„Ey!“ Jessy verpasste Roland einen kleinen Hieb in die Seite, während Professor Buchanan über das dunkle Parkett hinüber zur anderen Seite des Foyers spazierte. „Lass ihn einfach erst einmal erzählen, aus der Nummer kommen wir sowieso so schnell nicht wieder heraus. Vielleicht ist ja etwas Passendes dabei. Selbst wenn nicht: Wenn wir ihn jetzt unterbrechen, dann ist er nur beleidigt, und dann brauchen wir nicht mehr darauf zu hoffen, dass er uns hilft.“
Roland nickte. „Immerhin sprichst du schon von ’uns’.“
„Ich habe auch keine Lust, mich beim Feuerblütenfest kaputtzuröcheln, ob das jetzt nun mit irgendeinem Erzdämon zu tun hat oder nicht. Und jetzt komm!“
Schon bald hatten Jessy und Roland Professor Buchanan eingeholt, der sich, schon rein äußerlich vor Stolz sprühend, vor einem der Schaukästen aufgebaut hatte. Hier im hinteren Bereich des Foyers war es auch noch einmal deutlich kühler, und Professor Buchanans dicker Leibrock ergab auf einmal Sinn.
„Dann fangen wir doch direkt einmal mit dem ersten Exponat an“, erhob Professor Buchanan seine Stimme. „Es ist in diesem Schaukasten hier, hinter dem Glas. Klein, unscheinbar, aber von nicht zu unterschätzender historisch Bedeutung.“
Jessy blickte durch das Glas. Dort lag ein Stück Papier, ein Zettel, vergilbt, alt, zur Hälfte in einem Umschlag, offenbar ein Brief. Sie konnte sehen, dass dort etwas geschrieben stand, aber sie konnte es nicht lesen. Das Dämmerlicht in der Halle ließ es nicht zu.
„Heißt das, die Bedeutung ist so gering, dass man sie niemals unterschätzen kann, egal, wie niedrig man sie ansetzt?“, fragte Roland.
Professor Buchanan stockte kurz. Jessy warf Roland einen bösen Blick zu, aber er nahm das gar nicht wahr.
„Nun, nein, ich meine … vielleicht meinte ich, die Bedeutung ist kaum zu überschätzen, oder, man darf sie nicht … ich meine … also, dieses Dokument ist sehr wichtig!“
„Achso.“
„Jawohl! Wir haben es hier nämlich mit dem sogenannten Brief des unbekannten Soldaten zu tun.“
Jessy erschauderte. Niemand bekam es mit.
„Es ist eines der wenigen erhaltenen Dokumente aus dem letzten Krieg. Leider konnten auch graphologische Gutachter den Urheber dieses Briefes nicht identifizieren. Die Handschrift sei eine bäuerliche, so schloss man übereinstimmend, aber hinsichtlich weiterer Details herrscht große Uneinigkeit. Dieser Brief muss in einer recht frühen Phase des Krieges von der Front geschickt worden sein, aber offenbar ist er nie angekommen. Der Adressat konnte ebenso nicht entziffert werden.“
„Interessant“, bemerkte Roland tonlos. „Aber ich dachte, dies hier sei ein Leichenschauhaus und kein Postarchiv?“
„Fürwahr, fürwahr“, bestätigte Professor Buchanan in ungebrochener Begeisterung, noch bevor Jessy versuchen konnte, Roland für seine Nachfrage abzustrafen. „Sie können mir glauben: Hätte ich den Leichnam des Autoren hier statt nur seinen Brief, ich wäre um einiges glücklicher! Indes: Das ist alles, was ich hier habe, und da Grund zur Annahme besteht, dass der Schreiber an der Front umgekommen ist und im Hinblick darauf, dass der Krieg wie kaum ein zweites Phänomen Ursache für Ableben jeglicher Art ist, ist es durchaus gerechtfertigt, dass ich eben diesen Brief hier aufbewahre.“
„Macht Sinn“, brummte Roland.
„Nicht wahr? Und schauen Sie, wir haben in diesem Kasten, auf dem Regalbrett direkt unter dem mit dem Brief, noch ein weiteres Exponat. Sie erkennen vielleicht nicht sofort, was es ist: Es ist eine Fahrkarte für ein Passagierschiff. Noch ungestempelt.“
„Aha.“
„Ja! Ich will Sie nicht mit den Details langweilen, aber angesichts der Strecke, für die diese Karte ausgestellt ist, ist es äußerst erstaunlich, dass diese Fahrt nicht auch genutzt wurde. Das kleine Schiffsmotiv auf diesem Kärtchen lässt nämlich darauf schließen, dass diese Fahrkarte zu Kriegszeiten ausgestellt wurde. Und in dieser Zeit waren solche Karten teuer – und sehr begehrt! Riesige Schlangen sollen sich an den entsprechenden Schifffahrkartenverkaufsschaltern gebildet haben! Da ist es doch ein Wunder, dass die Karte nie entwertet wurde.“
„Und Sie glauben jetzt, der Besitzer dieser Fahrkarte ist gestorben, bevor er sie einsetzen konnte?“, fragte Roland.
„Das könnte sein!“, bestätigte Professor Buchanan. „Oder wer weiß: Vielleicht konnte die Fahrt wegen der Kriegswirren schlicht nie unternommen werden! Mag diese Fahrkarte also in keinem – zumindest uns bekannten – unmittelbaren Zusammenhang zum obigen Brief stehen, so steht sie jedenfalls ebenso im Zusammenhang mit dem Krieg, und damit auch mit dem Tod. Vieles steht und fällt mit dem Tod, wissen Sie. Das Briefeschreiben ebenso wie das Schifffahren.“
„Das ist wohl wahr“, stimmte Roland zu.
Sie gingen weiter die Strecke aus Schaukästen und Vitrinen entlang, übersprangen ihrer zwei, und kamen dann an einer Art Holzsockel an, unter dessen aufgesetzter, gläserner Käseglocke ein Etwas von Metall ruhte, verrostet und ganz offensichtlich von Meersalz zerfressen – das entnahm Jessy jedenfalls der Plakette, die am oberen Ende des Sockels angebracht war.
„Dies hier“, begann Professor Buchanan, „ist Die eiserne Maske des Jargo.
Jessy erschauderte erneut. Professor Buchanan hatte das wirklich drauf, das musste sie ihm lassen.
„Oder eher das, was von ihr übrig ist. Jargo war einer der letzten Piratenkapitäne von Khorinis, aus einer Zeit, als das Piratenwesen – im Gegensatz zu heute – noch florierte. Auf seine alten Tage hatte er sich aber bereits zur Ruhe gesetzt. Bekannt wurde er sodenn auch weniger durch seine gelungenen Raubzüge, als durch seinen ausgeprägten Geruchssinn, der hellseherische Züge aufwies und Jargo den Spitznamen ’Die zweite Nase’ einbrachte. In Anbetracht der Tatsache, dass er aufgrund seines entstellten Gesichtes – wie ja jeder Schurke, sei es auch ehemalig, ein solches Gesicht hat – diese Maske tragen musste, war dieser Spitzname vielleicht in gleich mehrfacher Hinsicht gerechtfertigt. Weder Spitzname noch Maske noch Geruchssinn konnten jedoch verhindern, dass auf einer königlichen Fahrt zur endgültigen Ausrottung jeglicher Seeräuberei diese Maske mitsamt Jargo über Bord ging. Von Jargo ist, soweit wir wissen, nichts übrig geblieben, von seiner Maske immerhin etwas. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass erst Jargos Gesicht entstellt wurde, und zum Ende seines Lebens dann auch noch genau das Utensil, welches diese Entstellung eigentlich verbergen sollte. Und wie alle Geschichten endet auch diese mit einem Tod.“
„Die Geschichte der meisten Menschen endet mit dem Tod, oder?“, warf Roland ein.
Professor Buchanan zögerte. „Nun … ja! Aber nicht jede ist so spektakulär erzählt, oder?“ Der Professor lachte. Es war durchaus verlegen, gleichwohl hatte Jessy nicht das Gefühl, dass er besonders peinlich berührt war. Stattdessen führte er sie gleich zum nächsten Ausstellungsstück. Es war ein kleiner Kleiderständer hinter Glas, mit sehr vielen Streben, von denen nur zwei belegt waren: An der einen Seite hing ein ein irgendwie verschrumpelt aussehendes Etwas, welches Jessy sodann aber als alte Strumpfhose identifizieren konnte. Auf der gegenüberliegenden Seite war ein kleine, angelaufene Silberkette angebracht, die einst sehr protzig gewirkt haben musste.
„Noch mehr Hinterlassenschaften von Verstorbenen, was?“, merkte Roland an. Jessy überlegte, ob Roland sich mit dieser Bemerkung über Professor Buchanan und seine Ausstellung lustig machen wollte – nur mit ironischem Unterton wäre so eine Bemerkung nicht selbst hochnotpeinlich gewesen. Tonfall und Mimik Rolands ließen aber keinerlei Ironie erkennen, und so, wie Jessy diesen Mann bisher erlebt hatte, traute sie ihm auch vollen Ernst bei dieser Nachfrage zu.
„So ist es“, antwortete Professor Buchanan ungerührt. „Wobei diese Verstorbenen – es sind Damen – nicht an sich besonders sind, sondern eher ihre Profession: Wir sehen hier Kleidungsstücke beziehungsweise Schmuck von Prostituierten, die ihrem Gewerbe hier auf Khorinis nachgingen.“
„Wurden sie ermordet?“
„Das weiß ich nicht. Aber diese Nachfrage ist erneute Rechtfertigung dafür, dass diese Utensilien hier ausgestellt sind: Nach Soldaten und sonstigen Kriegern haben Prostituierte wohl das höchste Risiko, Opfer eines Todes durch Fremdverschulden zu werden – noch vor den Stadtwachen! Die Prostitution ist also nicht nur ein Gewerbe, dem ein roter Schimmer, sondern zugleich auch der dunkle Hauch des Todes anhaftet. Genau deshalb hat dieser Kleiderständer hier seinen Platz. Überschrieben ist dieses Exponat übrigens mit dem Titel ’Trilogie der Stile’, weil die Strumpfhose einerseits ein recht einfaches Fabrikat ist, die Silberkette zu ihren – im wahrsten Sinne des Wortes – Glanzzeiten aber eher Schmuck des nobleren Segments des entsprechenden Gewerbes gewesen sein muss.“
„Und das dritte?“, entfuhr es Roland.
„Wie meinen?“
„Na, das dritte … Teil, Stück, wie auch immer.“
„Welches dritte Stück?“
„Ja, eben!“
Professor Buchanan hatte die Hände nun wieder an der Fliege. „Nun, ich muss zugeben, dass ich gerade nicht ganz weiß, worauf Sie hinaus wollen. Helfen Sie mir vielleicht aus?“
„Ich will darauf hinaus, dass eine Trilogie üblicherweise drei Teile hat, ich hier aber nur zwei sehe.“
„Nur zwei Teile … das, ähm, ach, achso! Ja! Nun, sehen Sie: Der dritte Teil, der kann ja durchaus noch nachfolgen! Also, ganz gewiss wird er das tun! Von daher rechtfertigt es das doch, bereits jetzt von einer Trilogie zu sprechen, nicht wahr? Sie sollen ja schließlich noch einmal wiederkommen.“
Professor Buchanan lächelte, schien auf eine weitere Nachfrage zu warten, ging dann aber auch schon weiter die Ausstellungsstrecke entlang.
„Nun gut … kommen wir nun vielleicht zu etwas Spektakulärerem, auch wenn es Größe und Aussehen des Objektes auf den ersten Blick nicht vermuten lassen.“
Mit sachter Geste lenkte Professor Buchanan ihre Blicke auf einen kunstvollen Steinsockel, in dem eine Fassung eingelassen war, welche wiederum eine nicht allzu große, aber auch nicht allzu kleine Metallkugel beinhaltete. Eine Plakette bezeichnete dieses Exponat schlicht mit den Buchstaben KM – was Jessy aus irgendeinem Grund direkt wieder erschaudern ließ.
„Was ist daran spektakulär?“, fragte Roland.
„Nun“, sagte Professor Buchanan lächelnd, dabei im fast schon verschwörerisch anmutenden Tonfall. „Spektakulär ist, dass wir bis heute nicht genau wissen, wozu diese Kugel eigentlich diente.“
„Aha.“
„Was wir wissen, ist, dass sie mal magisch aufgeladen gewesen sein muss – als sie hier ins Institut kam, konnten noch geringe magische Kräfte festgestellt werden, die sich mittlerweile freilich vollends verflüchtigt haben dürfen. Der Beschaffungsnachweis gab zudem an, dass diese Kugel zusammen mit zwei weiteren, identisch aussehenden Exemplaren ihrer Art in einer Art Tresor gefunden wurden, dessen Herkunft wiederum nicht eindeutig festgestellt werden konnte. Die einzige weitere Information ist, dass an diesem Tresor ein Papier mit der Aufschrift ’Ersatzteile KM’ angebracht gewesen ist. Weitere Nachforschungen, wofür die Kennung ’KM’ steht, führten jedoch ins Leere.“
„Und weshalb ist diese Kugel dann hier ausgestellt?“, fragte Roland, der mehr und mehr echtes Interesse an dieser Ausstellung zu bekommen schien – oder dies nur besonders gut vortäuschen konnte. „Auf Verdacht, dass sie etwas mit Tod und Sterben zu tun haben könnte?“
„Aaah, Sie sind also von selbst drauf gekommen“, hauchte Professor Buchanan anerkennend. „Ja, es ist wahr, wobei ich, bei allem Respekt, nicht nur von einem bloßen Verdacht sprechen würde, auf dem die Entscheidung, dieses Stück hier auszustellen, gegründet ist. Angesichts der Schwere und Form dieser Kugel sowie des schon erwähnten Umstandes, dass sie offenbar zu ihrer aktiven Zeit, wenn man das so sagen darf, magisch aufgeladen gewesen sein muss, besteht vernünftiger Grund zur Annahme, dass sie als eine Art Projektil oder sonstiges Objekt zur Zerstörung von entweder anderen Objekten oder menschlichem Gewebe diente. Natürlich kann dieser Beweis nicht stringent geführt werden, aber darum soll es gar nicht gehen. Funktion, ja Hauptzweck dieser Kugel im Rahmen dieser Ausstellung soll sein, die Besucher eben gerade darüber nachdenken zu lassen beziehungsweise ihnen einen bestimmten Gedanken einzugeben: Wann immer Erfindungen gemacht werden, so besteht eine durchaus respektable Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Erfindungen zum Töten eingesetzt werden, wenn sie nicht schon von Beginn an zum Töten geschaffen wurden.“
„Da kann ich nicht widersprechen.“
„Gut gut!“, sagte Professor Buchanan zufrieden. „Sie scheinen wirklich Gefallen an dieser Ausstellung zu finden, was? Nun, dann bin ich mal gespannt, was Sie zu diesem Stück hier sagen.“
Sie standen nun vor einem Glaskasten von den Ausmaßen einer kleinen Standuhr. Innen war ein Holzbrett angebracht, an dem ein längliches Textilstück angenagelt war, welches sich nach näherem Hinsehen als eine Krawatte entpuppte. Sie war türkis, mit kleinen blauen Rauten, wies aber keine darüber hinausgehenden Besonderheiten auf.
„Und mit dieser Krawatte hat sich einer erhängt, oder was?“, warf Jessy ein. Sie erntete dafür einen verblüfften Blick des Professors. Buchanan hatte offenbar gar nicht mehr an sie gedacht, so vertieft war er schon die ganze Zeit über darin gewesen, seinem neuen, unbekannten, männlichen Gast die Wunder dieser Ausstellung näherzubringen. Entsprechend verhalten fiel nun auch seine Antwort aus.
„Nun, Jessy – ich hoffe, du hast unserem Gast hier damit nicht den Ratespaß verdorben! Es stimmt: Glaubhaften Berichten nach hat sich mit dieser Krawatte einer der berühmt-berüchtigsten Bürger von Khorinis erhängt. Sein Name war Valentino, und der Geschichte nach war er der größte Schürzenjäger der ganzen Hafenstadt. Dieser, nun, sagen wir: Lebenswandel, hat ihm freilich keinen Eintrag in die Chronik der Stadt verschafft, sodass sich die Nachforschungen rund um ihn und seine Krawatte durchaus kniffelig darstellten. Indes: Nach Anstellen dieser Nachforschungen können die geschilderten Umstände als belegt gelten. Überflüssig zu erwähnen, dass ich lieber Valentino selbst beziehungsweise seinen Leichnam hier gehabt hätte, womöglich noch mit der Krawatte am letalen Platze … aber gewiss ist dieses Utensil mitsamt seiner Geschichte auch so einen Blick wert und bereichert diese Ausstellung – nicht wahr?“
Jessy wollte das pflichtgemäße Nicken lieber Roland überlassen, der regte sich aber überhaupt nicht. Professor Buchanans Blick wurde daraufhin Spiegel seiner heruntergeschluckten Enttäuschung. Rasch führte er sie zum nächsten Exponat.
„Dies hier ist ein besonders interessantes Stück“, sagte der Professor, und wies auf einen eher kleinen, auf Stelzen stehenden Schaukasten, in dem eine beschriftete Brosche aufbewahrt wurde. Auf ihr prangten die Buchstaben OZ. Jessy sagte das nichts.
„Hier sind wohl alle Stücke besonders interessant“, merkte Roland beiläufig an.
„Gewiss, gewiss!“, griff Professor Buchanan den Faden ganz begeistert auf. „Und diese Brosche hier, die hat eine ganz besondere, vielleicht auch ein bisschen vertrackte Geschichte zu erzählen. Das Ergebnis können Sie sich ja wahrscheinlich schon denken: Die Geschichte endet mit einem Tod. Doch der Weg dahin … kompliziert! Übergeben – oder besser: übersandt – wurde mir diese Brosche vom Kollegen Hüffner aus Vengard, seines Zeichens mittlerweile emeritierter Professor für Myrtanistik. Nun hat die Brosche an sich nur wenig Bezug zur Myrtanistik als solcher, wohl aber zu einer Studentin Professor Hüffners, die einige Zeit lang für die Ostmyrtanische Zeitung – mittlerweile längst eingestellt – gearbeitet hatte. Daher auch das Kürzel auf dieser Brosche. Ich weiß nun nicht genau, wie Professor Hüffner letztlich an diese Brosche gelangt ist oder die Brosche zu ihm, möglicherweise war es ein Geschenk seiner Studentin, ich weiß es nicht. Professor Hüffner hat die genaueren Umstände in seinem seinerzeitigen Schreiben nicht erwähnt und hatte auch nicht den Eindruck gemacht, für Rückfragen bezüglich dieses Themenkomplexes zur Verfügung zu stehen. Wie dem auch sei, in seinem Begleitschreiben schilderte er den Werdegang seiner Studentin. Als Jungreporterin muss sie wohl rasant Karriere bei der Ostmyrtanischen Zeitung gemacht haben. Sie wurde schließlich sogar zu Gesprächen mit Angehörigen diverser Hofstaaten, mithin auch ausländischer Regenten, geschickt. Leider sorgte eine dieser Begegnungen, so deutete Professor Hüffner es in seinem Schreiben an, für den entscheidenden Knick in der Karriere der besagten Studentin. Ein geplantes Gespräch mit einem ausländischen Prinzen namens Selindan, dessen genauere Staatsangehörigkeit und detaillierte Umtriebe anscheinend nicht mehr recherchierbar und damit Stand heute unbekannt sind, soll nämlich ganz und gar nicht in ihrem Sinne und vor allem nicht im Sinne der Herausgeber der Ostmyrtanischen Zeitung verlaufen sein. Daraufhin wurde der doch so begabten Journalistin das Ressort entzogen. Fortan, so erzählt es Professor Hüffner, musste seine Studentin im Auftrage der Ostmyrtanischen Zeitung über all jenen Klatsch und Tratsch berichten, den sie vorher so verabscheut hatte. Versetzen Sie sich mal in ihre Lage: Sie reisen erst zu Kronprinzen, Regenten, ja möglicherweise gar Königen, gehen in erlauchtesten Kreisen ein und aus und schreiben zuweilen auch politisch hochbrisante Reportagen – und dann müssen Sie, nehmen wir mal an, über die unbedeutenden Liebeleien eines, sagen wir mal, soeben erwähnten Schürzenjägers wie Valentino schreiben. Über sein Leben, nicht über seinen Tod! Jeden Tag! Wie würden Sie sich da fühlen?“
Jessy fühlte sich nicht angesprochen und Roland schwieg zunächst eine Weile. „Weiß nicht …?“, sagte er dann auf den bohrenden Blick des Professors hin.
„Ja, Sie würden da ins Grübeln kommen, nicht wahr?“, nahm Professor Buchanan die Worte dankbar auf. „Zu Recht, und besagter Studentin erging es ebenso. Sie hatte nun, Professor Hüffners Einschätzungen nach, ihr ganzes Leben in ihren Beruf gelegt, und nun hatte eben dieser Beruf eine Wendung genommen, die von so ziemlich allen denkbaren Journalistinnen ihr selbst am allerwenigsten zupass kam. Und dann kam das, was kommen musste: All das Gegrübel über ihr eigenes Schicksal, welches aus ihrer Sicht offenbar einem gänzlich gescheiterten Leben gleichkam, endete im Tod – im Tod durch Eigenverschulden, um es mal so zu sagen. Die Geschichte ist so tragisch, dass mein wissenschaftliches Interesse an diesem Ableben beinahe schon gedämpft ist, muss ich zugeben. Da Professor Hüffner nun aber so selbstlos war, sich zugunsten dieses meinen Instituts von einem so schicksalsbeschlagenen Memorabilium zu trennen – nun, da muss ich mich diesem auch in aller Professionalität widmen und es hier ausstellen. Und die Lehre aus dieser gesamten Geschichte, die möge ein jeder für sich selbst ziehen.“
Professor Buchanan schenkte ihnen ein gewichtiges Nicken in der nun anschwellenden Stille, und führte sie dann weiter.
Nun war es ein kleiner Kubus aus Glas, wiederum auf einem Sockel, der das Exponat umschloss, und diesmal war jenes Exponat eine Schreibfeder, eine goldene Schreibfeder. Für Jessy war es Kitsch. Für Professor Buchanan dagegen, das sah sie ihm an, war es ein historisches Artefakt von unschätzbarem Wert. Aber es blieb eben doch nur eine Goldfeder, deren Goldlack zudem schon an einigen Stellen abgeblättert war und so ein eher trauriges Bild hinterließ.
„Dieses Schreibutensil habe ich aus einem Nachlass erworben, der ein wahres Sammelsurium aus allerlei Krimskrams darstellte. Ich weiß noch genau, wie ich vom Glanz der Feder in den Bann gezogen wurde, weshalb ich sie einfach erstand – und das gar nicht mal so billig, wenn Sie mir diese Bemerkung erlauben. Zwei Historikerkollegen bestätigten mir dann aber später unabhängig voneinander, dass ich da womöglich einen spektakulären Fang gemacht hatte. Nur wenige berühmte Autoren waren bekannt dafür, solche Goldfedern zu benutzen, und angesichts des geschätzten Alters dieser Feder, so sagten sie mir beide, komme nur ein Autor ernstlich in Betracht. Ein Mann namens Saturas, der seiner Zeit einige Berühmtheit genossen haben muss, dessen Wirken und Werk dann aber seltsamerweise über die Jahre immer mehr verschattet wurde. Unzählige Bücher soll er geschrieben haben, manche, so vermutet man, im Stile eines Mansell Blau, aber profunder, wirkmächtiger! Leider ist von diesen Büchern, so scheint es, nirgendwo mehr eine Kopie aufzutreiben. Nur wenige der alten Buchhandlungen von damals haben bis heute überlebt, und von den wenigen, die noch Bestand haben, hatte keine mit den Werken Saturas’ jemals zu tun. Man vermutet, dass sich irgendetwas ereignet haben muss, das Saturas’ Schriften oder vielleicht auch ihn selbst von einen Tag auf den anderen in Ungnade fallen ließ, aber man kann sich nicht sicher sein. Und ohne einen Blick auf sein verschollenes Werk zu werfen, bleibt alles bloße Spekulation.“
„Nun sagen Sie schon, Professor“, drängelte Jessy ein wenig, ohne sich das Drängeln jedoch anmerken zu lassen, „warum haben Sie dieses Stück dann in Ihre Ausstellung aufgenommen?“
„Ah, Jessy, in dir ist wirklich ein kritischer Geist herangereift“, lobte Professor Buchanan. „Nun, deine Nachfrage ist berechtigt und ich will sie dir beantworten: Es geht mir um die Auslöschung, die Auslöschung als solche. Der Untergang, der abstrahierte Tod. Nun ist es zwar eine sehr sichere Annahme, davon auszugehen, dass Saturas selbst auch bereits verstorben ist. Doch die Auslöschung seines gesamten Werks, das spurlose Verschwinden von dieser Welt – zumindest, bis doch einmal ein Fund auftaucht – ja, das ist es, was mich interessiert und was die Feder so wertvoll für diese Ausstellung macht. Sie ist möglicherweise das einzige, was von Saturas übrig geblieben ist.“
Professor Buchanan endete in einem versonnenen Schweigen und bedachte die Feder hinter dem Glaskasten dann mit einem noch viel versonneneren Blick.
„Ja, bei all diesen Zeugnissen der Vergangenheit fühlt man sich beinahe wie in einer Zeitmaschine … wobei, das mit der Zeitmaschine, das streiche ich lieber wieder, das passt doch nicht so ganz … aber lasst uns weitergehen!“
Jessy hatte zwar wenig Lust, noch weiter zu gehen, weil sie diese Ausstellung mehr und mehr ermüdend fand, aber als sie sah, dass das nächste – und offenbar auch letzte! - Ausstellungsstück in dieser Reihe mal nicht unter einer Glasvitrine, einem Glasschaukasten, einem Glaskubus oder einem Glaswasauchimmer präsentiert wurde, sondern, abgestützt von Streben an der Rückseite, mitten im Raum stand, wurde sie wieder ein wenig neugierig, wenn auch auf eine eher träge Art und Weise.
„Diese Holzwand hier war mal Teil eines Beichtstuhls, eines Beichtstuhls der Innoskirche, um genau zu sein. Bemerkenswert sind die Inschriften und Zeichnungen, die der langjährige damalige Beichtvater, der Feuermagier Daron, mit seinen magischen Kräften hineinbrannte – aus Langeweile, da ihm sein Dienst als Beichtvater über die Jahre schal und ermüdend geworden war. Am besten erhalten ist sicherlich das Bildnis – oder eher: die Kritzelei – von Mann und Frau in eindeutiger Pose. Die daneben eingebrannte Schlange scheint zur Szene zu gehören, über ihre Bedeutung indes ist nur wenig bekannt.“
„Und was hat das nun im Zusammenhang mit der Ausstellung hier zu suchen?“, fragte Roland. „Die ganze Wand, meine ich. Sie wird ja nicht auf jemanden draufgefallen sein und ihn erschlagen haben.“
„Nun“, dozierte Professor Buchanan nicht im Geringsten verunsichert, „die Wand dieses Beichtstuhls ist die einzige Hinterlassenschaft von Daron, die wir besitzen, und womöglich auch unabhängig von diesem Fakt die eindrucksvollste. An der Person von Daron selbst wiederum ist interessant, wie er Gerüchten zufolge zu Tode gekommen sein soll. Angeblich nämlich war er von einem Erzdämon besessen. Die genaueren Umstände seines Ablebens sind ungeklärt, aber es spricht einiges dafür, dass diese Besessenheit – sollte es sie denn gegeben haben – mit seinem Tod zu tun hatte.“
Trotz des mehr und mehr einlullenden Vortragsstils des Professors war Jessy nun auf einmal wieder wach geworden. Roland kam ihr zuvor.
„Von einem Erzdämon besessen, sagten Sie?“
„Das sage nicht ich, das sagen Historiker. Ich kann es nur weitergeben. Ihnen erscheint es durchaus wahrscheinlich. Vielleicht nicht überwiegend wahrscheinlich, aber immerhin wahrscheinlich, ja. Wenn Sie dagegen nach meiner bescheidenen Meinung fragen …“
„Ja?“
„Ich halte es für nahezu ausgeschlossen, dass es so etwas wie Erzdämonen überhaupt gibt, geschweige denn, dass Daron von einem solchen besessen war. Wissen Sie, meine langjährigen Forschungen haben mir ein nicht nur breites, sondern auch tiefes Bild von der weltzerstörenden Allmacht des Todes geliefert. Ich glaube nicht, dass neben ihm und den Göttern noch derartige Mischwesen wie Erzdämonen, ja überhaupt Dämonen, Platz haben. Und speziell in der causa Daron gibt es noch viele weitere, auch weitreichendere Erklärungsansätze für sein Ableben, mit denen ich Sie hier aber natürlich nicht langweilen will. Gleichwohl bin ich nun einmal der Wissenschaft verpflichtet, und es ist mir nicht nur eine Pflicht, sondern auch persönliches Anliegen, auch diesen Teil der Forschung hier abzubilden. Denn selbst wenn ich persönlich den Wahrheitsgehalt der besagten Theorien anzweifle, so wäre es doch durchaus spektakulär, träfen sie tatsächlich zu, und ein großer Verlust, hätte ich dann nicht dieses wertvolle Stück in dieser Ausstellung!“
Jessy lächelte Roland zu. Das war’s dann wohl. Wenn nicht einmal Professor Buchanan an so eine Geschichte glaubte, dann war sie wirklich … nunja, tot.
Roland ignorierte den Blick und wandte sich zum Professor. „Was ist, wenn ich Ihnen sage, dass es diesen Erzdämon wirklich gibt?“
„Nun, ich würde Sie fragen, wie Sie darauf kommen“, antwortete Professor Buchanan milde interessiert. Er hatte ganz offensichtlich nicht die leiseste Vorahnung davon, was nun auf ihn zukommen würde.
„Dann würde ich Ihnen antworten: Jahrelange Jagd. Sie würden es vielleicht Forschung nennen.“
Jessy lief ein Schauer über den Rücken. Nun wurde es ernst, das spürte man eindeutig. Und kalt wurde es auch, in diesem Gemäuer, so fernab von der Sonne.
„Sprechen wir nun nicht mehr rein hypothetisch?“, fragte Professor Buchanan mit hochgezogenen Augenbrauen.
„Ich habe von Anfang an nicht hypothetisch gesprochen.“
VI. Na wer wohl. Jetzt aber mal so richtig von Angesicht zu Angesicht hier!
„Wenn das alles, was Sie da sagen, wahr ist, dann … dann stehen wir vor einer wissenschaftlichen Revolution!“
„Es ist wahr. Ich lüge nur, wenn es sein muss. Und da die Sachen wahr sind, muss es nicht sein.“
Jessy seufzte leise in sich hinein. Sie war aufgestanden, aus diesem schweren, dunklen Sessel, einer von vieren, der im vollgestellten und verrümpelten Büro des Professors stand. Sie war immer mehr ins weiche Leder eingesunken, während die beiden Männer sich gegenseitig die Welt erklärt hatten, und war deshalb irgendwann aufgestanden, um sich nicht dem Schlaf ergeben zu müssen. Sie stand gerade vor einer Karte, deren Landschaften sie nicht erkennen konnte und die fleckenweise mit kräftigem Schwarz übermalt war. Wenn sie Professor Buchanan danach fragen würde, würde er ihr vermutlich erklären, dass die schwarzen Flecken die Todeszonen seien. Wenn sie sich selbst fragte, dann war ihr relativ klar, dass man eine handelsübliche Landkarte, ein großes Tintenfass und ein kleines Kind zu lange in einem Raum alleine gelassen hatte.
„Und Sie glauben wirklich, dass sich der Erzdämon, dieser … Krushak sagen Sie, ja? Dass dieser Erzdämon sich hier in meinem Institut einen neuen Wirt gesucht hat?“
Jessy drehte sich erschaudernd zu den beiden Männern um. Roland, den Rücken zu ihr abgewandt, saß fest in seinem Sessel, in sich ruhend, gleichwohl eine Zielstrebigkeit ausstrahlend, die Jessy fast ganz bange machte. Professor Buchanan auf der gegenüberliegenden Seite schien deutlich angespannter und aufgeregter zu sein. Wie er die Ellenbogen auf seinem Schreibtisch aufstützte und sich begierig nach vorne beugte, sah man ihm seine achtzig Jahre kaum noch an, er hatte das Gesicht eines Achtundsiebzigjährigen bekommen.
„Der Verdacht erhärtet sich mehr und mehr. Wenn Ihr Keller nur halb so voll ist, wie Sie behaupten, dann wird Krushak dort seinen neuen Wirt gefunden haben. Selbst wenn Sie keinen einzigen Untoten dort herumspuken haben: Krushak wird auch noch das letzte Funken an Leben in einem der Leiber aufspüren und in ihn hineinfahren.“
Jessy zuckte kurz zusammen, aber keiner der beiden Männer hatte das mitbekommen. Sie wandte sich wieder der Wand zu, dabei allerdings von der Karte ab, hin zu zwei gekreuzten Säbeln an einem aufgehängten Holzbrett.
„Gut“, sagte Professor Buchanan nun auf einmal sehr geschäftsmäßig. „Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann schwebt der Erzdämon nach Vernichtung seines Wirts einige Zeit im Weltäther herum, auf der Suche nach einem neuen Wesen, dessen er sich bemächtigen kann. An dieser Stelle kommt mein Urnenglas ins Spiel.“
Jessy hörte, wie eine Schublade aufgezogen wurde, und drehte sich um. Ein bisschen neugierig war sie nun doch wieder geworden. Als Professor Buchanan aber dann bloß ein Einmachglas hervorzog, war sie direkt wieder enttäuscht. Sie hatte keine genaue Vorstellung davon gehabt, was denn ein Urnenglas sein sollte, aber das hier war dann nun doch so unterwältigend, dass sich Jessy lieber wieder den Säbeln zuwandte. Mit Säbeln konnte man wenigstens Einiges anstellen, mit alten Einmachgläsern dagegen eher weniger.
„Ich habe es von einem Kollegen bekommen, der darin … ach, lassen wir das, ich will Sie damit nicht langweilen. Es ist jedenfalls luftdicht. Vermutlich nicht nur luftdicht. Und es ist magisch behandelt worden. Vielleicht bekommen Sie es hin, den Dämon nach seiner Freisetzung dort hineinzuziehen. Tote Seelen streben nämlich hin zur Magie, wissen Sie. Warum sollten es Dämonen nicht auch tun?“
„Klingt plausibel. Dann lassen Sie uns runter gehen.“
„Oh, ich …“ Jessy hörte an Professor Buchanans Stimme, dass er auf einmal einen gewaltigen Kloß im Hals haben musste. „Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Sehen Sie, nach allem, was Sie mir erzählt haben, erscheint es mir ungünstig, wenn ein Mensch meines Alters dort hinunter geht.“
Jessy lauschte dem Gespräch mit halben Ohr und fuhr mit dem Zeigefinger über die Spitze des Säbels – die dann doch ein wenig spitzer und schärfer war als gedacht. Jessy unterdrückte einen Laut und zog hastig ihren Finger zurück, aber es war schon zu spät: Blut rann aus der gar nicht mal so kleinen Wunde, die auch nach mehrmaligem Ablecken nicht versiegte.
„Der Erzdämon könnte, einmal freigesetzt, mich selbst verwechseln mit einem … nunja, und dann bin ich der Wirt und kann … Ihnen nicht mehr helfen. Das sollte man berücksichtigen!“
„Verstehe, Sie haben nicht den Mumm. Jessy, du kommst mit mir mit.“
Hastig verschränkte Jessy ihre Hände hinter ihrem Rücken. Die Peinlichkeit, darauf hingewiesen zu werden oder gar danach gefragt zu werden, warum sie denn blutete, wollte sie sich ersparen.
„Aber ob das nun eine gute Idee ist …“, wandte Professor Buchanan ein, der nun zusammen mit Roland aufgestanden war. „Es könnte immerhin gefährlich werden.“
„Eben“, meinte Roland. „Ich brauche jemanden, der mich erledigt, sollte ich selbst besessen werden.“ Er raffte seinen Gürtel, die Silberklinge klimperte. „Kommst du, Jessy?“
VII. Roland. Damit die männlichen Leser sich nicht diskriminiert fühlen.
Sie hatten nur wenige Schritte die steinerne Treppe herab getan, da fuhr Roland bereits der Geruch des Todes in die Nase, und mit jeder Stufe wurde er dichter und dichter, sodass man sich wundern musste, dass die mitgeführte Fackel vom Todesatem nicht erstickt wurde. Doch sie brannte weiter, erhellte den feuchten und bemoosten Stein der Stufen und Wände, entzündete dann und wann ein paar verlassene Spinnweben und ließ eine tröstliche, wenngleich schwache Wärme erstrahlen. Das Mädchen, Jessy, ging dicht hinter ihm und hatte mehrfach das Angebot, zur Sicherheit seine Hand zu nehmen, ausgeschlagen. Das imponierte ihm fast ein wenig. Selber gehen oder runterfallen.
Als sie die Treppe verließen und in einem langen Kellergang ankamen, der offenbar ein ausgedienter Arm einer Kanalisation war, tanzten winzige Staubkörnchen im Licht. War das schon der Staub der Toten? Roland wusste es nicht. Von wie vielen Leichen hatte Professor Buchanan gesprochen, die hier unten gelagert sein sollen? Einhundert? Zweihundert? Wenn sie die alle überprüfen mussten, dann würden das ein langer Tag und eine lange Nacht werden. Es sei denn …
Ein Hauch kam aus der Ferne, keine Luftbewegung, aber ein Geräusch. Wie ein Stöhnen, dem noch vor dem ersten Aufatmen die Luft ausging. Roland reagierte und packte Jessy an der Hand. Er musste sie schützen.
„Hey, was machst du?“
„Ich muss dich beschützen! Aber deine Finger sind so … Jessy, streck deine Hände aus!“
Sie tat es zunächst nur widerwillig, als er mit der Fackel herankam, aber noch bevor er zu ihr sprach, wie zu einem verletzten Tier – ein alter Trick – tat sie, wie geheißen. Im Licht der Fackel erkannte Roland Blut auf ihren Händen, nicht viel, aber genug, um direkt wieder wegschauen zu müssen.
„Verdammt! Wie ist das passiert? Weißt du nicht, dass das Blut die Untoten anlockt?“
Jessy sagte nichts und war wunderschön. Ein Schlurfen ertönte aus der Dunkelheit des Ganges. Roland ergriff nicht noch einmal Jessys Hand, aber er stellt sich vor sie. Er musste sich um sie kümmern, sie beschützen, sich selbst beschützen.
Dann kam er aus dem Dunkel hervor. Das Schlurfen kam von einem zerschmetterten Bein, das er wie einen unwilligen Hund hinter sich her zog. Ein Stück des Knochens ragte unterhalb des Knies heraus, das umliegende Fleisch glänzte purpurn, nein, rosa. Ein Laie mochte daraus schließen, dass der übrige Knochen bald splittern und dem Wesen seiner Bewegungsfähigkeit berauben würde, doch Roland war kein Laie. Er hatte genug Untote erlebt, um zu wissen, dass sie immer einen Weg vorwärts fänden. Vorwärts, um dich zu kriegen. Die Brust des Zombies war eingefallen, ebenso seine Wangen und Augen. Er trug ein Hemd, das in Fetzen an seinem Gerippe hing, klebrig von Schmutz und trockenen Spritzern einer braunen Substanz, die Schlamm ähnelte, aber vermutlich Scheiße war. Unter dem Hemd wölbte sich nichts, die Brust blieb starr. Vielleicht war er es nicht, nicht der richtige. Aber er musste gehen. Ja, gehen. Für immer.
„Ha!“
Der Untote war seinen Reflexen nicht gewachsen. Im Bruchteil einer Sekunde hatte Roland seine Klinge gezogen und sie dem Verwesenden in die Brust gejagt, wieder herausgezogen und dann mit einem zweiten Streich den Kopf von den Schultern geschlagen.
„Wer will der zweite sein?“, rief Roland dann mit donnernder Stimme. „Wer? Wer will der zweite sein?“
„Es ist doch nur -“
„Wer will der zweite sein?“
„Es ist doch nur einer!“
„Will denn niemand der zweite sein?“
„Roland, es -“
„WER WILL DER ZWEITE SEIN?!“
„ROLAND!“
Jessy hatte ihn am Arm gepackt und ließ nur zögerlich wieder los.
„Was ist?“
„Da war doch nur einer.“
„Ich rechne mit einem zweiten.“
„Ich nicht. Cassy und ich haben lange genug die Wälder nach Untoten durchstreift, um zu wissen …“
„Ich glaube nicht, dass man so etwas wissen kann. Man kann so etwas spüren. Durch die Erfahrung, die Erfahrung eines Jägers. Ich bin Jäger.“
Roland steckte seine Klinge wieder weg. Das Gute an Untoten war, dass sie beim Sterben nicht so viel bluteten – manche sogar gar nicht. Der rasche Tod des Zombies hieß aber auch: Krushak war nicht in ihn gefahren. Roland spürte seine Präsenz nicht. Noch nicht. Aber wenn er sie spüren würde, dann würde er bereit sein.
„Roland?“
„Ja?“
Jessy hatte sich nun mit dem Rücken an die dunkle Wand der Kanalisation gelehnt und war in eine sitzende Pose herabgesunken, die Feuchtigkeit ließ ihr Kleid am dunklen Stein kleben. Ihre Beine hatte sie mit den Armen umschlungen. Als sie aufblickte, konnte Roland ihre Augen im Dämmerlicht der Fackel fast ein bisschen leuchten sehen.
„Ich muss dich etwas fragen“, sagte Jessy dann nach einer Weile.
„Dann mach.“
„Also“, begann Jessy von Neuem und holte tief Luft. „Wir sitzen hier jetzt erst einmal in dieser stinkenden Kanalisation fest und haben wahrscheinlich noch einige Stunden, wenn nicht gar Tage vor uns, auf der Suche nach diesem vermaledeiten Erzdämon oder seinem Wirt oder was weiß ich. Es ist dunkel, dreckig und glitschig, ich bin müde, wir und insbesondere ich haben uns länger nicht gewaschen und wir sind drauf und dran, nicht nur unser beider, sondern auch das Ende von ganz Khorinis zu erleben – zumindest das Ende des pollenfreien Khorinis. Ich bin außerdem immer noch traumatisiert von diesem sich dahinziehenden Blockflötenkonzert und den fleischhungrigen Fischmenschengluckerzombies, wobei letztere jetzt zwar nur meine Fantasie sind, aber ja trotzdem doch einiges an Eindruck hinterlassen haben. Und zu allem Überdruss habe ich mich glaube ich gerade in Riesenrattenscheiße gesetzt. Deshalb frage ich dich: Willst du mit mir schlafen? Hier und jetzt?“
Roland ließ die Zigarette fallen, die er sich gerade im Dunkeln gedreht hatte. „Klar“, sagte er dann.
Jetzt leuchteten Jessys Augen tatsächlich. „Ehrlich?“, hakte sie nach. „Findest du wirklich, wir sollten …“
„Absolut“, bestätigte Roland. „Ich halte das für den besten Moment dafür.“
„Ja, dann … kümmer dich mal um mich.“
Die Worte hallten in seinem Verstand wie Steine, die in einen Brunnen geworfen wurden, während er hastig seine Hose aufknöpfte.
Keiner von ihnen, weder Roland noch Jessy, sah die schwarze Gestalt, die im Schatten der Kanalisation kauerte und sie geduldig beobachtete. Professor Buchanan rieb sich die schweißnassen Hände am Leibrock. Sein Plan war voll aufgegangen. Wieder einmal. Krushak würde zufrieden sein. Ja, zufrieden. Nur was wäre, wenn er noch hungrig wäre?
Geändert von John Irenicus (16.08.2017 um 21:22 Uhr)
 Berechtigungen
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
|







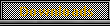



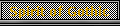










 World of Players
World of Players
 [Story]Botanischer Garten München-Nymphenburg
[Story]Botanischer Garten München-Nymphenburg









