-
 [Story]Rotwein
[Story]Rotwein
Rotwein
Vorwort
Veni, vidi, vici.
Ich bin wieder da. Nach einer mehr oder weniger langen Pause meldet sich der unglaubliche, ungeschlagene und allseits geliebte MisterMeister zurück. Dazu bewogen haben mich Laidoridas, Cyco und El Toro, indem sie in meinen Geburtstagsthread posteten. Irgendwie hat mir das das Gefühl gegeben, dass meine Storys heute noch von manchen gelesen und unter Umständen sogar noch mittelmäßig bis gut gefunden werden.
Nun denn, ich will mich nicht länger mit Geschwafel aufhalten. Nur noch soviel, dass der, der auf das Bild klickt, zur PDF-Version weitergeleitet wird. Man muss ja mit der Zeit gehen.
Hiermit schreite ich zur Tat.
...
Achso, der Titel hat nichts mit Laidoridas' „Eintopf“ zu tun. Nicht, dass ihr denkt, ich würde abschauen. Diese Zeiten sind vorbei – hoffe ich.
Viel Spaß.
1
Leise raschelte Laub, als die letzten Männer verschwanden. Sie glitten in die eigens dafür links und rechts neben der Straße angelegten Gräben, welche vom Weg aus nicht zu sehen waren. Der Wald war wieder still. Nur manchmal störte der Ruf eines Vogels diese Ruhe. Doch ebendiese war trügerisch. Denn die Männer, die sich mit dem Rücken gegen die Grabenwände pressten, kontrollierten ein letztes mal ihre Waffen:
scharfe Dolche wurden mit Ledertüchern poliert, Schwerter bereitgelegt und die Bogensehnen gewachst. In der Ferne konnte man Hufgetrappel hören, welches sich näherte. Bald schon ritt eine Schar Bewaffneter einher, gefolgt von einfachen Menschen.
Diener, Bauern, Mägde und Arbeiter. Sie alle trugen ein kleines Bündel auf ihrem Rücken oder zogen Handkarren, welche auf gepflasterten Straßen zwar gut und schön waren, auf einfacheren Wegen aber ständig festzustecken pflegten.
Die Kleider der Leute wurden langsam edler. Adlige folgten, die meisten beritten. Einer stach besonders heraus. Er trug schreiend bunte Kleidung, niedrige Wildlederstiefel, feinste Handschuhe und ritt einen wertvollen Hengst. An seiner Seite baumelte kein Schwert, sondern ein winziger Dolch. Er besaß weiße Zähne, reine Haut und gezupfte Augenbrauen. Und über seine Schultern ergossen sich blonde Locken.
Er rümpfte in regelmäßigen Abständen die Nase. Mal über ein totes Tier, dann über ihre Umgebung, über einfache Menschen und über das meiste, was ihm unter die Augen kam.
Wenn jemand an ihm vorbei ritt, strich er das Wappen glatt, welches ihn als ehrwürdigen Adligen auswies.
Am Ende des Zuges ritt wieder eine handvoll Bewaffnete.
Sie alle waren viel zu beschäftigt mit sich selbst und ihrem Gepäck, als dass sie die Gefahr bemerkt hätten, die gut getarnt neben ihnen lauerte.
Als sie schließlich einen kleinen, dürren Baum erreichten, erfasste den Tross Unruhe. Einer der Bewaffneten stieg von seinem Pferd, um den grausigen Fund zu betrachten:
Ein junger Mann war dort an dem Baum aufgeknüpft.
Der Soldat durchtrennte das Seil, mit welchem der Leib am Ast befestigt war.
Die Nachricht vom toten Körper arbeitete sich schnell durch die Menschenmenge, und jemand schrie gedämpft auf. Überall wurde leise getuschelt. Diese Aufregung war das Signal. Von niemandem beachtet erhoben sich die Männer ein wenig, griffen nach ihren Bögen und suchten sich ihre Ziele aus. Fast gleichzeitig surrten die Pfeile durch die Luft, durchdrangen Kettenhemde und Lederwämse und gruben sich ins Fleisch der Opfer. Schreie wurden laut, mehrere Bewaffnete fielen getroffen zu Boden, die anderen zogen ihre Schwerter. Schnell, aber dennoch sorgfältig, legten die Wegelagerer ihre Bögen beiseite, zogen Schwerter und verließen ihre Deckung und ein grauenvolles Schlachten begann.
Zur gleichen Zeit hielt ein fein gewandeter Mann sein Weinglas gegen das Licht einer Kerze. Das Licht, welches durch das Glas schien, ließ sein Gesicht rot erscheinen. Schließlich trank er einen Schluck.
„Inzwischen kümmern sich meine Leute um Ihr... Problem.“ sagte er mit samtweicher Stimme.
Sein Kunde nickte, und stellte ihm – leicht zitternd – einen Beutel auf den Tisch. Eine Hand wurde ausgestreckt, der Beutel gegriffen und geöffnet. Der Mann, der den Beutel entgegengenommen hatte, kippte dessen Inhalt auf seine Papiere.
Ein goldener Strom ergoss sich über die Unterlagen.
„Sehr schön.“
Der Wald lag wieder still da. Niedergemachte Männer säumten die Erde, gelegentlich auch ein Kind oder eine Frau. Dort, wo die Leichen lagen hatte sich die lockere Erde in bräunlichen Matsch verwandelt. Zwischen diesen Leibern war das „Problem“ des Kunden. Es trug eine nun blutbefleckte und zerissene bunte Kleidung. Die blonden Locken waren schlammbesudelt und in seinen Augen war kein Leben mehr zu entdecken. Starr und gebrochen blickten sie zum Himmel empor. Es war absolut still. Die Überlebenden waren geflohen. Die Attentäter hatten ihre Waffen eingesammelt und waren gegangen. Wer noch hier war, weilte nicht mehr unter den Lebenden.
Etwas raschelte. Es war der erste Rabe.
Geändert von MiMo (30.03.2017 um 21:21 Uhr)
-
Dezent klopfte es an der Tür. Der mit einem schneeweißen, goldbesticken Gewand bekleidete Mann ließ sich davon nicht beirren. Das Klopfen wurde lauter, doch der Mann zeigte keine Reaktion. Seine Feder glitt kratzend über das Papier, das vor ihm lag. Schließlich unterschrieb er schwungvoll und las sich seinen Entwurf durch. Hier und da war ein Wort durchgestrichen, Tintenkleckse säumten den Brief. Er würde ihn später noch einmal ordentlich abschreiben. Als von draußen ein gedämpftes „Mein Herr!“ an seine Ohren drang, legte er den Zettel beiseite, wischte den Federkiel an einem Tuch trocken und öffnete die Tür. Vor ihm stand ein Diener. Er versuchte, eine unbewegte Miene zu zeigen, was ihm nicht ganz gelang. Hin und wieder blitzte in seinen Augen Entsetzen auf.
„Sprich!“ forderte der weiß gekleidete Mann den Diener auf.
„Einige Frauen stehen unten. Sie brachten verletze Kinder und tote Männer.“
Der Edle, der noch immer in der Tür stand, und den anderen nicht hereinbat, gähnte gelangweilt.
„Und?“
„Sie sagten, sie seien überfallen worden.“
„Das ist nicht mein Problem.“
Der Diener blickte ihn ungläubig an.
„Es wurden viele getötet!“
„Nur Bauern. Knechte.“
Er erntete einen entsetzten Blick.
„Herr, Euer Sohn... Er ist auch tot.“ brachte der Diener unter zusammengepressten Zähnen hervor. Kalter Angstschweiß lief ihm den Rücken herunter.
Der Weißgekleidete zuckte zusammen. Dann stieß er den Diener beiseite, und lief den Gang entlang. Hastig rannte er die Treppe hinunter, an Wachen und Bediensteten vorbei, die ihren Burgherren verdattert ansahen. Schließlich erreichte er eine große Halle, in der sich viele Menschen tummelten. In verschmutzten Kleidern, manche auch blutbesudelt. Überall standen Bahren herum, auf denen verdeckte Leiber lagen.
Eine Hand packte ihn am Arm. Es war ein schmächtiges Mädchen.
„Ihr seid da, Innos sei Lob!“
Das war ein Bauernmädchen. Gewürm. Wahrscheinlich eine Dorfschlampe. Ein dreckiges Wesen. Und sein Sohn war fort. Sein Sohn!
Er hob die beringte Hand und schlug dem Mädchen ins Gesicht. Der Ring riss ihre dreckige Haut auf und Blut sprudelte hervor. Sie schrie auf.
„Mein Sohn!“ brüllte der Mann und schlug noch einmal zu.
„Wo ist mein Sohn?“ Das Mädchen taumelte zurück und sackte zusammen. Wimmernd ließ sie die Tritte des Edlen über sich ergehen.
Die anderen Menschen sahen zu. Geschockt. Entsetzt. Endlich schien der Burgherr sich beruhigt zu haben. Angewidert blickte er auf das Mädchen herab, das bewusstlos vor ihm lag und aus Mund, Nase und verschiedenen Platzwunden blutete.
Der Übeltäter packte einen Wachmann, der die Szenerie kalt verfolgt hatte, am Arm.
„Wo haben sie meinen Sohn hingebracht?“
Unter seiner Kettenhaube schluckte die Wache.
„Sie haben ihn nicht mitgebracht, Herr.“
Mit offenem Mund starrte der Burgherr ihn an. Seine Atmung beschleunigte sich und seine Hand krallte sich in den Arm des Wachmanns. Doch es folgte kein Wutausbruch wie bei dem unglücklichen Mädchen.
Der weiße Mantel flatterte, als er die Halle verließ. Scheppernd fiel die Tür ins Schloss. Kurz danach wachte das Mädchen auf, und wurde von den anderen versorgt.
Am Abend hockten die Leute immer noch in der großen Halle. Man hatte ein Feuer für sie entzündet, aber das war auch schon alles. Leise tuschelten sie, als die Tür sich öffnete. Ein Soldat trat herein, mit einem Stück Papier in der Hand, welches versiegelt war. Es wurde still. Schließlich erbrach der Soldat das Siegel, und las:
„Seine Wohlhochgeborenheit Graf Nattelsberg lässt verlauten, dass jeder einzelne der niederen Bauern und Knechte von... von seinen frevlerischen Händen befreit werden soll, mit denen er dem Sohn seiner Wohlhochgeborenheit die Hilfe versagte. Zudem sollen alljene, welche den Weg in Beliars Reich fanden ...“ Der Soldat schluckte.
„... sollen alljene, welche den Weg in Beliars Reich fanden, verbrannt und vernichtet werden, denn seine Wohlhochgeborenheit gedenkt nicht, solche Unreinheit und Verderbtheit auf heiligen Orten bestatten zu lassen.“
Dann verschwand der Soldat. Einen Moment später strömten andere in den Raum, packten die kreischenden Frauen und Kinder, und führten sie ab.
Als niemand mehr im Raum war, wurden die Bahren nach draußen getragen, um die Befehle des Edlen zu befolgen.
In den Verliesen der Burg wurden derweil Äxte erhitzt und geschärft.
Geändert von MisterMeister (17.12.2008 um 18:43 Uhr)
-
Während er sich die mit Nieten versehenen Handschuhe überzog, und seine Finger bewegte, um ihre Qualität zu prüfen, dachte Alvar nach. Einige Stunden zuvor hatte ein Dienstbote seine Gemächer betreten, um ihm den Fortschritt seiner Mission zu erläutern. Einer von dreien war tot. Blieben noch zwei Menschen, die es zu eliminieren galt. Ein Fuß glitt in den vorgesehenen Stiefel. Eng aber doch bequem schmiegte sich das Leder an seine Wade.
Eine der beiden Personen würde heute auf die Jagd gehen. Den Edelssohn würde nur ein kleines Gefolge begleiten. An einem kleinen Bach, an dem das Opfer zu rasten pflegte, würden sie zuschlagen; leise, schnell und vor allem effizient. Keiner durfte entkommen.
Alvar steckte einen Dolch in die versteckte Scheide, welche innerhalb seines Stiefels befestigt war. Während die Klinge sicher in der Scheide steckte, flogen seine Gedanken weiter. Wie viele Männer würde er mitnehmen? Drei mussten reichen. Dazu er selber, das machten vier. Am Abend würde er seinen Kunden über die Beseitigung des zweiten Zieles informieren, und wieder eine ganze Menge Gold einstreichen.
Er war fertig angekleidet und bewaffnet. In seinem rechten Stiefel steckte der Dolch, an seinem Gürtel baumelten ein langes Schwert in einer braunen Scheide, die sich kaum von seinen dunklen Hosen abhob und zwei Wurfäxte. In dem Futter des ebenfalls dunkel gehaltenen Wamses waren zwei Messer versteckt. Seine Gestalt wurde von einem braunen Umhang mit angenähter Gugel verhüllt. Zudem war seine untere Gesichtspartie mit einem Stück Stoff verbunden.
Er streckte sich noch einmal, dann drehte er sich um und ging zur Tür hinaus. Vor ihm erstreckte sich ein Korridor, an dessen Wänden Fackeln Licht spendeten. Schlicht gekleidete Leute, aber auch solche, die sich wie ein Papagei herausgeputzt hatten, gingen an ihm vorbei. Sie alle waren mit sichtbaren oder versteckten Klingen bewaffnet. Als sie ihn erblickten, blieben sie stehen, murmelten ein „Seid gegrüßt.“ und gingen weiter. Die Tunnel waren bestens durchdacht. In den Wänden waren kaum sichtbare Schlitze versteckt, hinter die man Bogen- oder Armbrustschützen postieren konnte. Scheinbar zufällig standen hie und da einige Kisten aufeinander, die – so schien es – mit Stoffen gefüllt waren. Doch in Wirklichkeit, so wusste Alvar, waren sie mit allerlei gefährlichen Pulvern und Flüssigkeiten gefüllt. Man brauchte sie nur mithilfe eines brennenden Pfeiles zu entzünden, und alles im Umkreis von mehreren Metern würde in ein Inferno verwandelt werden. An der Decke hingen vereinzelt Holzplatten, die den Felsen zu stützen schienen; tatsächlich war auf ihnen Geröll aufgeschichtet. Mit einem verborgenen Seilzug konnte man den Tod auf seine Feinde hinabregnen lassen. Zu den verborgenen Gängen, die parallel zu den mit Fallen gespickten Hauptwegen verliefen, gab es nur zwei stark bewachte Zugänge. Tag und Nacht waren Männer bereit, ihre Posten im Verborgenen zu besetzen. Schließlich erreichte er sein Ziel. Alvar stand in einem Raum, der mit Puppen, Zielscheiben und Waffen gefüllt war. Waffen klirrten, Pfeile surrten – dies war der Übungsraum, in dem die Männer fleißig übten, um besser zu werden. Seine Wahl fiel auf drei junge Kerle, die jeweils eine Puppe bearbeiteten, und sich dabei geschickt anstellten. Er nahm sie beiseite, erklärte ihnen, worum es ging, und ließ sie sich ausrüsten. Ein paar Minuten später kehrten sie alle eingekleidet wieder zurück, und gingen los. An die Spitze des Trosses setzte sich Alvar.
Sie durchschritten weitere Flure, bis sie zu einem großen Hauptraum kamen. Der Boden stieg an, und an der höchsten Stelle war ein großes Tor in der Wand. Die vier Männer schritten zu den Wachen, die sich vor dem Tor postiert hatten, und sich beim Anblick Alvars ihre rechte Hand auf die linke Schulter legten – der traditionelle Gruß. Alvar erwiderte ihn, und trat vor eine kleine Tür, durch die gerade ein Mann passte, wenn er sich bückte. Er musste drei schwere, metallbeschlagene Riegel zurückschieben, bis die ebenfalls mit Metall versehene Tür aufschwang. Seine Männer und er huschten schnell durch die Tür, welche von innen wieder geschlossen wurde. Hinter den sieben Auftragsmördern ragte eine moosbewachsene Felswand empor, der Eingang zu ihrem Schlupfwinkel. Nur wenn man ganz genau hinsah, und die Ranken und Pflanzen beiseite schob, konnte man erkennen, dass in den Fels das Tor und die Tür eingearbeitet waren.
Im Gegensatz zu der unterirdischen Höhle, die sie gerade verlassen hatten, fühlte man hier auf der Oberfläche den Sonnenschein auf seinem Gesicht und hörte Laub rascheln und Vögel zwitschern.
„Auf geht's!“ rief er gedämpft, dann setzten sie sich in Bewegung.
Ungefähr eine Stunde waren sie schweigend marschiert, bis sie ihren Zielort erreichten. Rot leuchtete die Sonne über dem Horizont und tauchte den plätschernden Bach und die Lichtung, auf der sie sich befanden in ein romantisches, idyllisch rot. Alvar schritt am Ufer entlang und untersuchte es. Schließlich winkte er seine Männer zu sich. Sie alle hatten mit Wachs beschichtete Leinenbeutel bei sich, die sie nun entfalteten. Dann sprangen sie in den Bach, der tiefer und breiter war, als er erschien. Das Wasser stand ihnen bis zur Hüfte. Nun zeigte sich das Talent und die unglaubliche Vorarbeit ihrer Agenten. In den Wänden des Baches waren Löcher geschaufelt, in die man kleine Holzfässer gestoßen hatte, die Öffnung in die Mitte des Baches zeigend. Die Männer krochen ohne zu zögern in die engen Fässer, die gerade genug Platz boten, dass man sie von oben nicht sehen konnte. Sie alle hielten den Kopf noch über Wasser. Der Leinenbeutel, der dank des Wachses wasserdicht war, enthielt Luft für einige Atemzüge. Schließlich hörten sie über das Plätschern hinweg Hufgetrappel. Als Alvar auch noch Zweige knacken hören konnte, tauchte er unter, und kroch ganz in das Fass hinein. Als seine Luft in den Lungen knapp wurde, atmetete er vorsichtig aus und hielt sich die Öffnung des Leinenbeutels, die er bis dahin mit der Hand verschlossen gehalten hatte, an den Mund. Dann nahm er einen kleinen Atemzug. Alle Geräusche drangen gedämpft durch das Wasser noch zu ihm. Als er endlich das Maul eines Pferdes in das Wasser eintauchen und trinken sah, stieß er sich aus dem Loch, und tauchte auf. Erschrocken wieherte das Pferd, stieg und rannte fort, ebenso seine schlecht ausgebildeten Artgenossen. Auch Alvars Männer tauchten nun auf. Sie warfen ihre Leinenbeutel auf die Uferböschung, zogen ihre Schwerter und sprangen an Land. Doch auch ihr Ziel und seine Garde waren nicht untätig gewesen. Sie hatten ihre Waffen gezogen, und bildeten einen menschlichen Schutzwall für den Edelssohn. Entschlossen ging Alvar einen der Gardisten an und landete einen Treffer. Seine Klinge fuhr durch den groben Lederwams und grub sich in die Schulter des Gardisten. Der Getroffene schrie, und ließ sein Schwert fallen. Ein zweiter Streich, und sein Kopf rollte über das saftige Gras. Die anderen Gardisten zogen den Kreis enger, und schlugen nun auch nach den Angreifern, wenn sie in Reichweite kamen. Einer von Alvars Männern sackte zu Boden, als eine Schwertspitze seine Brust durchstieß. Doch die Gardisten kamen langsam in Bedrängnis, einer nach dem anderen fiel. Die letzten Beiden beschlossen angesichts der Übermacht, ihr Heil in der Flucht zu suchen. Alvars Hand fuhr zum Gürtel, zog eine der Äxte hervor und schleuderte sie den Fliehenden hinterher. Schreiend brach der Getroffene zusammen, die Axt zwischen den Schulterblättern. Während zwei Männer Alvars den Edelssohn umkreisten, setzte Alvar dem anderen Gardisten nach. Er griff nach seiner zweiten Axt, holte aus und warf, doch die Waffe prallte an einer unsichtbaren Barriere ab.
„Scheiße!“ brüllte Alvar. Ein Magier! Er überlegte fieberhaft, was er tun sollte, als er hinter sich einen Schrei hörte. Ein zweiter seiner Männer lag röchelnd im Gras. Alvar verstieß gegen sein eigenes Gesetz und ließ den Magier laufen, um den Verwundeten zu ersetzen. Als sich ihre Klingen kreuzten, blickte er dem Edelssohn in die Augen. Sie waren nun in einen Zweikampf verwickelt, denn der letzte seiner Getreuen kümmerte sich um den röchelnden Mann, den der Edelssohn gerade niedergestreckt hatte. Mit überraschender Wucht prallte dessen Schwert nun gegen Alvars. Ihm rutschte die Klinge aus der Hand. Wohl einem albernen Ehrenkodex folgend, warf der Edelssohn sein Schwert ebenfalls in die Wiese. Damit jedoch hatte er einen Fehler begangen. Ehe er die Fäuste gehoben hatte, schlug Alvar zu. Die Nieten gruben sich in die Wange des anderen, und Blut quoll hervor. Mit dem Ellenbogen versetzte Alvar ihm nun einen Stoß gegen die Schläfe, sodass der Edelssohn betäubt zusammensackte. Noch bevor er hinfiel, fing Alvar ihn auf, zog seinen Dolch und schnitt ihm in einer fließenden Bewegung die Kehle durch. Blut schoss aus der Wunde. Alvar ließ die Leiche fallen. Schnell steckte er den Dolch wieder ein, sammelte sein Schwert und die beiden Äxte auf, und stieß seinen letzten Mann an. Der schüttelte den Kopf. Sie waren die letzten beiden Überlebenden. Sie luden sich ihre gefallenen Kameraden auf die Schultern, und liefen los.
Die Sonne war inzwischen untergegangen, und spendete kein Licht mehr – dennoch war die Lichtung immer noch in Rot getaucht.
Geändert von MisterMeister (21.01.2009 um 17:58 Uhr)
-
„Mica! Fang!“
Ein buntes Etwas schoss durch die Luft. Der Junge ging in die Knie, wartete den rechten Zeitpunkt ab, und sprang. In der Luft versuchte er, seinen Körper so weit wie möglich zu dehnen. Seine Hände streckte er aus, und bekam nicht mal einen Herzschlag später den Ball zu fassen. Dann tat die Schwerkraft ihr übriges, und Mica sank wieder auf den Boden. Die grün-gelb karierte Kugel aus Leder, die man den beiden Freunden zum Spielen gegeben hatte, war warm und roch nach Leder, Farbstoffen und etwas Schweiß. Dann war da noch ein Geruch, den Mica nicht kannte. Er hatte etwas geheimnisvolles an sich, das er mochte. Heimlich hob er den Ball zur Nase, und nahm einen tiefen Atemzug. Der fremde Geruch vermischte sich mit den anderen und ergab ein betörendes Aroma.
Glücklich lächelnd schwang Mica seinen Körper in die Höhe, und kam wieder auf die Füße. Er war jetzt zwölf Jahre alt, sein Leben steckte noch in den Kinderschuhen. Noch konnte er unbeschwert mit seinen Freunden herumtollen, doch er wusste, bald würde sein Vater einen Lehrmeister für ihn suchen, der ihn – seiner Abstammung angemessen – unterrichten würde. Wenn man beim Essen auf dieses Gesprächsthema kam, dann spielte Mica immer den freudigen Jüngling, der es kaum erwarten konnte, endlich die große, weite Welt zu entdecken. Doch in Wirklichkeit wurde ihm Angst und Bange, wenn er an den Tag dachte, an dem es so weit sein würde.
Manchmal stellte er sich vor, wie es wohl sein würde. Die strenge Stimme seines Vaters, die sprach:
„Mica. Du bist jetzt alt genug. Ich habe dir einen Lehrmeister gesucht. Du wirst ihm gehorchen, verstanden? Nein, keine Widerrede! Morgen bringen wir dich hin.“
Die Trauer, wenn er sich verabschieden musste. Doch für all das schienen seine Eltern kein Verständnis zu haben. Also sagte er sich, dass es besser sei, seine restlichen Tage in Freiheit unbeschwert mit seinen Freunden beim Ballspiel zu verbringen.
Er nickte seinem Freund Rangar zu, holte aus, und warf den Ball. Rangar fing ihn geschickt auf, und schleuderte ihn gleich wieder zurück. Das Ziel des Spiels war es, den Ball so zu werfen, dass der andere ihn nicht fangen konnte. Diese Runde schien Rangar gewonnen zu haben, denn Mica konnte ihr Spielzeug nicht rechtzeitig fangen. Rangars Jubelschrei gellte über die Wiese. Lachend ob der unbeschwerten Freude Rangars trottete Mica zum Ball, und beugte sich über ihn, damit er ihn aufheben konnte.
Dann ging auf einmal alles sehr schnell. Links von ihm knackte etwas im Gebüsch. Noch bevor er den Kopf wenden konnte, schoss etwas brennendes heraus und traf den Ball. Ein heller Lichtblitz, begleitet von einem Knall beendete sein Leben.
Alvar hockte schon seit Stunden in dem Gebüsch. Er nahm an, dass es Rhododendron war. Seine Hand lag auf seinem Bogen, neben ihm lagen zwei Pfeile auf dem Boden. In einer Grube, die er in der Nacht ausgehoben hatte, glühten ein paar Kohlen, heiß aber ohne Qualm.
Ärgerlich dachte Alvar an den Morgen. Es hatte eines Vermögens benötigt, die Zofe des Edelssohnes Mica zu bestechen, diesem den bunten Ball auszuhändigen. Und nun standen die beiden Jungen dort auf der Wiese, und spielten mit ihrem Tod, während einfach nicht das passierte, was Alvar sich erhoffte. Der hübsch aussehende Ball war mit Schwarzpulver gefüllt. Ein einziger Brandpfeil reichte für seinen Plan aus. Dafür hatte er den einen Pfeil mit Zunder umwickelt.
Doch damit er optimale Bedingungen zum Schießen hatte, musste er einmal hinter Mica landen. Leider war dieser ein begnadeter Fänger.
Doch schließlich passierte es: Mica sprang zu spät vom Boden ab, der Ball glitt ihm durch die Finger, landete im Gras und rollte noch ein paar Schritte.
Bedächtig nahm Alvar den Pfeil mit Zunder zur Hand, entkorkte eine kleine Phiole, und leerte deren Inhalt über dem Pfeil aus. Es war ein zähes Öl, welches unglaublich heiß brannte.
Dann spannte er das Geschoss ein, während Mica dem Ball immer näher kam. Als der Junge sich darüber beugte, hielt Alvar die Spitze des Pfeiles in die Kohlen. Das Öl entflammte zischend. Alvar richtete sich auf, wobei er auf einen kleinen Zweig trat.
Mist!
Dann ließ er den Pfeil losschnellen. Er traf den Ball fast genau in der Mitte. Einen Augenschlag später explodierte das Schwarzpulver, und zerfetzte Micas Körper. Das blutige Schauspiel verschreckte Micas Freund, Rangar, der aufschrie und fortrennen wollte. Alvar nahm den zweiten Pfeil, und auch Rangar sank getroffen zu Boden.
Mit einem Fußtritt beförderte Alvar Sand über die Kohlen, warf sich den Bogen auf den Rücken und verschwand.
Alle drei Ziele waren eliminiert. Und er war sich nicht sicher, ob man jemals alle Teile des dritten Opfers finden würde.
Geändert von MisterMeister (29.05.2009 um 18:08 Uhr)
-
»Ich weiß, dass das für Euch ein sehr großer Verlust ist. Mir ging es ebenfalls so, und ich leide noch heute manchmal an dem Schmerz, den sein Tod bei mir hinterlassen hat.«, erklärte der in Weiß gewandete Mann bedächtig. Lady Adela, die Mutter des unlängst verstorbenen Micas, wischte sich verstohlen die Tränen aus den Augenwinkeln. Ihr Gemahl, der Statthalter von Khorinis, Larius, legte tröstend einen Arm um ihre zerbrechlich wirkenden Schultern, die in regelmäßigen Abständen zuckten. Auch ihm war zum Heulen zumute, doch er beherrschte sich.
Der Vierte im Bunde war ein kleiner, untersetzter Mann mit schwarzen Haaren, die auf seine breiten Schultern fielen. Es war Lord Guillaume, der Sohn des legendären Lord André, der kürzlich verstorben war. Auch ihm drohte die Trauer die Kehle abzuschnüren, doch er hüllte sich in einen Mantel von äußerlicher Gelassenheit. Sie alle hatten einen Sohn verloren, sinnierte er, und das machte sie zu Verbündeten. Doch ließ man diesen Aspekt außer Acht, hatten sie nicht sehr viel für sich übrig. Der Kerl in Weiß war ein arroganter Schnösel, der sich für etwas besseres hielt, als alle anderen. Larius war ein jämmerlicher, korrupter Beamter, der seiner Stadt nicht gerade zu Ehre gereichte, und zudem inzwischen ein alter Mann. Nein, von einem Bündnis konnte man nicht reden, eher von einer Zweckgemeinschaft. Und ausgerechnet er hatte sie alle zusammenkommen lassen, als er gehört hatte, was passiert war. Er fragte sich, ob das wirklich eine gute Idee gewesen war. Da diese Zweifel in in ernstliche Gewissenskonflikte zu bringen drohten, beschäftigte er sich viel lieber mit seiner Umgebung:
Er befand sich in dem luxuriösem Arbeitsraum Larius'. Der Statthalter hatte sich erboten, den Raum zur Verfügung zu stellen. Und das war äußerst praktisch, denn niemand hatte Verdacht geschöpft oder argwöhnisch getuschelt, als die Männer sich versammelten, schließlich waren Zusammenkünfte wichtiger Menschen hier nichts ungewöhnliches.
Der Raum besaß einen großen Schreibtisch, der mit Dokumenten und Briefen regelrecht übersät war, mehrere Stühle und kostbare Wandbehänge. Auf einer Kommode stand ein Krug Wein, und sie alle hielten einen unberührten Pokal in den Händen. Es war Rotwein. Vielleicht aus Varant.
Die Sonne schien durch große, kostbare Glasfenster, und trotzdem war es in dem Raum ungemütlich. Guillaume fragte sich, ob das an der Trauer lag, die hier fast mit Händen greifbar zu sein schien. Er verspürte ein eigentümlich heftiges Bedürfnis, aus diesem Raum zu fliehen, raus an die frische Luft.
Diesen Drang schien wohl auch Lady Adela zu verspüren, denn sie richtete sich eilig auf, murmelte eine Entschuldigung und stürzte hinaus.
»Schwanger«, erklärte Larius.
»Unser zweites Kind.« Bei den letzten Worten versagte seine Stimme, und er senkte den Kopf, um, so schien es, die Lichtreflexionen auf seinem Wein zu betrachten. Als er sich schließlich wieder im Griff hatte, räusperte er sich kurz, und sah abwartend in die Runde.
Guillaume stellte unbehaglich den Pokal beiseite, und blickte in die Augen seiner Gesprächspartner. Larius' schon von Natur aus dunkle Augen schienen heute eine Nuance dunkler, und ein halb fragender, halb flehender Ausdruck hatte sich lag darin. Guillaume konnte diesen Ausdurck mühelos deuten: Bitte, sag mir etwas, das meine Trauer lindert!, schienen diese Augen zu sagen.
Die des anderen Mannes waren eisblau, und kalt wie Stahl. Sie sahen Guillaume berechnend an, doch er entdeckte dort keine Trauer. Nur etwas unerbittliches. Diesen Mann, schloss er, sollte man sich nicht zum Feind machen.
»Wir alle haben den Verlust eines Sohnes zu betrauern.«, hob er seine unerfreuliche Rede an.
»Sie alle wurden ermordet, ohne Rücksicht auf Verluste.«
Die anderen nickten vorsichtig. Guillaume räusperte sich wieder, griff zu seinem Pokal, und nahm einen winzigen Schluck.
»Mein Sohn war mit Gefolgsleuten auf der Jagd, als es passierte.«, fuhr er fort. »Und einer hat überlebt. Es handelt sich um einen Magier, womit die Attentäter offenbar nicht gerechnet haben, sie waren auf einen magischen Schutz nicht vorbereitet. Und dieser Magier sagte mir, er kenne die Mörder. Es handelt sich um einen Assassinenkult, der schon lange auf dieser Insel besteht, und doch hat ihn bis jetzt noch niemand gefunden. Niemand, der in böser Absicht zu ihnen kommt. Nur die, die einen Gefallen von ihnen erbitten, werden zu ihnen geführt. Der Magier nannte mir einen Verbindungsmann, bei dem wir uns werden einschleusen müssen, wenn wir den Tod unserer Kinder rächen wollen. Das ist der einzige Weg zu den Verbrechern.«
»Und was, wenn wir drin sind?«, wollte Larius wissen.
»Ich meine, was sollen wir ihnen sagen? ›Hallo, wir sind die Väter dreier eurer Opfer, und wir hätten gerne, dass Ihr den Mörder unserer Söhne tötet?‹ Das klingt nicht sehr erfolgversprechend.«
»Wir könnten jemanden als eine Art... Lehrling einschleusen.«, sagte der Mann in Weiß versonnen.
»Der findet dann raus, wer unsere Kinder getötet hat, und bringt ihren Mörder um.«
»Wer würde freiwillig ein Mörder werden?«, fragte Larius.
»Nun, niemand von uns, soviel ist gewiss. Es muss jemand sein, der sonst nicht viel vom Leben zu erwarten hat. Jemand, der keine Skrupel hat, und dessen Gewissen käuflich ist. Vor allem aber darf er nicht bekannt sein.«
Die drei Männer überlegten. Schließlich blickten sie alle nachdenklich in Richtung Hafenviertel.
Geändert von MisterMeister (29.12.2009 um 00:43 Uhr)
-
2
»Eskil! Gut dich zu sehen! Ist heute nicht ein wunderbarer Tag?«
Der wohl reichste Mann im Hafenviertel stieß ein dröhnendes Lachen aus und klopfte seinem Gast kräftig auf die Schulter.
»Bromor«, grüßte der etwas schmächtige Mann leise und schob die Hand des Zuhälters energisch von seiner Schulter. Bromor seufzte leise. Diesen Mann konnte er nie um den Finger wickeln.
»Wer darf es denn dieses Mal sein?« fragte er betont geschäftsmäßig.
»Nadja.«
Bromor nickte und gab der fraglichen Dame verstohlen ein Zeichen. Die nickte und verschwand.
Eskil wollte sich umwenden und ihr folgen, doch Bromor hielt ihn zurück.
»Lass sie sich ein wenig herrichten. Das tut sie immer, wenn du kommst, weißt du?« Er grinste anzüglich.
»Und ich nehme an, das sagst du jedem, der sie bestellt«, versetzte Eskil. Herablassung schwang in seiner Stimme.
Bromor machte ein empörtes Gesicht, ging aber nicht darauf ein. Stattdessen fragte er:
»Was macht die Frau daheim?«
»Das geht dich nichts an.«
»Ich würde es aber trotzdem gerne wissen.«
»Ja, das glaube ich.«
Eine unangenehme Stille breitete sich aus, und Bromor fand nichts mehr zu sagen. Schließlich sagte Eskil:
»Ich gehe jetzt hoch. Mehr als ausziehen muss sie sich ja nicht.«
Er drehte sich um und folgte Nadja ins Obergeschoss. Dicke Teppiche hingen an den Wänden und verliehen diesem Ort eine behagliche Atmosphäre. Doch dies hier war die Rote Laterne, und die Geräusche, die aus manchen Zimmern drangen, störten die Behaglichkeit ein wenig.
Zügig schritt er an den Türen vorbei und betrat schließlich den hintersten Raum. Nur eine einzelne Kerze stand auf dem Schrank und tauchte den Raum in einen flackernden, orangenen Schein.
Eskil blieb einen Moment in der Tür stehen, bis seine Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, und er die schöne Frau erkannte, die auf dem Bett lag und sich verführerisch räkelte.
Als sie die Decke, die sie über sich gebreitet hatte, langsam von sich zog, und er erkannte, dass sie bereits nackt war, stieß er sich vom Türrahmen ab, durchquerte den Raum mit zwei großen Schritten und riss ihr die Decke und sich die Kleider vom Leib. Gebannt starrte er auf ihren Körper.
Und als sie ihn zu sich auf das Bett zog dankte er Innos, dass es Frauen wie sie gab.
Als er nach Hause ging, wurde es schon wieder hell. Nachdem er die Rote Laterne verlassen hatte, war er in die Hafenkneipe gegangen. Das tat er immer. Als er die Tür öffnete, dachte er lächelnd an die zurückliegenden Stunden, die er mit Nadja verbracht hatte. Sie hatten nicht viel gesprochen. Dafür umso mehr...
Eine schrille Stimme unterbrach seine Gedanken.
»Eskil!«, fauchte die Stimme. »Wo warst du?«
Das war der zweite Grund, weswegen er möglichst lange fort blieb. Seine Frau. Sie war ein zänkisches Frauenzimmer, das er geheiratet hatte, als sie das florierenden Fischgeschäft ihres Vaters geerbt hatte. Der Reichtum, den ihm das Geschäft einbringen sollte, wäre ihm sehr gelegen gekommen, denn er war wie immer abgebrannt gewesen. Doch kaum hatte er den Handel übernommen, brach dieser völlig in sich zusammen. Niemand schien mehr bei ihm einkaufen zu wollen. Das nahm seine Frau ihm übel. Und sie ließ ihn jeden Moment spüren, was sie von ihm hielt.
»Warst du wieder bei dieser billigen Hure?«, fragte sie nun, und beantwortete ihre Frage gleich selbst:
»Natürlich. Eine anständige Frau wie ich würde das Lager nie mit einem Versager wie dir teilen wollen, nicht wahr?«
Er ignorierte sie vollkommen, ging achtlos an ihr vorbei, zog sich aus und ließ sich in sein Bett fallen. Doch seine Frau schien nicht gewillt, ihn einschlafen zu lassen.
»Mich wundert, dass Bromor eine erbärmliche Jammergestalt wie dich überhaupt einlässt.«
Langsam richtete er sich wieder auf und trat einige Schritte auf sie zu, die sie hysterisch lachte.
»Wen willst du mit diesen Drohgebärden einschüchtern?«, fragte sie. »Niemand wird je vor die Angst haben. Weil du ein Schwächling bist!«
Er schlug ihr die Faust ins Gesicht. Ihr Lachen verwandelte sich in einen Schmerzensschrei, und Blut sprudelte aus ihrer aufgeplatzten Braue. Sie begann zu weinen. Er schlug noch einmal zu, und sie fiel zu Boden. Zum ersten Mal richtete er das Wort an sie:
»Schlampe. Scher dich raus.«
Sie blickte zu ihm auf.
»Aber es ist dunkel«, wandte sie flehend ein, während immer noch Tränen ihre Wangen herabliefen und sich mit ihrem Blut vermischten.
Es erregte Eskil, so viel Macht über einen Menschen zu besitzen. Bei dem Gedanken, dass er über ihr Schicksal bestimmen konnte, wurde ihm heiß und kalt. Sein bis dahin wütend zusammengepresster Mund verzog sich zu einem hämischen Grinsen, und er packte sie hart am Arm.
Sie versuchte, sich freizukämpfen, doch er war zu stark für sie.
Er packte den Ausschnitt ihres Kleides und zog zwei Mal kräftig daran. Der dünne Stoff riss mit einem trockenen Laut.
Seine Frau schrie schon wieder. Eskil stieß sie aufs Bett, kniete sich vor sie und öffnete seine Gürtelschnalle.
Seine blutende Frau wich furchtsam vor ihm zurück und kauerte sich an die Wand am Kopfende des Bettes.
Er genoss ihren Anblick. Dann folgte er ihr, packte ihre Hände, mit denen sie ihn abzuwehren versuchte, und zwang mit den Knien ihre Oberschenkel auseinander.
»Ich werde dich lehren, mich zu beleidigen«, keuchte er.
Bromor hatte Recht behalten. Es war tatsächlich ein wunderbarer Tag.
Geändert von MisterMeister (18.07.2010 um 22:33 Uhr)
-
»Fische! Frische Fische!«
Eskil stand neben seinem kleinen Stand und versuchte, mit seinem eher abschreckenden Gebrüll, Kunden anzulocken.
Es war wie immer: Er stand morgens auf, wenn sein Kater es zuließ, sortierte die Fische – die fauligen nach unten, die besseren nach oben -, und blickte dann in die Gesichter der vorbeieilenden Menschen, von denen keiner bei ihm kaufen wollte.
Er hatte sein Rufen mittlerweile aufgegeben und war gerade dabei, sich seine Fingernägel mit seinem Messer zu kürzen, als er aus dem Augenwinkel eine blaue Robe erspähte. Hastig richtete er sich auf, schnippte die abgeschnittenen Fingernägel unauffällig in seine Auslage, und rief dann in einem Tonfall, als freue er sich, den Besucher zu sehen:
»Vatras! Es ist wunderbar, dass du mich hier beehrst! Möchtest du Fisch kaufen?«
Der Wassermagier musterte Eskil geruhsam und mit durchdringendem Blick.
»Nein, danke«, sagte er schließlich langsam.
Eskil fragte sich unbehaglich, was Vatras von ihm wollte, und dachte, dass es sicher keine erfreulichen Gründe sein würden.
»Deine Frau«, setzte Vatras schließlich an, »hat sich heute morgen noch vorm Morgengrauen an mich gewandt. Sie hatte ein blaues Auge, eine gebrochene Nase, und sagte mir, du habest sie... Bedrängt.«
Das war nicht ganz richtig. Tatsächlich hatte sie ihn unter Tränen angefleht, ihr zu helfen, und ihm so detailliert beschrieben, was geschehen war, dass Vatras beinahe übel wurde.
Eskil entspannte sich und atmete erleichtert aus.
»Vatras, ich sage es dir gerne noch ein mal, wenn dir die anderen fünfhundert Male nicht gereicht haben: Es geht dich nichts an, wie ich mit meiner Frau umgehe, denn sie ist mein Eigentum. Und mit meinem Eigentum verfahre ich so, wie ich will.«
Der Wassermagier trat einen Schritt auf ihn zu. Eskil hatte Mühe, nicht zurückzuweichen, denn der alte, schmächtige Mann war durchaus furchteinflößend, wenn der Zorn in seinen Augen loderte.
»Du bist eine Schande für diese Stadt, Eskil«, sagte er. »Und ich warne dich, wenn du mir nicht hoch und heilig versprichst, dass du deine Frau in Zukunft nie mehr bedrängst oder ihr anderweitig Leid zufügst, dann schwöre ich dir, dass du keinen einzigen Moment deines jämmerlichen Daseins mehr wirst genießen können!«
Er wandte sich um, stürmte mit langen Schritten davon, und verschwendete keinen Blick mehr an den angstvoll zusammengekauerten Eskil.
Der blickte der blauen Robe hinterher, die langsam aber sicher im Menschengewimmel verschwand. Als er sie nicht mehr sehen konnte, entspannte er sich ein wenig. Je mehr seine Angst schwand, desto stärker wurde sein Zorn.
Ein paar Atemzüge lang stand er reglos da und starrte ins Leere, dann ging er beinahe zaghaft in Richtung Marktplatz.
Eskil war nicht mehr fähig, klar zu denken. Sein einziger Gedanke war, irgendwem Schmerz zuzufügen. Am liebsten seiner Frau, die ihm diese ganze Misere eingebrockt hatte. Seine Schritte beschleunigten sich, und er gelangte zügig zu Harad, dem Schmied. Er blickte sich kurz um und betrat dann die Unterführung, die zum Adanostempel führte. Doch er hatte keine Lust, noch einmal Vatras unter die Augen zu treten. Stattdessen bog er links ab und fand sich in Constantinos Alchemielabor.
Er hatte richtig geraten: Auf dem Bett des alten Alchemisten lag eine kleine Gestalt mit einem Verband um das Gesicht, in den sicherlich irgendwelche heilenden Kräuter eingearbeitet waren. Die Gestalt war ihm nur allzu vertraut, und ihr Anblick löste bei ihm eine seltsame Mischung aus Hass, Erregung und Überlegenheitsgefühl aus.
Doch bevor er ein Wort sagen konnte, drehte Constantino sich um, und erblickte Eskil. Er erkannte ihn auf einen Blick, und rief:
»Hinaus mit dir, du Monstrum! Du hast hier nichts verloren, das ist mein Haus!«
»Und meine Frau«, knurrte Eskil, trat achtlos an dem alten Alchemisten vorbei und packte seine Frau roh am Arm. Sie starrte entsetzt auf die Hand, die ihren Arm umklammert hielt, und schien unfähig, Worte zu finden. Ihre Lippen bewegten sich, als wolle sie irgendetwas sagen, und sie war todesbleich geworden. Ihr angstvoller Blick wechselte hastig zwischen seinem Gesicht und Constantinos.
»Lass sie los«, sagte Constantino drohend.
Statt ihm Folge zu leisten, schlug Eskil ihm seine Faust gegen die Schläfe. Lautlos sackte der alte Mann in sich zusammen.
»Nun zu uns, Liebling«, flüsterte er seiner Frau drohend ins Ohr. Das riss sie aus ihrer Lethargie. Plötzlich wand sie sich in seinem Klammergriff, und kreischte.
Eskil verließ hastig die Wohnung des Alchemisten, wobei er seiner Frau eine Hand auf den Mund presste. Draußen sah er sich um, und sah Vatras, der anscheinend die Schreie gehört hatte, auf sich zu laufen.
»Lass sie los, du Teufel!«, brüllte der Wassermagier.
Eskil dachte nicht daran. Er warf sich seine Frau wie ein Gepäckstück über die Schulter, und rannte los.
Sein Weg führte ihn hinaus aus der Unterführung, an Harads Schmiede vorbei und direkt ins Hafenviertel. Er benutzte nicht den normalen Weg, sondern stieg über die halb verfallene Stadtmauer.
Schnell tauchte er in die kleinen, schmalen Gassen ein, und machte schließlich auf einem dunklen Hinterhof halt.
Eskil lauschte. Es schien, als habe er den Wassermagier abgehängt.
Er ließ seine Frau achtlos auf den Boden fallen, stellte sich über sie und platzierte einen Fuß auf ihrem Hals.
»Du Schlampe hast mich verraten«, sagte er beinahe leidenschaftslos. »Dafür wirst du büßen.«
Sie konnte unter seinem Gewicht nicht atmen und rang verzweifelt nach Luft.
»Antworte!«, fauchte er, zerrte sie hoch und stieß sie gegen eine Hauswand.
»Mein ganzes Leben hast du zerstört. Aber damit ist jetzt Schluss. Du wirst diesen Tag niemals vergessen, und wenn du hundert Jahre alt werden wirst. Ja, wenn ich dich erst einmal gezähmt habe, wirst du so schnell nicht mehr gegen mich rebellieren!«
Er packte ihr Kinn und drehte ihren Kopf, sodass er ihr ins Gesicht sah, das sie bis dahin weggedreht hatte.
»Bitte«, flehte sie. »Lass mich. Ich... Ich habe doch nichts getan...«
»Nichts getan?«, fragte er wütend. »Nichts getan? Du hast mein ganzes Dasein ruiniert! Du bist ein einziger Fluch!«
Er schlug ihr ins Gesicht. Sie weinte.
»Hör auf zu flennen«, sagte er. »Dir gefällt es doch. Das sehe ich dir an. Dir gefällt es! Sag, dass es dir gefällt! Sag es!«, schrie er.
»Es gefällt mir«, hauchte sie beinahe unhörbar, während immer neue Tränen ihre Wangen hinabrannen.
Eskil konnte sich an keinen schöneren Moment in seinem Leben erinnern. Endlich war sie gefügig. Endlich.
Jetzt gab es nur noch eines zu tun.
»Zieh dich aus«, befahl er mit rauer Stimme, während er bereits seine Gürtelschnalle öffnete.
»Du sollst dich ausziehen!«
Sie schüttelte verstört den Kopf und machte keinerlei Anstalten, seinem Befehl Folge zu leisten.
Eskil zückte sein Messer und hielt es ihr an die Kehle.
»Ich sage es nicht noch einmal«, flüsterte er. »Du sollst dich ausziehen. Es wird dir gefallen, glaub mir.«
Seine Hand wanderte unter ihren Rock und ihr Bein hinauf.
Da jedoch kreischte sie auf, warf sich zurück, und überraschte ihn so sehr, dass er rücklings auf den Boden fiel.
Sie versuchte, aufzuspringen, doch er erwischte sie gerade noch am Knöchel und riss sie zurück. Auch sie fiel hin, und sie kämpften einen ungleichen Kampf. Er war viel stärker als sie, und zudem nicht Herr seiner Sinne. Ein roter Schleier hatte sich über sein Sichtfeld gelegt, und er hörte ein gleichmäßiges Pochen in seinen Ohren. Er war außer sich.
Plötzlich erschauerte sie. Er hörte ein scheußliches Gurgeln, dann lag sie still. Ihre Hand, die sie in seine Haare gekrallt hatte, rutschte ab und fiel auf den Boden.
Er sah auf sie hinab. Auf das Messer in ihrem Hals, das er immer noch umklammert hielt, und auf seine blutverschmierte Hand. Es war ihr Blut.
Er konnte sich nicht entsinnen, bewusst zugestochen zu haben. Doch er musste es getan haben.
Wie gebannt blickte er in ihre gebrochenen Augen, die glasig ins Leere starrten.
Er erhob sich und sah sie an. Sie lag zu seinen Füßen, ihre Kleidung war zerfetzt, ihr Gesicht gezeichnet und bereits blass, und um ihren Hals bildete sich rasch eine große Blutlache.
Als er sich nach seiner Hose bückte, die er hinuntergezogen hatte, um seinen Besitzanspruch geltend zu machen, hielt er inne. Er hörte rennende Schritte. Im nächsten Moment stürzte Vatras auf den kleinen Hinterhof.
Als sei er vor eine Mauer gerannt, hielt der Wassermagier inne. Voller Abscheu und Schrecken starrte er auf die Szene vor seinen Augen.
Sein Blick wanderte von Eskil mit seinen blutverschmierten Händen und halbnackt, zu seiner toten Frau.
»Du... Monster«, war alles, was Vatras über die Lippen brachte.
Eskil räusperte sich.
»Es ist nicht so, wie du denkst, Vatras. Sie... hat sich gewehrt. Ich wollte doch nur mein Recht durchsetzen, aber sie... Vatras, du musst mir glauben! Ich trage keine Schuld!«
Er taumelte auf den Wassermagier zu, der einen Schritt zurückwich.
»Du bist nicht bei Sinnen. Halte Abstand, Eskil! Bleib weg von mir!«
Eskil wollte Vatras erklären, was passiert war, doch plötzlich wurde er von hinten kräftig an den Schultern gepackt und zurückgerissen.
Er blickte sich um, und sah zu beiden Seiten jeweils ein Milizionär. Die zwei Männer drehten ihm die Arme auf den Rücken, rissen ihn herum und führten ihn in Richtung Kaserne.
Aus den Augenwinkeln sah Eskil, dass ein Anderer sich zu seiner toten Frau kniete.
Die Wachen machten sich nicht die Mühe, seine Blöße zu bedecken. Nackt und blutverschmiert, wie er war, schleiften sie ihn durch die Straßen. Ein dritter Milizionär drängte die schaulustigen Menschen zurück.
Als sie an der Kaserne ankamen, wurde Eskil umgehend in eine der düsteren Löcher geführt, die unter den normalen Zellen lagen. Offenbar hielten sie ihn für besonders gefährlich, denn sie legten ihm ein eisernes Halseisen um und ketteten ihn an die Zellenwand. Dann verließen sie die Zelle und schlossen die schwere Eichentür. Eskil hörte dumpf den Schlüssel im Schloss rasseln, und das Poltern eines großen Riegels, der vor die Tür geschoben wurde.
Dann war es still. Er lehnte den Kopf an die Wand, und versuchte, irgendetwas zu erkennen, doch die Dunkelheit war vollkommen. Erst jetzt fiel ihm auf, dass die Milizen nicht ein Wort mit ihm gesprochen hatten.
Geändert von MisterMeister (18.07.2010 um 22:34 Uhr)
-
»... wirst deshalb hiermit am heutigen Tage zum Tode verurteilt.«
Ein bedrücktes Schweigen lag über der Menschenmenge. Normalerweise prasselten bei einer Hinrichtung wie dieser die unterschiedlichsten Wurfgeschosse, deren Art von faustgroßen Steinen bis zu fauligem Obst reichte, auf den Verurteilten nieder. Doch heute war es anders. Die Abscheulichkeit von Eskils Verbrechen schien die Leute zu erschüttern.
Eskil schluckte, als der Henker mit seiner schauerlichen Maske auf dem Kopf auf ihn zu trat und ihm die Schlinge überstreifte.
»Hast du noch irgendwelche letzten Worte?«, fragte der Richter, doch Eskil hatte ihn längst aus seiner Wahrnehmung ausgesperrt. Er versuchte, mit sich ins Reine zu kommen.
Er wusste, er hatte nichts Unrechtes getan. Er hatte lediglich das getan, was ihm zustand. Dass dabei ein Unfall passiert war, war nicht seine Schuld.
Und doch schienen die Richter, Vatras und die ganze Stadt anderer Meinung zu sein. Sie waren erpicht darauf, ihn hängen zu sehen.
Er fürchtete sich bis ins Mark, als er spürte, wie das raue Seil an seinem Hals scheuerte. Dabei lag es noch locker. In wenigen Minuten würde es sich fester und immer fester ziehen, bis …
»Vollstrecken.«
Eskil biss sich auf die Zunge, um nicht um Gnade zu bitten. Stattdessen schloss er die Augen, rang mit seiner Angst und betete zu den Göttern.
Mit einem Ruck klappte der Boden unter seinen Füßen weg und er stürzte.
Er riss die Augen wieder auf und wollte schreien, doch nur ein Röcheln drang aus seiner Kehle. Irgendwann war auch das versiegt. Rote Punkte flammten vor seinen Augen auf, und er wand sich, um der Atemnot und dem Schmerz zu entkommen.
Dann war es plötzlich vorbei.
Eskil lag auf dem Boden und fragte sich, ob er tot war. Er bekam immer noch sehr schlecht Luft, und der Schmerz in seinem Kopf war immer noch grauenvoll. Doch er fühlte den Boden unter sich, den grobkörnigen Sand an seiner Wange.
Bevor er zu einem Schluss gekommen war, wurde er auf die Füße gezogen und der Strick um seinen Hals verschwand. Eskil begann zu husten und sog die Luft gierig ein.
Schließlich blickte er sich um.
Das erste, was er sah, war ein paar feiner Stiefel. Der zu den Stiefeln gehöre Mann hielt einen Dolch in der Hand, mit dem er Eskils Strick durchtrennt hatte. Das abgeschnittene Ende, das immer noch am Galgen befestigt war, baumelte sacht hin und her.
»Dieser Mann wird freigelassen«, sagte der Mann mit dem Dolch. Eskil konnte sein Gesicht nur verschwommen erkennen, und ihm war schwindelig und furchtbar übel.
Ein bedrohliches Zischen erhob sich.
»Aber er ist ein Monster!«, rief ein mutiger Zuschauer.
Nein, wollte Eskil antworten, die Monster seid ihr, dass ihr einen Unschuldigen widerrechtlich hinrichten wollt, doch nur ein neuerlicher Hustenanfall kam ihm über die Lippen.
Der fremde Mann ging nicht darauf ein, sondern half Eskil, auf die Galgenkonstruktion zu klettern.
Hinter ihnen räusperte sich jemand. Eskil blickte sich um und erblickte den Richter, wie er nervös seine Robe knetete.
»Ähm … Wollt Ihr wirklich einen Aufstand hier riskieren?«, fragte er den Fremden.
»Was ich riskiere oder nicht riskiere habe nur ich zu entscheiden, niemand sonst«, versetzte der, und führte Eskil langsam von der erhöhten Plattform herunter.
»Mein Name ist Larius«, vertraute er ihm an. »Ich bin der Statthalter von Khorinis. Ich und einige andere Vertraute suchen jemanden, der uns zu Diensten sein könnte, und wir haben beschlossen, dass Ihr genau der Richtige dafür seid.«
Eskil fragte nicht, worum es sich bei diesen Diensten handelte. Hauptsache, er musste nicht wieder an diesen verfluchten Galgen. Hauptsache, er würde dem Tod nie wieder so nah sein, wie heute.
»Einverstanden«, brachte er mühsam hervor.
Larius lächelte.
»Ich wusste, Ihr würdet mich nicht enttäuschen.«
Irgendetwas an seinem Tonfall gefiel Eskil nicht. Doch nun war es zu spät.
Geändert von MisterMeister (02.09.2010 um 16:10 Uhr)
 Berechtigungen
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
|







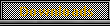



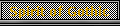










 World of Players
World of Players
 [Story]Rotwein
[Story]Rotwein









