-
Platz vor der Bastion
Schweigend und mit vor der Brust verschränkten Armen hatte sich der ehemaliger Ordenskämpfer das Treiben des Varanters angesehen. Er stellte sich nicht ungeschickt an und begriff schnell, wie Staub und Dreck aus dem, nun in der kalten Jahreszeit, besonders dicken Fell entfernt wurden.
»Möhre gefällt dein Treiben ganz gut. Ihr habt beim Striegeln die Stelle am Wiederriss, über der Schulter, gefunden, an denen sich Pferde gern freundschaftlich knabbern.« Er erhob sich vom Hocker und kam zu Calan herüber. Er legte seine Hand auf den Halsansatz unter den Mähnenkamm und kraulte mit kräftigem Druck über dem Schulterblatt. Der Hengst hob den Kopf und zog die Oberlippe hoch. Er machte ein ziemlich dummes Gesicht und kaute etwas in er Luft, um sein Vergnügen kundzutun. »Pferde reagieren Unterschiedlich auf diese Freundschaftsbekundung. Möhre ist sehr genügsam, und genießt Kraulen sehr offensichtlich. Häufig kann man vertraute Tiere sehen, die sich hier gegenseitig beknabbern, um ihre Bindungen zu stärken. Sie können das nicht, wenn die nur angebunden rumstehen, also solltet Ihr darauf achten, einem Tier auch mal etwas Freigang und Umgang mit anderen Pferden zu ermöglichen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Von Menschen akzeptieren sie diese Bekundungen aber auch gern.«
Er griff einen weiteren Striegel und rieb mit ihm über das Fell, in der anderen Hand hatte er die Kardätsche und bürstete mit langen strichen den zuvor entfernten Dreck direkt herunter.
Der Sattel liegt von hier, auf dem Wiederrist, bis auf den unteren Rücken kurz vor der Hüfte des Pferdes. Je nach dem wie gut er passt und welche Erfahrungen das Pferd gemacht hat können Pferde am Rücken, besonders hier hinten, sehr empfindlich sein. Auf Schmerzen reagieren Pferde meist zuerst mit Ausweichen oder Verspannung, danach häufig mit Aggressivität.« Er fuhr mit der Büste unter den Bauch. Möhre legte die Ohren an, ein deutliches Zeichen für sein Missfallen. Als Redlef die Büste nicht wegnahm, sondern vorsichtig um die Schlauchtasche herumbürstete, hob der Hengst den Hinterhuf und drohte zuzutreten. Redlef wechselte seine Position am Pferd etwas, sodass ein tritt nicht viel Schwung entwickeln konnte. »Mache Pferde sind am Bauch und besonders auch zwischen den Hinterbeinen sehr kitzelig. Aber besonders hier, muss ab und zu auch mal gründlich gebürstet werden, da muss man sich dann arrangieren«, erklärte er Calan mit einem Schmunzeln und drückte das Pferd herum, bis es das Gewicht auf das gehobene Hinterbein verlagern musste. Gleichzeitig sprach er es streng an, um diese Hampeleien endlich zu unterbinden.
Während er so vor sich hinarbeitete, erinnerte er sich wieder an seinen Lehrauftrag. »Verzeiht, vielleicht sollte ich Euch mein Handeln besser erklären. Ist lange her, dass ich Irgendwem was gezeigt habe.« Er legte die Bürsten beiseite und betrachtete nachdenklich den Schecken, dann Calan: »Es ist ein praktikabler Weg ein Pferd, welches Euch an Kraft und Größe immer überlegen sein wird, mit der Überlistung seines Körpers auszutricksen. Wie schon gestern auf dem Platz, wo ich Euch riet, den Kopf unter Kontrolle zu bringen, um die Richtung zu bestimmen, ist es hier Hilfreich, die Beine des Pferdes zu nutzen. Es kann mit dem Bein nicht treten, auf dem sein Gewicht liegt. Wie immer, die Ausnahme bestätigt die Regel…«
Dann wandte er sich ab und machte eine Handbewegung, die Calan dazu auffordern sollte, den Rest auch noch zu Bürsten. Er holte inzwischen den Sattel und die Trense aus der Sattelkammer.
Das Schwere Ding aus Leder und Holz war behangen mit allerlei Gurten und Riemen, dazu gehörte auch noch eine Satteldecke und das Brustgeschirr sowie die Trense. Er hievte alles über eine am Sattelplatz befindliche Bank und sortierte es ein wenig.
»Das recht fürs Erste«, erklärte er Calan und bat ihn mit einer Armbewegung zu sich herüber. »Besonders im Gefechtsfall ist das Bürsten des Rückens und der Gurtlage ausreichend. Sobald sich aber die Zeit dafür ergibt, sollten alle Stellen des Pferdes gründlich gepfelgt werden. Besonders wenn die Tiere in den Ständern oder in Ställen stehen haben sie nicht die Möglichkeit sich selbst durch Wälzen zu putzen. Da muss der Mensch mit der Bürste nachhelfen, um Jucken und Scheuern zu vermeiden. Auch solltet Ihr diese Gelegenheiten immer nutzen, Euer Pferd zu kontrollieren: Hat es kleine Wunden, verdickte oder erwärmte Stellen? All das kann auf Verletzungen hinweisen. Auch die Hufe gehören dazu. Solltet ihr auch mal ein mit Hufeisen beschlagenes Pferd reiten ist die Kontrolle der Hufe in jeder Rast, die Ihr einlegt, Pflicht! Ich zeige es euch.«
Red ging zurück zu seinem Pferd, stellte sich neben es und griff nach dem Fesselgelenk. Artig hob das Tier den Fuß. Redlef zog einen kleinen Eisenhaken mit Holzgriff aus seinem Wams und fuhr mit dem Metall durch die Furchen des Hufs. »So sollte es im Idealfall aussehen. Manchmal können in diesen Rinnen Steine festklemmen. Da nur wenig relativ weiches Horn die Sohle des Pferdes bildet, bis der durchblutete Teil der Zehe darüber anfängt, kann es schnell zu Schmerzen kommen. Entfernt Steine und andere Fremdkörper, sorgt dafür, dass die Hufe nicht austrocknen aber nicht immer feucht stehen, dann gammeln sie – Ihr werdet es riechen.«
Schnell waren alle vier Hufe gereinigt.
»Ich habt das Pferd nun also geputzt, kontrolliert und ihm die Möglichkeit gegeben, sich darauf einzustellen, dass nun etwas passiert. Kommen wir nun also zum Eingemachten«, fasste der Ordensbruder zusammen und deutete auf das bereitgelegte Sattelzeug. »Das gute Ausrüstung stehts gepflegt und kontrolliert wird, wisst ihr selbst.« Redlef war der Zustand seiner Kleidung des Gürtels und der Stiefel nicht entgangen. Calan wusste anscheinend, wie man Leder pflegte, daher ersparte er sich weitere Ausführungen.
»Zuerst wird die Satteldecke aufgelegt.« Redlef griff sie sich, achtete darauf, dass sie faltenfrei zusammengelegt war und schmiss sich über den Wiederrist. Möhre kannte die Prozedur und erschreckte sich bei dem Plötzlich in seinem hinteren Gesichtsfeld auftauchendem Ding nicht mehr. »Sie stellt sicher, dass zwischen Rücken und dem hölzernen Sattelbau ein ausreichendes Polster liegt, sodass der Sattel eine gute Auflagefläche hat. Das ist wichtig, da ihr Euer Pferd sonst wund reitet. Häufig sieht man weiße Flecke in der Sattellage, diese sind das Überbleibsel des sogenannten Satteldrucks. Dieser entsteht, durch unpassende Sättel, schlechte, verrutschte oder zu dünne Decken oder eine zu hohe Last im Sattel. Die Haut oder Muskel entzünden sich dort auf und es kommt zu offenen, eiternden Stellen, die Euer Pferd im schlimmsten Fall wochenlang unreitbar machen.«
Nachdem die Decke an die richtige Stelle nach hinten auf den Rücken gezogen worden war, und er mit einem Überstreichen kontrolliert hatte, dass alles glatt lag, holte Red den Sattel. Entgegen der Decke hob er ihn langsam und legte ihn bedächtig auf dem Rücken ab. Konzentriert führ er mit den Fingern unter den Sattelbaum, um auf die eben angesprochenen Druckstellen zu prüfen. »Die Lage und Passform eines muss regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Der Rücken ist durchaus empfindlich, hütet Euch also davor, den Sattel einfach drauf zu schmeißen. So macht man ein Pferd sauer.« Er belegte Calan mit einem strengen Blick. Es war ein reines Ausnutzen der Gutmütigkeit und des Vertrauens des Pferdes. Man sollte sich hüten, dies in seiner Gegenwart zu tun.
»Also gut, Sattelgurt erstmal nur einhängen, noch nicht festziehen. Das Vordergeschirr dann hier und hier verzurrt. Es verhindert, dass der Sattel nach hinten rutscht. Beim Kampf mit der Lanze ist dies natürlich besonders wichtig. Es gibt auch noch ein Krupper oder Schweifriemen, darauf könnte man auch verzichten, doch Möhre hat einen sehr flachen Widerrist, sodass der Sattel während des Reiten nach vorn rutschen könnte.«
Mit routinierten Handgriffen, sattelte und zäumte das Pferd und erklärte Calan, worauf er achten musste. Er half ihm auch, die Steigbügel auf seine beinlänge einzustellen. Durch die Weiderholungen der Handgriffe, die er Calan ausführen ließ, dauerte der ganze Vorgang viel länger als sonst. Möhre ließ alles ruhig über sich ergehen, obwohl er die letzten Tage aufgrund des erwärmten Hufes nicht gearbeitet wurde. Ein Vorteil des Erbes seiner genügsamen Ackergaulmutter.
Schließlich waren sie auf dem Platz angekommen. Redlef führte den Hengst vor eine Tritt mit drei Stufen und stieg sie hinauf. Dann nahm er die Zügel in die linke Hand, hielt sich am Sattel fest und hievte sein steifes Bein über das Tier. Er presste die Lippen dabei zusammen. Dies war der erste Ritt seit seiner Entlassung und das Pferd hatte durch die lange Schonung sicherlich einiges an aufgestauter Energie in sich. Ihm war mulmig zu Mute, doch es wäre ein Fehler gewesen den unerfahrenen Calan direkt aufsteigen zu lassen.
»Pferde müssen sich bewegen und bevor wir mit der Arbeit anfangen ihr Körper erst einmal warm werden, wenn sie aus dem Stall kommen«, erklärte er, als das Pferd antrat und am losen Zügel lostrottete. Redlef lenkte es an den Rand, wo er einen armlangen Weidenzweig nahm, der dort an einen Pfosten gelehnt bereitlag. Wie ein Schwert hob er den Zweig senkrecht vor sich und konzentriert sich auf das Pferd. Nun merkte er die Angespanntheit unter dem Sattel und führte Möhre au einige weiter Kreise um den nun allein auf dem Platz stehenden Calan herum. Hin und wieder tippte er die Schulter oder Flanke des Pferdes auf der rechten Seite an, wo ihm das steife Bein den Dienst versagte. Auch zog er von zeit zu zeit den Sattelgurt fester, um mit zunehmender Lösung des Pferdes den Sattel am Verrutschen zu hindern.
»Ich werde Möhre etwas abreiten, sodass er gleich ausgeglichenerer ist. Den Zweig nutzte ich als eine Art Zeigestock, dort, wo mein verkrüppeltes Bein keine Hilfen gehen kann. Er ist niemals zum Schlagen gedacht. Die Macht, die Ihr vom Sattel aus über ein Pferd habt, ist groß. Eure Hand hält die Zügel, die mit dem Gebiss, einer eisernen Stange, die im Maul direkt auf dem dünnen Zahnfleisch des Pferdes liegt, verbunden ist und aufgrund der Kandarenzüge enorme Kraft entwickeln kann. Euer Körper mit seinem Gewicht sitzt dem Pferd im wahrsten Sinne des Wortes im Nacken. Hier könnt ihr problemlos den Kopf, den Hals und die Wirbelsäule erreichen und Eure Fersen den langen Muskel am Bauch, der direkt auf die Hinterbeine einwirkt. Sicherlich bemerkt Ihr, wie sehr Euch das Pferd damit ausgeliefert ist… Wollt Ihr eine Zusammenarbeit erhalten, darf dies niemals ausgenutzt werden. Dieser zeig soll Hilfe nicht Peitsche sein.«
Redlef wendete ab, und drehte ein paar Runden auf der anderen Hand, also in die andere Richtung. Möhre beschleunigte ungewollt seine Schritte. Er verfiel immer wieder in einen Zwischengang zwischen Schritt und Trab – Zakeln. Wieder einmal parierte Red in einen Schritt durch. Inzwischen hatte er das Gefühl, dass sich das Pferd etwas gelöst hatte. Mit einem weiteren Antippen des Zweiges ließ er es unvermittelt angaloppieren. Voll Übermut machte Möhre einen weiten Sprung, einen kleinen Buckler und furzte während der ersten paar Galoppsprünge. Für einen kurzen Moment klammerte sich Red instinktiv mit den Beinen an den Sattel. Ein Fehler. Möhre begriff dies als eine Aufforderung an Geschwindigkeit zuzulegen. Red kippte nach hinten und griff kurz in die Mähne, um nicht aus dem Sattel zu rutschen. Dann aber fing er den Hengst wieder ein, nahm die Zügel weiter auf und nutze die Begrenzung des Zaunes, um das Pferd wieder zum Schritt durchzuparieren.
Früher hätte ihn eine solche Aktion nicht aus dem Gleichgewicht gebracht. Doch weder hatte er die Kraft noch die Gewöhnung, diese Sprünge so wegzustecken wie vor seiner Inhaftierung. Doch was hatte er Calan gepredigt? Kein Zweifel!
Er atmete tief durch, versammelte das Tier, wendete ab und galoppierte erneut an. Wieder sprang Möhre nach vorn, doch dieses Mal gelang es ihm besser das Tier wieder einzufangen. Nach ein paar weitern Durchführungen dieser Übung wurde es ruhiger.
»Sicherlich habt Ihr es erkannt: diese Übung verlangt einem Pferd recht viel Energie ab. Aus dem Schritt anzugaloppieren und nach wenigen Sprüngen wieder durchzuparieren, ohne dabei die Körperspannung zu verlieren, kostet Kraft und dank der relativ engen Wendungen hier auf dem recht kleinen Platz auch viel Konzentration. Es hat das Pferd aktiviert und ich habe nun seine Aufmerksamkeit. Er weiß nun, dass wir zusammenarbeiten wollen und zeigt mit, dass er zur Mitarbeit bereit ist.« Redlef ritt nun langsam zurück zur Aufstiegshilfe und ließ sich aus dem Sattel gleiten.
Er passte die Steigbügellänge für Calan an, stellte sich auf die andere Seite und hielt Calan die Zügel, sodass er über die Steige aufsteigen konnte. »Also nun Ihr. Nutz bitte auch die Aufstieghilfe, denn auch wenn Möhre ein kräftiges Pferd ist, bedeutet ein Aufsteigen über den Steigbügel immer eine einseitige Belastung des Rückens, die wir vermeiden wollen.«
Er beobachtete Calan wie er seinen Weg in den Sattel des großen Tieres fand.
»Zügel in beide Hände, keinen Zug aufnehmen aber auch nicht durchhängen lassen, nur die Fußballen in den Steigbügel, wie sind hier nicht auf dem Turnierplatz und das Bein lang. Die flache Wade treibt das Pferd, die Hände bleiben im gelichen Abstand zueinander und gelenkt wird nicht durch ziehen. Drückt den linken Zügel an den Hals um nach rechts abzuwenden, und andersrum. Verspannt Euch nicht, die Knie locker, den Oberarm herabhängend, auch die Schultern sollen sich nicht verspannen, dennoch darf Euer Körper nicht schlaff im Sattel hängen. Geht mit den Bewegungen des Pferdes mit, ohne sie aktiv mitmachen zu wollen. Hände aufrecht, Zügel zischen Ringfinger und Kleinem Finger, der Daumen hält. Drückt den Rücken nicht durch und bleibt beweglich in der Mittelpositur. Kopf grade, den Blick zwischen den Ohren hindurch!«
Dieser Schwall an Informationen wurde durch Redelf mit Gesten, Fingerzeigen und korrigierendem zurechtschieben von Calans Körper begleitet. Wie jeder Reitanfänger wurde nun auch der Varanter damit konfrontiert, dass man sich sofort auf unzählige Dinge gleichzeitig konzentrieren sollte. Red erwartete nicht, dass es klappte, niemand konnte das und es würde endlose Ermahnungen durch den Reitlehrer benötigen, biss der Schüler eine halbwegs vorzeigbare Figur auf dem Ross machte.
»Und nun: Anreiten im Scheeee-ritt!«
Geändert von Redlef (03.12.2024 um 14:30 Uhr)
-
Armenviertel - Salzige Muschel
Es war einer dieser wunderbaren Tage, an denen die Arbeit so reichlich anfiel, wie die Sonne ihre Wärme über die Reben und das zugehörigen Weingut gelegt hatte. Und wie so oft war es ihm gelungen, sich irgendwo zwischen Pinkelpause, Mittagessen und einem Botengang ins Haus des alten Großbauern zu mogeln um dort dessen Tochter, die liebreizende Annette zu besuchen. Die blöden Trauben würden schließlich noch am Abend und am morgigen Tag hängen. Ob die Ernte nun einen Tag früher oder später abgeholt wurde – wen kümmerte das schon? Und wenn es so wichtig war, würden sich schon die richtigen darum kümmern. Trevor für seinen Teil hatte einmal mehr weder Motivation zu schwitzen noch mit klebrigen Fingern in der Hitze herumzustehen und diese garstigen Fruchtfliegen zu verscheuchen. Drecksviecher! Drohten sie jede Saison damit, einen wieder zu fressen. Nein, sollten sich die damit herumärgern, die sich auch sonst für wichtig und unverzichtbar hielten. Er würde mit seinem Mädchen runter zum Strand gehen, mit ihr eine Flasche aus dem Weinkeller genießen und ein paar süßer Südfrüchte naschen. Und wer weiß, ob sie ihn dann nicht auch noch ein zweites Mal ein wenig … naschen lassen würde. Zumindest versprach ihr verschmitztes Lächeln mehr als das, als sie sich nach eingängiger Betrachtung im Spiegel zu ihm umwandte, das Mieder verschnürte und ihm diesen unwiderstehlichen Blick zuwarf. „Denkst du nicht, es fällt auf, dass du so lange weg bist, mein Lieber?“
Trevor, noch immer beflügelt vom gerade erlebten Stelldichein lag, ein Bein ausgestreckt, dass andere angewinkelt auf Annettes Bett, kratzte sich am Oberschenkel und zuckte nur mit den Schultern. Wirkliche Sorgen standen ihm nicht gerade ins Gesicht geschrieben. „Was soll sein? Borman musste die Weinpresse reparieren und die Zeit hab‘ ich eben genutzt, um die Zäune zu überprüfen.“ Annette hob die Brauen und legte die Stirn in Falten. „Das dritte Mal diese Woche? Dieselbe Woche, die erst zwei Tage alt ist?“ Er kam nicht umhin, sich ertappt zu fühlen und zu grinsen. Sie musste ihn damit konfrontieren. Schließlich würde sie irgendwann einmal den Hof übernehmen. Und irgendwie musste sie ihm ja den Faulpelz von der Haut ziehen, würden sie eine gemeinsame Zukunft planen. Der Winzer seufzte nur, ließ sich resigniert nach hinten aufs Bett fallen und streckte sich laut ächzend durch. Was hätte er schon sagen sollen? Ihr Recht geben? Natürlich hatte sie Recht. Aber das war noch lange kein Grund, ihr die Genugtuung zu geben und zuzugeben, dass dieses stinklangweilige Leben als Weinbauer zwar in Ordnung, aber auch nicht das Wahre war.
Zumindest wäre es das, wäre Annette nicht gewesen. Den Unterarm übers Gesicht gelegt, musterte er sie mit einem Auge darunter hervor. Ihre dunklen, grauen Augen lagen sanft auf ihm, erhielten durch die wenigen Sommersprossen jedoch eine leicht kecke Art des Ausdrucks und wirkten durch die kleinen Lachfältchen nur umso liebevoller. Dazu die zwei kräftigen, blonden Haarsträhnen, die ihr feines Gesicht links und rechts in einen jugendlichen Rahmen setzten. Dazu das süffisante Lächeln das unter der spitzen, geraden Nase saß. Sie hielt ihn hier. Nun, sie und Throné. Aber die schien das Leben auf dem Hof zu genießen. Und Trevor? Er kannte, außer der Stadt und den umliegenden Gebieten der Insel nur wenig. Wohin hätte er gehen sollen, wenn seine Welt, die wenigen Menschen, die er Familie nannte, hier und vor allem, glücklich waren?
Trevor schloss die Augen. Es war in Ordnung.
„Guuuten Morgen, Sonnenschein! Die Arbeit wartet!“
Das schabende Geräusch von hölzernen Ringen über eine ebenso hölzerne Stange, zusammen mit dem Rascheln von Stoff und dem unmöglichen, lebensbejahenden Singsang einer Begrüßung riss ihn aus dem tiefen Traum. Sich noch nicht ganz gewahr, wo er sich befand, blinzelte der Mann von Archolos irritiert umher. Wo waren die Sonne und die Wärme? Der Geruch des Meeres und des gemeinsamen Moments mit Annette? Widerwillig, als langsam die Erkenntnis war, wo der ehemalige Tagelöhner sich gerade befand, zog er die Decke über den Kopf und wandte sich, ergriffen von plötzlichem Zorn ab. Die Brauen zusammengezogen kämpfte der Jüngere der Zwillinge um das letzte bisschen wohligen Schlafgefühls. Vergebens. Trevor wollte wieder nach Hause. Zurück auf das langweilige Weingut. Zurück zu den lästigen Fruchtfliegen und der Schweiß treibenden Hitze des Sommers. Er wollte sich wieder über klebrige Finger Gedanken machen müssen und Pläne schmieden, sich zu drücken.
Ein sanfter Druck wurde an der Bettkante, nahe seiner Füße spürbar. Jemand hatte sich darauf niedergelassen und der Tagedieb konnte den Blick Jazminas deutlich auf sich spüren. „Du hast wieder geträumt, oder?“ Trevor schwieg, atmete jedoch einmal tief durch und suchte dabei unter halb herabgelassenen Lidern irgendwo einen Punkt, zu dem er sich flüchten konnte. Weg von dem unterschwellig besorgten Ton in ihrer Stimme und dieser seltsamen Fürsorge, die am Ende wohl auch nur eine Maske sein musste.
Aber da war nur der wackelige Beistelltisch neben dem Bett und dahinter die mit Holz vertäfelte Wand. Nun, es würde wohl nicht helfen, aber das Auge einer alten Verastung in einer der Tafeln bot zumindest etwas mentalen Halt. Eine Antwort bekam seine Gastgeberin jedoch nicht. Stattdessen war sie es, die ihn zusammenzucken ließ. Ihre kalte Hand legte sich über die Haut seiner aus der Decke lugenden Wade und ließ ihn abermals scharf einatmen. In einem Gemurmel, halb ins Kissen, halb in die Decke echauffierte er sich darüber, ob sie in der letzten Nacht die Gesellschaft eines Eisgolems genossen hatte. „Ich wünschte, es wäre so. Dann hätte er gleich beibringen können, wie eine warme Begrüßung aussieht. Aber so muss ich mich eben mit der Eiseskälte von Archolos anfreunden.“
„Schön. Guten Morgen. Kann ich jetzt weiterschlafen?“ Jazmina schüttelte den Kopf und begann zu schmunzeln. „Nein. Außerdem ist die Mittagsstunde schon vorbei und es wird langsam Zeit, dass du dich nützlich machst und deinen Teil der Abmachung einhältst.“
„Weil es ja so üblich ist, ohne Nachverhandlungen“, kommentierte er brummend und vergrub sein Gesicht seitlich im Kissen. „Wirst du mir das jetzt für euren gesamten Aufenthalt vorhalten?“ ihr Griff begann sich zu festigen und er spürte, wie ihre Nagelspitzen sich provokativ einen Weg in seine Haut zu suchen drohten. Frustriert und unter einem zeternden Stöhnen suchte Trevor wuchtig mit der Faust nach dem weichen Untergrund seiner Schlafstatt und blieb dann wie ein alter Fisch kurz liegen. „Is‘ ja gut … Verdammter Dreck!“
„Wortgewandt wie immer.“
Eine Bemerkung, der der Mann von Archolos keine Beachtung schenkte. Stattdessen drehte er sich auf den Rücken, zog sein Bein aus der eisigen Umarmung des Todes, oder eben Jazminas heraus und streckte beide Arme von sich. Der Blick der stahlgrauen Augen bleib an der Decke haften und einmal mehr fragte er sich, was er Adanos angetan haben musste, um dieses Schicksal zu tragen. „Adanos gibt … Adanos nimmt …“
„Schon wieder?“
„Hm?“
„Du sagst das oft.“
Trevor richtete sich langsam auf und rutschte nach hinten, das Kissen im Rücken zwischen ihm und der kühlen Wand. Er schniefte einmal kurz und rieb sich dann übers Gesicht. „Wo steckt Throné?“
„Sie erledigt Besorgungen mit Julie.“
„Aber das war doch meine …“
„Ganz genau. Es war deine Aufgabe. Aber nachdem sie mit uns die Bücher durchgegangen ist und du so unruhig schläfst, wollte sie dir das abnehmen. Außerdem werd‘ ich nicht, nur weil der feine Herr Matterhorn lange zu schlafen beliebt, erst am Abend mit dem Kochen anfangen!“
Trevor senkte den Blick. Es stimmte: seit er und seine Schwester in der salzigen Muschel untergekommen und halbwegs vernünftige Betten als Schlafstätten bezogen, suchten ihn immer wieder die Träume an seine Vergangenheit heim. Und nun, kaum dass es etwa bequem wurde, fiel er wieder in alte Muster. Auf Kosten seiner Schwester. Ein Gefühl machte sich in seiner Magengegend breit, welches den aufgekommenen Zorn recht zügig verbannt hatte. Dennoch keines mit dem man seinen Tag beginnen wollte. Er seufzte nur und schüttelte den Kopf. Dann, nur in Hemd und Hose bekleidet, schlug er die Decke zurück und schlüpfte in seine Morgenlatschen. Wenn man diese einfachen, halbwegs in Schuhform gestrickte Wollflicken so nennen konnte. „Krieg‘ ich noch Zeit, mir das Gesicht zu waschen und, äh, du weißt schon?“
„Oho, der feine Herr! Darf es dazu noch Puder und das Doublet aus Hummelfell sein?“
Der Schalk aus der Tiefe ihrer blauen Augen streckte ihm einmal mehr die Zunge entgegen. Trevor jedoch, der schon seit geraumer Zeit seinen Sinn für Humor im Hafenbecken verloren hatte, deutete ihr mit einer Handgeste an, sich zu Beliar zu scheren und stand dann auf. „Na gut, ich will mal nicht so sein. Macht Euch frisch, werter Herr von Matterhorn und lasset nach mir rufen, sobald Ihr salonfähig seid!“
Jazmina war aufgestanden, verabschiedete sich mit einem formvollendeten Knicks und verließ schmunzelnd das Zimmer der Zwillinge. Trevor hingegen griff sich nur ans Nasenbein und presste die Augen zusammen, wobei er sich etwas vom Schlafsand aus den Augen rieb. „Adanos, bitte lass mich in der Waschschüssel ersaufen!“
Nach diesem wirklich wundervollen Start in den Tag kehrte Trevordann irgendwann, nun tatsächlich salonfähig, in den Empfangsraum des Bordells ein und schaute sich um. Wie so oft war um diese Zeit noch relativ wenig los. Manch einer saß zwar schon auf einem der Diwane oder einer Bank, aber, wie so oft, hatte der Tagedieb mehr den Eindruck, dass die Menschen vor Sonnenuntergang höchstens auf ein kühles Getränk oder eine der, zugegeben, ganz passablen Mahlzeiten vorbeikamen. Die Köchin, Farnese, eine der ‚Angestellten‘ die ihre Haare oft zu zwei Rattenschwänzen geflochten, trug, wusste wirklich wie man Krautwickel in Senfsoße zubereitete. Klang merkwürdig, schmeckte beim ersten Bissen fragwürdig, wurde aber von Ma(h)l zu Ma(h)l besser!
„Na, Pascha? Ausgeschlafen?“ Farnese war ein Sonnenschein, dem Aussehen nach wohl etwas in Thronés Alter. Ihre Haare, dominiert von einem feurigen Rot und das Gesicht besprenkelt von Sommersprossen war scharf geschnitten und es hatte etwas schelmisches an sich. Aber aus irgendeinem Grund erinnerte diese Frau ihn mit ihrem ständigen Grinsen an einen Goblin mit Zöpfen. Nur eben … ansehnlicher. Und mit wesentlich ausgeprägteren Lippenpartien. „Das darf ich mir jetzt jeden Tag anhören, hm?“
„Du bist der Mann im Haus“, scherzte sie weiter und holte einen Tonkrug unter dem Tresen vor, den sie mit einer angenehm dampfenden Flüssigkeit füllte. „Hier, habe etwas Wasser aufgekocht und den Teerest vom Frühstück dazu gegossen. Sollte noch genießbar sein.“
Trevor nickte in dezenter Dankesgeste und zog sich den Tonkrug herüber. Für eine Weile hielt er seine Rechte ausgebreitet, gestützt auf seine Fingerkuppen am Rand des Gefäßes über die dampfende Flüssigkeit. Das fühlte sich angenehm an. „Übrigens, Jaz wartet im Hof auf dich. Das Zelt hinten rechts an der Mauer. Das hinter den Kisten. Lass sie nicht warten.“
Der Tagedieb nickte abermals, griff sich seinen Tee und verließ den Raum durch den Seitengang in den Hof, in dem die Zelte für die Kunden aufgebaut waren. Auch hier: kein Kunde weit und breit. Aber es ergab ja auch Sinn. Die meisten Menschen arbeiteten noch um diese Zeit. Und wer es nicht tat, lebte entweder in gehobeneren Ständen oder weit unter denen, die sich einen Besuch in diesem Laden leisten konnten.
Als der Gestrandete sich schließlich den Weg zwischen den Kisten- und Fässern hindurch gebahnt hatte und das Zelt betrat, saß dort auch schon seine Gönnerin. Wie auch die anderen Zelte war es hier eher spärlich eingerichtet: ein kleiner, grob geschmiedeter Kamin knisterte seitlich am Eingang vor sich hin. Rechts standen zwei Hocker und ein Tisch, ihnen gegenüber eine Wanne auf vier Steinblöcken über einer ausgebrannten Stelle. Und mittig am Ende des Zeltes hinter einer dünnen Stoffbahn waren noch ein paar Felle auf Strohballen ausgelegt. Was ihn jedoch eher interessierte war, was seine blonde Gesellschaftsbegleitung dort fein säuberlich nach Machart aufgereiht auf den Tisch gestellt hatte.
„Illustre Sammlung. Schlösser, nehme ich an. Und wo sind die Haarnadeln?“
„Wolltest du als Hosenmatz auch laufen, bevor du krabbeln konntest?“
„Was hat das damit zu tun?“
„Du erwartest nicht wirklich, dass wir mit einer Haarnadel beginnen.“
Trevor hob nur unwissend die Schultern. „Und die Schlösser? Wie kommt jemand aus …“
„Du willst wissen, wie ein Blumenmädchen an solche Übungsschlösser kommt? Trevor, Süßer, hatten wir nicht schon geklärt, dass ich dir auf manche Fragen keine Antwort schuldig bin?“
„Und wir hatten abgemacht, dass es vorbei ist mit den Geheimnissen.“
Er verschränkte die Arme und fixierte sie aus geschmälerten Augen heraus. Jazmina rollte nur mit den Augen und deutete ihm an sich zu setzen. Als er es sich bequem gemacht, auf einem Ellbogen auf der Tischplatte abgestützt und den Kopf auf seine Hand gelehnt, legte seine, ja, man konnte wohl nun Lehrmeisterin sagen, eine Art ledernes Etui auf den Tisch das sie sogleich ausrollte. Darin steckten, ähnlich wie er es mit seinem Lederhandschuh und der Wundarztklinge handhabte, mehrere flache, längliche Metallstreifen eingefasst. Aller mit ähnlichem Griff aber verschieden geformten Spitzen. Manche eher wie Haken, andere gezahnt, mal fein, mal grob. Dietriche in allen möglichen Varianten. Es bedurfte keiner Worte, als sich die Blicke der beiden trafen. Jazmina schmunzelte hingegen nur still in sich hinein. „Damit wirst du ab heute üben. Damit und mit den Schlössern. Weißt du, ein weiser Mann sagte mal ‚ein Schlüssel, der alle Schlösser öffnet, ist unbezahlbar. Aber ein Schloss, dass sich von allen Schlüsseln öffnen lässt, ist wertlos‘.“
„Und deswegen haben irgendwelche klugen Leute im Laufe der Jahre verschiedene Arten von Schlössern erfunden? Um eine Art Gleichgewicht zu schaffen?“
Jazmina nickte und lächelte. „Und weil ja ein gutes Schloss auch geöffnet werden will, haben kluge Leute im Laufe der Jahre verschiedene Arten und Werkzeuge gefunden, diese Schlösser zu öffnen.“
„Adanos gibt …“
„Adanos nimmt. Hey, jetzt verstehe ich langsam, warum du das immer murmelst!“
Trevor hob eine Braue und begann leicht zu grinsen. „Dann lernen wir ja beide etwas. Also, was ist das für eins? Sieht für mich aus wie ein Türriegel.“ Er nahm sich den einfachsten aller Schließmechanismen vom Tisch und betrachtete ihn eingängig, drehte es ein paar Mal in den Händen und stellte es wieder auf den Tisch. „Mit dem hier fangen wir an. Gute Wahl, Süßer.“ Tatsächlich trieb dieses kleine Lob ihm doch einen Hauch von Schamesröte ins Gesicht. Wann wurde er das letzte Mal wirklich gelobt? Oder lagen noch die Erinnerungen seines Traumes auf seinem Geist? Entweder Jazmina bemerkte nichts davon, oder sie ließ ihm das bisschen Würde, dass er noch hatte und ignorierte die Reaktion ihres Schülers.
„Also, das nennt man ein Holzbolzenschloss. Sag es drei Mal schnell vor dem Spiegel und Rhobars haarloser Zwilling beißt dir heute Nacht in den Fuß.“
„Was zur…“
„Kleiner Scherz. Ich finde den Namen nur urkomisch.“
„Aha. Und … was macht dieses Holzblozsch … Heh, verstehe. Also, was macht den Türriegel so besonders?“
„Nichts. Das ist die einfachste Ausführung an Schlössern. Der Schlüssel wird lediglich dazu gebraucht, den Bolzen aus seiner Halterung im Türrahmen zu lösen. Für gewöhnlich sind die dazugehörigen Schlösser oft eher schlicht und grob gehalten. Der Trick liegt, das wird sich bei allen Schlössern ein wenig durchziehen am Spiel zwischen Riegel und Bolzen. Im Schloss sitzt der Riegel, der wiederum den Bolzen bewegt. Wenn du dir also einen Dietrich nimmst, nimm einen stabilen. Einfach bedeutet oft krude, bedeutet oft, dass feines Werkzeug daran zerbricht. Ich zeig‘ es dir.“
Und mit diesen Worten griff sich das Freudenmädchen eines der feineren Werkzeuge, führte es in das Schloss ein und hebelte vorsichtig, bis das Metall begann sich leicht zu biegen. „Siehst du … Noch ein bisschen mehr und er würde abbrechen. Stattdessen nimmst du den hier.“ Jazmina zog das eben benutzte Feinwerkzeug wieder an seinen Platz und nahm nun einen hakenförmigen Dietrich zur Hand, den sie behutsam in das Schloss einführte. „Und du kannst den einfach so da reinschieben? Ich dachte, Schlüsselformen haben ihren Zweck. Jorgen der Schreiner hat die Tage beim Kartenspielen irgendetwas davon gefaselt.“
„Und er hat recht: aber bei diesen groben Schlössern reicht es oft, einfach ein wenig im Schloss zu drehen, bis du den Riegel erwischst und die Schlüsselbewegung imitierst, mit der der Bolzen angehoben wird.“
Es klickte, knirschte kurz und mit einem Klacken löste sich der Bolzen und ließ sich zurückschieben, als wäre er ganz normal geöffnet worden. Trevor schürzte die Lippen und blinzelte kurz. So schwer schien das ja nicht zu sein. „So. Jetzt du.“
„Kinderspiel.“ Aber war es das? Der Mann vom Archipel schob den Bolzen wieder so zurecht, dass das Schloss zuschnappte und nahm sich dann den Hakendietrich. Kurz befühlte er das kühle, grobe Metall und hielt es dabei auf Augenhöhe. „Hrm. Erinnert an einen groben Angelhaken.“
„Mich eher an einen Schürhaken.“
„Das auch. Also, so?“ Das Metall wanderte unter einem leisen Schaben in das Schloss hinein und Trevor versuchte, erst einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Beschaffenheiten beider Gegenstände waren. Er versuchte, unter eher zurückgehaltener Anweisung Jazminas zu ergründen, wieviel Spiel er mit dem Dietrich hatte und wie welche Drehung erfolgen musste. Es klickte. Es klackte. Der Bolzen begann langsam zurückzuwandern, schnappte jedoch plötzlich zurück. Ganz zum Erstaunen des Tagediebes. „Was hab‘ ich falsch gemacht?“
„Schau dir den Haken an. Er ist gekrümmt genug, um den Riegel zu fassen. Allerdings ist der Riegel wohl am Rand abgerutscht und das Schloss damit wieder zugeschnappt. Kinderspiel also, hm?“
„Anfängerpech!“
Jaja, natürlich. Nochmal! Der Tag hat, für dich, gerade erst angefangen und die Schlösser werden nicht einfacher!“
Also begann er von Neuem. Und da war sie wieder: diese seltsame Form der Aufregung und des Nervenkitzels. Im Angesicht dessen, dass sich ab heute sicher einige Türen mehr für ihn öffnen würden. Wortwörtlich sogar …
-
Saraliel flog in seiner Eulenform hoch über Thorniara. Seine Schwingen trugen ihn weit und die windlose Luft in der astralen Ebene lies ihn sich mühelos bewegen. Keine Anstrengung und kein Schweiß in seinem Gesicht. Hier fühlte er sich frei und konnte dem nachgehen, was er am liebsten tat: Beobachten. Er sah noch immer die beiden Soldaten wie aufgeschreckte Hühner herumlaufen, denen er sich als goldenes Licht gezeigt hatte. Er lachte innerlich noch immer über den Scherz den er sich erlaubt hatte und hoffte gleichzeitig, dass die Beiden sich nicht allzu viel Gedanken machten über das was sich ereignet hatte. So allgegenwärtig Magie war, so sehr glaubte er, dass sie es verkraften würde.
Ein starker Flügelschlag trieb ihn weiter nach oben und er merkte wie der Sog der Wirklichkeit an ihm klebte. Es war wie ein Lederband, welches sich immer weiter ausdehnte und mit der Zeit weiter ausleierte. Er stemmte sich mit seiner arkanen Kraft dagegen und die vermeintliche Fessel wurde schwächer. Immer und immer wieder stemmte er sich kraftvoll dagegen und seufzte dabei. Trotz allem verspürte er keine große Anstrengung in dieser Ebene. Das war wohl etwas, was ihn erst wieder einholte, wenn er in seine physische Gestalt zurückkehrte. Doch dieses lies sich durchaus noch etwas verzögern.
»Ich bin der Wind und ich bin der Sturm. Meine Schwingen tragen mich weit hinaus. Hoch zu dir empor«, meinte er zu seinem Gott und wusste nicht, ob er hier gehört werden würde. Weder von Innos’ noch von irgendwelchen anderen Wesen. Hier so schien es floss alles ineinander, wie ein ewiger Strudel aus Zauberei und Gefühlen. Mit einem Male erspähte er etwas. Unten in Thorniara war ein Baum und an ihm baumelte etwas. Mit einem Satz zog er seine gedachten Flügel an und stürzte sich in die Tiefe, wo die nächste Herausforderung auf ihn wartete.
-
... zuvor ...
„Endlich! Ich kann es kaum erwarten, mal wieder ein heißes Bad zu nehmen!“, verkündete Jörg grinsend, als die Tore der Stadt in Sicht kamen. Jacques stimmte ihm zu. Die Expedition hatte sich über Wochen hingezogen, aber es fühlte sich an, als wären sie ein Jahr oder länger unterwegs gewesen! Sie hatten so viel erlebt, hatten so vielen Gefahren trotzdem müssen!
Vor seinem inneren Auge ließ Jacques noch einmal einige der Ereignisse Revue passieren: Wie er sich zusammen mit Sunder und den beiden Mädchen vom Pferdehof durch die Goblinhöhle gekämpft hatte und sie nur entkommen waren, weil sie sich als Goblin-Gott verkleidet hatten! Er musste unwillkürlich lachen, als er daran dachte, auch wenn es am Ende noch einmal denkbar knapp geworden war und sie in ernsthaften Schwierigkeiten gesteckt hätten, wenn nicht Ulrich und die anderen im rechten Augenblick eingetroffen und sie vor der wütenden Goblinhorde gerettet hätten. Dann das Auftauchen dieses seltsamen Streiters, Draconiz; die Wanderung über den Gebirgspass zusammen mit Sunder und Mina, bei der er beinahe auf Nimmerwiedersehen in einen Abgrund gestürzt wäre. Der Kampf gegen die Echsenmenschen bei den Überresten des Kometen, die Begegnung mit Chala und ihrer durch und durch pessimistischen Weltsicht, und natürlich die einschneidenden Erlebnisse mit den Untoten und dämonischen wie auch göttlichen Kräften in den Höhlen unterhalb des Weißaugengebirges.
Ihm wurde mehr und mehr klar, dass er in diesen Wochen mehr Abenteuer erlebt und mehr Gefahren getrotzt hatte als viele Menschen in ihrem ganzen Leben. Und er war größtenteils unbeschadet aus allem herausgekommen – irgendwie.
Seine Hand wanderte nachdenklich zu der Narbe an seinem Hals, sein ‚Andenken‘ an die Ereignisse tief unterhalb der Erde. Seine Erinnerungen an das, was dort geschehen war, war verschwommen, als hätte er sie gar nicht selbst erlebt, sondern wäre nur ein Beobachter des Geschehens gewesen, der mal hier, mal dort einen kurzen Blick auf die Ereignisse hatte werfen können.
Woran er sich jedoch erinnerte, war das Gefühl, von einer göttlichen, einer heiligen Macht durchströmt worden zu sein, als wäre er in diesem Moment kaum mehr als ein Werkzeug gewesen, das einem höheren Willen gedient hatte. Es hatte ihn mit einer übernatürlichen Stärke und Zuversicht erfüllt und ihm ermöglicht, sich durch die Horden der Untoten zu kämpfen, um ein Ziel zu erreichen, von dem er selbst nichts gewusst hatte.
An einer Lederkordel um seinen Hals hing – neben dem Amulett, dass Agnes, die Tochter des Pferdezüchters, ihm geschenkt hatte – ein einzelner Fingerknochen. Der Knochen hatte sich vom Skelett des Märtyrers gelöst, als hätte der tote Held gewollt, dass Jacques ihn mitnahm. Es war eine Reliquie, ein heiliger Gegenstand, nicht weniger! Aber was bedeutete das für ihn? Was erwartete der Heilige von ihm, was erwartete Innos von ihm? Jacques war bislang kein übermäßig gläubiger Mensch gewesen – sicher, er hatte die Götter, allen voran Innos, stehts verehrt, seine Gebete und Gaben dargebracht, wie es sich für einen jeden Menschen geziemte, und er hatte nie daran gezweifelt, dass Innos die Gerechtigkeit in die Welt brachte, so wie Adanos die Gnade und Beliar die Rache.
Aber die Ereignisse unter dem Gebirge hatten alles verändert. Er spürte, er wusste, dass nun eine weit größere Verantwortung auf ihm lastete – Innos hatte ein Auge auf ihn geworfen, und er würde ihm nicht nur Hilfe zuteilwerden lassen, sondern auch erwarten, dass er sich dieser Aufmerksamkeit würdig erwies. Doch wo sollte er damit beginnen? Wahrscheinlich wäre es am besten, wenn er sich bei einem Feuermagier Rat holte.
Doch das würde auf den nächsten Tag warten müssen. Als die Streiter durch das Tor schritten, wobei die Wachen stramm vor Kommandant Ulrich salutierten, führte ihr Weg sie nicht als erstes in den Tempel, sondern – in die Marktschänke. Ein paar Dunkle Paladiner hatten sie sich nach all den Strapazen und Gefahren wahrlich verdient! Und, da war sich Jacques sicher – nicht einmal Innos würde etwas dagegen einzuwenden haben.
Geändert von Jacques Percheval (04.12.2024 um 16:59 Uhr)
-
»Und bitte.«
Wie ein kleines Mädchen, das ihren Klassenkameradinnen einen neuen Trick vorführte, den sie gelernt hatte rutschte Felia auf dem Holzhocker hin- und her und schob auffordernd die Kerze ein Stück näher an Curt.
»Du musst keine Angst haben, oh mein großer, starker, mächtiger Feuermagier.«, stichelte sie kess und setzte ein verschmitztes Lächeln auf. »Ich verspreche dir, dass ich dich pflegen werde, wenn... etwas schiefgeht und du dein Gesichtshaar verlieren solltest.« Hinter vorgehaltener Hand lachte sie leise und setzte dann eine weitere Spitze. »Ich werde dich dann zwar nicht aus dem Haus lassen, bis die Haare alle nachgewachsen sind, aber- jetzt mach schon!«, unterbrach sie sich selbst und führte seine Hand mit ihren näher an die Flamme.
Sie war schon ein wenig enttäuscht über den Widerstand, den sie trotz ihres Zuspruchs spürte, aber schlussendlich ließ ihr noch-bärtiger Ordensbruder sich erweichen und hielt das kleine Stück Stoff über die Kerze, deren Flammen sich begierig nach dem Futter reckten und mit orangefarbenen Ärmchen nach dem Stoffrest zwischen den Fingern des Feuermagiers zu greifen versuchte.
Selbstsicher drückte die Schneiderin Curts Hand noch ein wenig tiefer, bis der Stoff mitten in der Flamme steckte und das Orangerot einen großen Teil des Stoffs ganz umschloss. Einige Sekunden lang hielt sie die Hand ihres Liebsten an dieser Stelle und beobachtete selbstbewusst, wie die Flammen versuchten den Stoff zu verzehren, dabei aber chancenlos blieben.
Erst als ein dünner, dunkler Rauchfaden vom Stoff aufstieg, zog sie Curts Hand zurück und grinste ihn an.
»In einem brennenden Haus kannst du damit nicht schlafen, aber den ein oder anderen Feuerball sollte der Stoff durchaus aushalten.«, erklärte sie stolz und klopfte auf die leicht angekohlte Stelle der kleinen Stoffbahn.
»Die notwendige magische Energie, um den Stoff auf diese Weise zu verändern, ist derzeit noch viel zu viel, um in einer realistischen Zeit ein ganzes Kleidungsstück daraus zu fertigen. Aber daran arbeite ich noch.« Ohne zu Agnes zu blicken, die neugierig lauschend unter dem Vorwand eines Tässchen Tees nicht unweit der beiden Liebenden saß, fügte sie dann etwas kleinlauter an. »Ich habe das Gefühl, dass dafür meine Kontrolle der Magie noch etwas zu... unausgereift ist.«, erklärte sie und warf dann das Stück Stoff auf den beachtlichen Haufen anderer Stoffe, die achtlos überall um den Tisch verstreut lagen.
»Und was machen deine Studien zum Teleport? Bisher bist du weder verschwunden noch explodiert - das ist ein Fortschritt!«
-
Die Kriegerin hatte länger pausieren müssen als sie zuerst gedacht hatte. Der letzte Kampf war jedoch nicht ohne Spuren an ihr vorüber gegangen. Und es waren mehr als nur ein paar Kratzer gewesen. Der Nasenschutz am Helm war von einem Streitkolbentreffer eingedrückt worden und sie hatte sich die Nase gebrochen gehabt. Ebenso hatte die linke Schulter etwas abbekommen, denn sie war nicht vom Schild gedeckt gewesen. Zwar brachte es auch Vorteile, als Linkshänderin zu kämpfen, doch nicht nur. Zusätzlich waren einige Rippen angeknackst gewesen. Das Atmen viel schwer, sobald sie zu tief Luft geholt hatte und sie vermeinte bei jedem Atemzug ein dröhnendes Rasseln aus der Tiefe ihrer Brust zu hören. Ihr rechtes Schienenbein war ebenfalls lädiert, wenn wohl auch nicht gebrochen. Sie hatte einige Wochen gehumpelt. Die Blessuren, Quetschungen und Schrammen auf ihrem Körper hatte sie nicht gezählt, diese waren auch als erstes wieder verschwunden.
Für einen Übungskampf war sie viel zu weit gegangen. Sie schalt sich hinterher, als sie ihrer Verletzungen gewahr geworden war, dass sie sich so in den Kampf hineingesteigert hatte. wie sollte sie weitere Übungskämpfe mit Waffen wie Schwert oder Streitkolben bestreiten, wenn sie danach jedes mal für mehrere wochen außer Gefecht gesetzt worden war? Als erfahrene Kämpferin hätte sie hier doch viel besser darauf achten müssen, das Risiko besser einzuschätzen. sie konnte sich auch kaum erklären, warum ihr dies passiert war. Der Barbier des Ordens konnte ihr immerhin den Nasenknochen gut richten, es blieb zum Glück kaum eine Spur von dieser Verletzung zurück. Die Schulter dauerte länger und auf sein Anraten versuchte sie nach einer Weile, mit leichten Übungen die Beweglichkeit dort wieder herzustellen, ehe sie sie stärker belastete. Immerhin hatte er Nienor auch an die Magier des Ordens verwiesen, unter denen zumindest ein Heiler zu finden war. Nienor hatte aber gehört, dass dieser, Saraliel mit Namen, kürzlich die Weihe zum Priester Innos' erhalten hatte. Sie dachte sich, dass er nun, an der Spitze des Ordens angekommen, sicher ganz andere, wichtigere Aufgaben hatte und bedeutenderen Geschäften im Auftrag des Königs nachging, als sich um irgendeine einfache Gardistin kümmern zu können und hatte es deshalb auf sich beruhen lassen.
Sie hatte stattdessen wieder angefangen, mit Tränenbringer am Bogenschießstand zu üben. Der wertvolle Langbogen, den sie noch aus der Kolonie mitgebracht hatte, war nach wie vor ein Prachtstück hoher Handwerkskunst und die regelmäßige Anspannung beim Bogenschießen tat den Muskeln in ihrer Schulter gut. Bald war sie wieder fast so gut wie früher, was sie Schnelligkeit und die Zielgenauigkeit mit dem Bogen betraf. Jedenfalls auf die fest installierten Zielscheiben des Übungsgeländes. Für die weiteren Übungen auf dem Pferd hatte sie sich hingegen einen Kurzbogen gekauft - nichts besonderes, er sollte einfach nur zuverlässig sein. Auf dem Rücken eines Pferdes war ein Langbogen einfach viel zu unhandlich. Sie hatte weiterhin in der Bibliothek, die der Orden besaß, einige Bücher von Reisenden und Entdeckern, die Berichte über Nomadenvölker und deren Kampfkünste hinterlassen hatten, gelesen. Es war natürlich schwer, nur aus den Berichten von Zuschauern, die zumeist noch Händler waren und keine erfahrenen Kämpfer, etwas herauszufinden, dass ihr beim Bogenschießen vom Rücken eines galoppierenden Pferdes aus helfen würde. Aber immerhin wurden einige Schusstechniken beschrieben.
So würden die Heere der Nomaden in großen Gruppen angreifen, ihre Pfeile in hohem Bogen wolkengleich abschießen und sich im Galopp schnell wieder entfernen würden, ehe die Gegner angreifen könnten. War das nicht eine feige Taktik, die eines Ritters nicht würdig war, sich dem Kontrahenten zu entziehen? Und einige dieser Texte berichteten davon, dass die Reiter selbst noch bei der Flucht über den Rücken der Pferde hinweg treffsicher auf ihre Gegner schießen würden. Nienor stellte sich dies sehr schwer vor. Interessant fand sie auch die Erwähnung der leichten Rüstungen dieser Reiternomaden. Sie trugen meist nur Lederpanzer, um ihre Pferde nicht zu stark zu belasten und ihr Schutz schien vor allem in ihrer Beweglichkeit zu bestehen, so dass sie kaum zu fassen waren. Wirklich ein ungewöhnlicher Kampfstil! Sie beschloss, morgen erneut in die Bibliothek zu kommen und noch weitere Schilderungen zu lesen. Sie hatte einige entdeckt, die auch etwas über die besonderen Bögen dieser Völkerschaften zu berichten wussten.
-
Ah, da war die Stelle: »Die Bögen der Hing-No sind kurz und doppelt gebogen. Sie fertigen sie nicht nur aus Holz, sondern nehmen auch Streifen von Horn und Tiersehnen dazu. Diese verbinden sie nach dem Brauch ihrer Vorfahren derart mit Hilfe eines speziellen Leims, dass sie eine feste Einheit bilden, die nicht mehr aufgelöst werden kann. Man sagte mir, dass die Verbindung dieser Materialien insgesamt viel mehr Kraft hat, als ein einfacher Holzbogen.«
Ein zweiter Autor in einem anderen Bericht erwähnte, dass die Bögen, wenn sie ungespannt transportiert würden, eine Biegung komplett in die umgekehrte Richtung aufweisen würden und erst durch die für Spanung sorgende Sehne ihr Aussehen erhielten. Das erklärte wohl auch ihre Kraft und Reichweite trotz der im Vergleich zu einem Langbogen kurzen Bogenarme. Im gleiochen Bericht wurde auch erzählt, dass die Pfeile dieser Reiternomaden sehr weit trugen und das gegnerische Heer mit ihren Bögen nicht die gleiche Reichweite besessen hätte, so dass die Angreifer hohe Verluste erzielt hätten, ohne sich selbst in Gefahr begeben zu müssen. Jedem Angriff seien sie ausgewichen, indem sich die Reiter einfach in der weiten Ebene zerstreut hätten. Ob sie letztendlich besiegt worden waren, ging aus den Worten nicht hervor, da der Bericht danach abbrach.
Doch das alles war zwar sehr interessant, jedoch half es Nienor nicht wirklich dabei weiter, das Bogenschießen auf dem galoppierenden Pferd zu verstehen. Doch da war noch ein Pergament, nur eine alte Rolle, nicht gebunden in ein Buch, die ihr der Bibliothekar herausgelegt hatte, als sie mit ihren Wünschen vor einigen Tagen zu ihm gekommen war. Nienor glättete sie und begann, die Schrift zu entziffern. Es war eine Urkunde, mit der der Unterzeichner seinen Willen kund tat, an den Adanostempel von Setarrif ein Opfer darzubringen, um dem Gott des Wassers für die glückliche Heimkehr von einer langen, gefahrvollen Handelsreise zu danken, die ihn nicht nur über das Meer weit nach Süden geführt hatte. Außerdem beschrieb er neben den Dingen, die er dem Tempel stiftete auch seine Reise und die Gefahren, die er währenddessen erlebte.
»Und als wir mit unseren Gütern und unter dem teuer erkauften Schutz des Herrschers von Segrigent weiter nach Süden zog, begab es sich, dass an einem Morgen, viele Meilen entfernt von jeglicher Stadt inmitten des endlosen Grasmeeres die Götter entschieden hatten, uns zu prüfen. Am Horizont sahen wir eine Schar sich bewegender Punkte, doch diese entpuppten sich als mehrere Dutzend Reiter, die auf kleinen struppigen Pferden schnell näherkamen. Sie blieben jedoch in einiger Entfernung, weiter als ein normaler Bogenschuss und umkreisten uns. Und plötzlich schossen sie ihre Pfeile auf uns ab. Ich weiß nicht, welcher finstere Zauber es ihnen gestattete, dass ihre Pfeile so weit trugen. Es waren Räuber, die es auf unsere Waren abgesehen hatten. Die Soldaten, die uns gegen Entgelt zu unserem Schutz mitgegeben worden waren, mühten sich anfangs tapfer. Sie trieben alle von uns zusammen und errichteten einen Schutzwall und schirmten sich und uns mit ihren Schilden. Doch ein Pfeil findet immer seinen Weg und so fiel einer nach dem anderen, während die Reiter uns in einiger Entfernung umkreisten. Ich konnte, unter einem Wagen liegend beobachten, wie sie vorgingen: Während sie immer wieder Pfeile abschossen schienen ihre Pferde nur auf den Druck ihrer Schenkel hin ihre Richtung und sogar ihre Geschwindigkeit zu ändern. Sie blieben zusammen in ihrer Gruppe und wenn der Anführer die Richtung änderte, dann taten das auch alle die, die ihm folgten. Und sie nutzten keine Zügel dazu, denn sie hielten weiterhin ihre Bögen und schossen auf uns, während sie sich keiner Gefahr durch unsere Waffen aussetzten.
Einer, ein unerfahrener Soldat, stürmte aus dem Lager heraus, um ihnen entgegen zu laufen und er wurde sofort getroffen durch einen Pfeil, der ihm die Kehle durchbohrte. Alle waren darauf gefasst, dass nun unser letztes Stündlein geschlagen hatte. Doch ich betete zu Adanos und er, in seiner großen Güte, half uns. Wo eben noch blauer Himmel war, breiteten sich plötzlich Wolken aus und türmten sich hoch hinauf in die höchsten Himmel, Blitze zuckten in ihnen und erhellten sie auf schauerliche Weise immer wieder von innen heraus und zeigten die Wut der Götter. Windstöße fegten über die Steppe und wirbelten große Staubwolken auf, die die Sicht behinderten. Und dann entlud sich ein Blitz, von Adanos selbst geschleudert, auf den Boden. Und er traf den Anführer unserer Feinde und streckte ihn darnieder und er war tot. Und da ließen sie von uns ab, erschreckt vom göttlichen Zorn. Ein Regen wie eine Flut kam über das Land und wir verloren einige Ballen mit kostbaren Stoffen, doch niemand kam um. Und so erreichten wir am Ende ohne weitere Gefahren Marsabad und konnten hier unsere Waren gegen andere eintauschen. Doch die Reiter, die durch irgendeine Kunst Beliars mit ihren Pferden schier verwachsen zu seien schienen, werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Und deshalb habe ich im fünften Jahr der Herrschaft König Jathul II. als Dank für meine Errettung durch Adanos Wille das folgende Opfer für den Tempel in Setarrif gebracht.«
Und nun folgte noch eine Aufzählung von verschiedenen Dingen, die dieser Kaufmann wohl größtenteils bei seinen Reisen erworben hatte und die er dem Tempel schenkte. Doch Nienor hatte genug gelesen. Sie brauchte ein Pferd, das schnell und wendig war und sie musste lernen, es allein mit dem Druck ihrer Schenkel zu lenken. Sie dankte dem Ordensbruder, der die Schriften verwaltete und gab die Bücher und Schriftrollen wieder in seine Obhut zurück. Danach verließ sie die Bibliothek und ging nachdenklich wieder zu ihrem Quartier zurück.
-
Nienor befand sich gerade in einer Gasse kurz vor dem Haus, in dem sich das Zimmer lag, dass sie in der Stadt gemietet hatte, als sie jemand ansprach. Es war ein Bote des Ordens.
»Nienor de Brettyl?«, fragte er knapp. Nienor bejahte.
»Gut. Hier eine Botschaft für Euch.«
Er überreichte der Kriegerin eine versiegelte Pergamentrolle, nickte kurz zum Gruß und entfernte sich wieder.
Nienor brach das Siegel und entrollte sie. Es handelte sich um eine Änderung ihres Offizierspatents. Die Oberen des Ordens auf Argaan hatten von ihr Kenntnis genommen und sie gemäß den Regeln für Beförderungen im Dienst beurteilt und ihr nun den Rang einer Ritterin zuerkannt, teilte ihr der Obrist Lord Oric mit. Aufgrund von langjährigen Diensten, untadeligem Leumunds, Handelns im Sinne Innos' und so weiter und so fort.
Sie nahm an, dass diese Urkunden nicht individuell ausgefertigt wurden, sondern in der Schreibstube als Vorlage vorhanden waren. Schließlich sollte hier keine Elegie auf Einzelpersonen verfasst, sondern ein nüchterner Verwaltungsvorgang in passende Worte gekleidet werden. Unterschrieben war die Urkunde vom Statthalter, Lord Hagen. Nienor war erfreut und zufrieden. Sie rollte das Schriftstück wieder sorgfältig zusammen und setzte ihren Weg fort. Die wichtige Benennungsurkunde würde sie sorgsam verwahren. Doch schon bald war sie wieder in Gedanken bei ihren nächsten Schritten, was den bewaffneten Kampf vom Rücken eines Pferdes aus betraf und plante ihr weiteres Vorgehen.
-
Felias Schneiderei
„Beeindruckend!“
Curt fuhr behutsam mit den Fingern über das Stückchen Stoff, das Felia ihm stolz überreicht hatte. Es hatte den Kerzentest wohlbehalten überstanden, war lediglich ein bisschen warm geworden. Eine Robe aus derartig magisch verstärkter Struktur könnte wirklich praktisch für die Experimente des Feuermagiers sein. Zwar rechnete er nicht damit, von einem anderen Feuermagier angegriffen zu werden – wer hätte schon den Schneid, sich mit ihm zu messen? – aber Curt musste sich leider eingestehen, dass er selbst seine größte Gefahr war. Er besaß wahrscheinlich viel zu viel magische Energie, sei es die klassische Feuermagie, Astralmagie, die Mimikrytechnik des Zauberlehrlings oder wie zuletzt die Teleportation. Wenn er nicht aufpasste, würde er irgendwann tatsächlich einer spontanen Selbstentzündung erliegen, dann wäre er froh über eine solche Robe, die ihn vor seinem eigenen, inneren Feuer beschützte.
„Wenn du mir einen solchen Zauber auf die Robe aufprägst, werde ich sie stolz der ganzen Insel präsentieren.“
Er streichelte Felia über den Oberarm und nahm ihre gute Laune sehr glücklich zur Kenntnis. Sicher, sie hatte ihm die Robe noch nicht an die eigenen Maße angepasst und von seinem Namen fehlte im Innenfutter auch noch jede Spur. Böse Zungen konnten behaupten, sie wäre seiner Bitte noch gar nicht nachgekommen, aber die hatten keine Ahnung. Was Felia jetzt an Magie in ihre Robenwirkerei einbrachte, würde ihr später gewiss viel Arbeit ersparen. Curt wollte sie nicht unter Druck setzen, zumindest nicht so, dass sie es direkt bemerkte. Eigentlich wollte er nichts lieber, als mit einer prächtig anliegenden und vielleicht sogar figurbetonenden Robe durch das Viertel zu laufen, aber wie konnte er ihr das klarmachen, ohne anmaßend zu wirken?
„Die Teleportation, ja nun …“ Er atmete etwas hörbar aus und überlegte, welche Informationen er weiterverbreiten konnte und welche er aus Geschichten abtun musste.
„Ich habe viel recherchiert und mir einige der Bücher zurückgelegt. Manche Geschichten über Teleportationsunfälle sind richtig schaurig, andere sind sehr blumig ausgeschmückt. Du solltest sie dir unbedingt mal … zu Gemüte führen.“
Sobald das mit dem Lesen klappte. Noch war die Lektüre sicher zu anspruchsvoll. Manche der Texte waren gar in einer älteren Schreibart verfasst, die selbst Curt kaum entziffern konnte. Vielleicht würde er Felia bei Gelegenheit einen eigenen kleinen Text schreiben, mit dem sie üben konnte.
„Draußen auf dem Tempelvorplatz befindet sich ein Knotenpunkt der Magie. Dort erscheinen jene Magier, die sich durch Teleportation nach Thorniara begeben. Ich habe aber noch nicht herausgefunden, wie ich den magischen Schritt tätige; es ist furchteinflößend und über das Wie streiten sich die gelehrten Geister. Manche beschreiben eine magische Tür, andere hüllen sich selbst in eine Aura der Magie – vielleicht wie deine Rüstung – um ihr Ziel zu erreichen und wieder andere führen Bewegungen aus. Ich denke, das werde ich versuchen. Die Gestikulationsmagie fühlt sich richtig für mich an. In jedem Fall bahnt sich eine erfolgreiche Teleportation dadurch an, dass ein blaues Licht zu leuchten beginnt. Den Zusammenhang habe ich noch nicht begriffen. Seltsam, nicht wahr?“
Während er all das erzählte, trank Curt von seinem Tee und erhob sich schließlich, um seinen Wintermantel abzulegen. Wieder stand er halbnackt in ihrer Schneiderinnenstube, aber diesmal würde er nicht einfach nur in Unterwäsche nach draußen stürmen.
„Würdest du bitte meine Maße nehmen? Das haben wir beim letzten Mal vergessen. Meine Robe ist etwas weit. Sie hängt mir immer ganz schlaff herab, das ist nicht schön. Sie sollte hm … anschmiegsamer sein, verstehst du?“
-
Das Reichenviertel, Anwesen des Burggrafen
Adalbert und Maria traten aus dem Anwesen von Sir Dante hinaus auf die sonnige Straße des Reichenviertels. Der Morgen war inzwischen vorangeschritten, und das geschäftige Treiben der wohlhabenden Händler und Bediensteten erfüllte die Luft. Pferdekarren rollten über das Pflaster, und der Klang von Gesprächen und klirrendem Geschirr aus den nahen Häusern begleitete ihren Weg.
Adalbert ging in gewohnt zügigem Tempo voran, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Maria folgte ihm in einem angemessenen Abstand, ihre Gedanken noch bei den prächtigen Stoffen und den präzisen Maßnahmen des Schneiders. Sie fühlte sich zugleich stolz und nervös, als hätte sich ihr bisheriges Leben mit einem Mal verändert.
"Die Zeit drängt, Maria." begann Adalbert unvermittelt, ohne den Blick von der Straße vor sich abzuwenden. "Deine neuen Gewänder werden bald fertiggestellt sein, und bis dahin ist es wichtig, dass du dich schnellstmöglich in deinen Aufgaben zurechtfindest."
"Ja, Herr Adalbert." antwortete Maria eifrig, bemüht, mit seinem Tempo Schritt zu halten.
"Die Erwartungen des Burggrafen sind hoch, wie du weißt..." fuhr er fort, ohne die Stimme zu heben. "Doch ich bin zuversichtlich, dass du ihnen gerecht wirst. Als Kammermagd wirst du allerdings nicht nur für deine Arbeit, sondern auch für deine Ausstrahlung beurteilt. Denke stets daran, dass du das Haus repräsentierst, noch mehr als zuvor."
Maria nickte schweigend, ihre Gedanken kreisten um die Verantwortung, die auf sie zukam. Bald ragte das Anwesen des Burggrafen vor ihnen auf, imposant wie immer. Adalbert führte sie die Stufen hinauf, öffnete die schwere Eingangstür und trat ein, ohne innezuhalten.
"Keine Zeit zu verlieren." murmelte er, bevor er Maria einen kurzen Blick zuwarf. "Wir gehen direkt zu den Privatgemächern. Dort wirst du dich mit deinen Aufgaben vertraut machen." Adalbert führte Maria durch das Anwesen, bis sie vor einer schlichten, aber schweren Tür aus dunklem Holz stehen blieben. Mit einem leichten Zögern öffnete er sie und trat in den dahinterliegenden Flur ein. Maria folgte ihm, und sofort erinnerte sie sich an diesen Ort. Der Flur, mit seinen hohen, glatten Wänden und dem warmen Holzdielen, war ihr nicht fremd – es war der Gang, den sie vor Jahren betreten hatte, als sie dem Burggrafen zum ersten Mal vorgestellt worden war. Damals hatte sie nur einen kurzen Blick auf die schweren Türen erhascht, die zu den verschiedenen Räumen führten.
"Dies ist die Bibliothek des Burggrafen." erklärte Adalbert, als er eine der vom Flur ausgehenden Türen öffnete. Der Raum, den sie betraten, wirkte wie eine andere Welt. Hohe Bücherregale, bis zur Decke reichend, umgaben den Raum und waren mit Bänden in ledernen Einbänden gefüllt. Goldene Zierleisten an den Regalen schimmerten im Licht der Öllampen, die gleichmäßig an den Wänden verteilt waren. Zwischen den Regalen hingen Gemälde in goldenen Rahmen – Porträts früherer Burggrafen und Landschaftsdarstellungen, die eine stille Erhabenheit ausstrahlten.
Im Zentrum des Raumes stand ein prächtiger Sessel mit hoher Rückenlehne, bezogen mit dunkelrotem Samt. Daneben ein kleiner Beistelltisch, auf dem ein silbernes Tablett mit einer leeren Teetasse stand. Der Raum war still und ohne Fenster, was ihm eine beinahe heilige Atmosphäre verlieh.
"Ein beeindruckender Raum, nicht wahr?" Adalbert sah sich mit einem leichten Anflug von Stolz um. "Hier verbringt der Burggraf viele Stunden, oft allein, um zu lesen und seinen Gedanken nachzugehen. Es wird deine Aufgabe sein, die Bibliothek makellos zu halten. Staub darf sich nicht ansammeln, und jedes Buch, das bewegt wird, muss an seinen ursprünglichen Platz zurückkehren."
Maria nickte ehrfürchtig. Sie erinnerte sich vage daran, wie sie zu Beginn ihrer Anstellung einmal durch die Bibliothek geführt worden war, damals jedoch ohne die Bedeutung zu verstehen, die ihr dieser Ort nun zukam.
"Es gibt noch etwas." fuhr Adalbert fort und trat zum Sessel. Er strich mit der Hand über die Lehne und blickte dann zu Maria. "Wenn sich der Burggraf hier aufhält, beliebt es ihm oft nach einer Tasse Tee. Warte mit dem Servieren nicht, bis er danach verlangt. Ein guter Diener erfüllt die Wünsche seines Herrn ohne direkte Aufforderung."
Maria schluckte leicht und nickte erneut. Sie spürte die Verantwortung, die diese Rolle mit sich brachte, doch sie fühlte auch den Stolz, das Vertrauen des Hofmeisters und auch des Burggrafen zu genießen. "Komm!" sagte Adalbert schließlich und wies zur Tür. "Der nächste Raum ist das Schlafgemach des Burggrafen. Auch dort hast du neue Pflichten." Maria folgte ihm wieder zurück in den Flur, ihre Gedanken noch immer bei der stillen Würde der Bibliothek, die sie gerade verlassen hatten.
Adalbert öffnete die nächste Tür im Flur, und Maria trat hinter ihm in das Schlafgemach des Burggrafen. Der Raum wirkte auf den ersten Blick beeindruckend und erhaben. Ein großes Bett, in einer eigens dafür eingerichteten Nische, dominierte die linke Wand. Es war von schweren, weinroten Vorhängen umgeben, die das Bett vollständig abschirmen konnten, wenn sie geschlossen waren. Der Stoff der Vorhänge schimmerte leicht im warmen Licht, das durch die schweren Vorhänge an den Fenstern nur gedämpft in den Raum drang.
"Das ist das Schlafgemach." erklärte Adalbert sachlich, während er sich umsah, als wolle er sicherstellen, dass alles in Ordnung war. "Hier beginnt und endet der Tag des Burggrafen, und es ist von äußerster Wichtigkeit, dass dieser Raum stets makellos ist."
In der Mitte des Raumes stand ein kreisrunder Tisch, darauf ein kunstvoll verzierter Kerzenleuchter und eine Obstschale aus poliertem Silber. Die Wände zierten goldgerahmte Gemälde, die Landschaften und Szenen aus vergangenen Zeiten zeigten. Der Boden war mit schweren, weichen Teppichen ausgelegt, die jedem Schritt eine gedämpfte Eleganz verliehen.
Adalbert ging zu einem der massiven Schränke, die an der gegenüberliegenden Wand aufgereiht standen, und öffnete ihn. "Hier bewahrt der Burggraf seine Garderobe auf." sagte er und zog eine der Türen weit auf. Der Inhalt war beeindruckend: Reihen von feinster Kleidung hingen sorgsam sortiert, jede nach Art und Farbe geordnet. Samtjacken, Mäntel mit kunstvollen Stickereien, Hemden aus feinstem Leinen – alles in perfektem Zustand. Weiter unten standen glänzende Schuhe, jedes Paar mit Sorgfalt aufgereiht.
Adalbert wies auf ein Fach im oberen Bereich des Schranks, in dem mehrere kleine Schmuckkästchen lagen. "Dort bewahrt der Burggraf seinen Schmuck auf – Broschen, Ringe und dergleichen. Du wirst sie ihm reichen, wenn er danach verlangt aber sonst rührst du diese Schatullen nicht an." Maria nickte ehrfürchtig, während sie den Schrank betrachtete. Der Reichtum und die Sorgfalt, die hier zum Ausdruck kamen, waren überwältigend.
"Zu deinen Aufgaben wird es gehören..." fuhr Adalbert fort "...das Bett täglich frisch zu beziehen. Der Burggraf legt großen Wert darauf, in einem makellos vorbereiteten Bett zu schlafen. Außerdem wirst du seine Wäsche waschen, falten und wieder an ihren Platz legen. Es versteht sich von selbst, dass der gesamte Raum sauber und ordentlich gehalten werden muss. Kein Staub auf den Möbeln, kein Schmutz auf den Teppichen."
Adalbert schloss die Schranktüren mit einem leisen Klick und wandte sich Maria zu. "Es mag dir nach viel Arbeit klingen, doch keine Sorge! Der Burggraf wird schon bald einen weiteren Kammerdiener einstellen, der dich unterstützen wird." Maria nickte langsam. Sie spürte den wachsenden Druck der Verantwortung, aber auch eine leise Zufriedenheit darüber, dass man ihr diese wichtige Aufgabe zugetraut hatte. "Ich werde mein Bestes geben!" sagte sie mit leiser Stimme. "Gut!" erwiderte Adalbert knapp. "Wir haben noch einen Raum vor uns."
Adalbert führte Maria zurück auf den Flur, bis sie vor einer schweren Holztür stehenblieben. Er zog einen Schlüssel aus seiner Tasche und drehte ihn im Schloss. Mit einem leisen Knarzen öffnete sich die Tür zum Arbeitszimmer des Burggrafen. "Das ist das Herzstück seiner Arbeit." erklärte Adalbert mit einer Spur von Nachdruck in seiner Stimme. Er trat ein, und Maria folgte ihm vorsichtig.
Der Raum war beeindruckend und von einem Hauch erhabener Macht erfüllt. Inmitten des Raumes stand ein großer Schreibtisch aus dunklem Holz, dessen Oberfläche mit feinen Gravuren verziert war. Dahinter erhob sich ein hohes Bücherregal, prall gefüllt mit Bänden in ledernen Einbänden, manche mit goldenen Prägungen verziert. Zu beiden Seiten des Regals standen Ritterrüstungen, als würden sie den Burggrafen bewachen.
"Hier ist absolute Ordnung geboten." begann Adalbert und wies mit einer Hand auf die Regale und den Boden. "Zu deinen Aufgaben gehört es, diesen Raum regelmäßig zu reinigen. Kein Staub auf den Regalen, keine Unordnung auf den Möbeln. Aber merke dir eines: Sollten sich Unterlagen auf dem Schreibtisch befinden, rührst du ihn nicht an. Du befreist ihn nicht von Staub, du räumst die Unterlagen nicht zur Seite oder rückst sie gerade. Der Schreibtisch bleibt so, wie ihn der Burggraf verlassen hat." Maria nickte. "Ja, Herr Adalbert."
Adalbert sah sie streng an. "Und ich erwarte, dass du niemals, unter keinen Umständen, versuchst, die Dokumente zu lesen. Diskretion ist hier oberstes Gebot. Alles, was du siehst oder hörst, bleibt hier. Ist das klar?"
"Ja, ich verstehe." antwortete Maria mit ernster Stimme. Adalbert schritt zum Schreibtisch und klopfte leicht mit den Knöcheln auf die massive Platte. "Wenn der Burggraf hier arbeitet, wirst du in der Nähe bleiben. Es kann vorkommen, dass er dich ruft, um ihm Schreibfedern, Tinte oder frisches Pergament zu bringen. Du wirst dabei unauffällig und leise sein, als wärst du gar nicht da."
Adalbert ging zurück zur Tür und bedeutete Maria mit einer Handbewegung, ihm zu folgen. Bevor er die Tür schloss, hielt er inne. "Den Zugang zum Arbeitszimmer werde ich dir gewähren, später wird das die Aufgabe des Kammerdieners sein. Niemals wird ein Diener allein im Arbeitszimmer anzutreffen sein."
"Ja, Herr Adalbert." sagte Maria und blickte noch einmal zurück in den Raum, bevor die Tür mit einem leisen Klicken ins Schloss fiel. "Gut! Sehr gut!" erwiderte Adalbert. "Das war der letzte Raum, den du dir merken musst. Ab jetzt liegt es an dir, diesen Standard aufrechtzuerhalten." Dann zog Adalbert ein kleines Bündel Schlüssel aus der Tasche. Mit ernster Miene wandte er sich zu Maria.
"Es gibt noch etwas, das ich dir anvertrauen muss." begann er und löste einen Schlüssel vom Bund. "Ab heute wirst du diesen bei dir tragen. Dieser Schlüssel..." erklärte er, während er einen schlichten bronzenen Schlüssel hochhielt "...öffnet die Tür, die zur obersten Etage und damit zu den Privatgemächern führt. Ohne ihn hat niemand Zutritt außer dem Burggrafen, seine Leibwache und mir." Er reichte Maria den Schlüssel und hielt kurz inne, um sicherzustellen, dass sie die Bedeutung seiner Worte verstand. "Verlierst du diesen Schlüssel oder gelangt er in die falschen Hände, wäre das ein schwerwiegender Verstoß. Bewahre ihn also gut auf und lasse sie nie unbeaufsichtigt."
Maria nickte ernst und steckte den Schlüssel in eine kleine, eingenähte Tasche ihres Dienstgewandes. "Ich werde sie sicher verwahren, Herr Adalbert."
Maximus
Geändert von Maximus (18.01.2025 um 12:46 Uhr)
-
»Wie kann ich dem Sog der Wirklichkeit besser widerstehen?«, fragte er seinen Vater, der sich in Form einer zusammengerollten Katze auf seinem Tisch ausgerollt hatte. Sie befanden sich wieder in der astralen Sphäre und Saraliel saß in Eulenform auf seinem eigenen Stuhl und betrachtete seinen eigenen Körper. Waren seine Ohren wirklich so spitz wie er sie jetzt wahrnahm? Manche Dinge an sich selbst wollte man vielleicht gar nicht so gerne sehen.
»Du musst dich von deinen Gedanken lösen und auf den Atem vertrauen«, entgegnete Arion mysteriös.
»Meditieren meinst du«
»Das mag einer der Wege sein. Du kannst auch hier in der astralen Ebene genug Frieden finden«
»Hmm«, meinte der hohe Feuermagier nachdenklich und drehte einmal seinen Kopf im Kreis. Das Gefühl war gruselig und belustigend zugleich.
»Warum willst du denn unbedingt zurück?«
»Nun, weil mein Leben hier spielt. Es wäre wohl falsch dem entfliehen zu wollen«
»Willst du denn fliehen?«
»Hmm. Manchmal schon. Wenn es mir hier nicht sonderlich gut geht, habe ich schon den Drang in die astrale Welt zu gleiten. Hier scheint es mir beständiger zu sein«
»Und wenn du gehst verschwinden deine Probleme?«
»Natürlich nicht«, grummelte die Eule. »Sie bleiben da«
»Dann wäre es doch besser sie einfach anzunehmen oder?«
»Das scheint mir nun nicht die einfachste Übung zu sein«
Beide lachten.
Einige Zeit später saß Saraliel wieder mit vollem Bewusstsein in seinem Sessel. Er stand auf, räumte etwas auf dem Boden weg und setze sich dann so aufrecht wie möglich in den Schneidersitz. »Nur auf den Atem achten. Alles andere kommt und geht. Kommt und geht«. Es kamen viele Gedanken und Gefühle - nur gehen wollten die wenigsten davon. Bei der obersten Magierin hatte es so leicht ausgesehen. Sie meditierte und es klappte einfach. Doch bei ihm war es hart. Schwerste Arbeit. Seine Gedanken nur kommen und gehen zu lassen. Sie zu beobachten ohne mit ihnen in Interaktion zu treten war das schwierigste was er bisher getan hatte. Selbst die Qualen die er von dem Orkschamanen hatte ertragen müssen schienen im Vergleich zu dieser Tortur vernachlässigbar. Seufzend stellte er sich der Herausforderung dennoch.
-
 Lehrling
Lehrling

Die Hafenkneipe
Die Nacht hatte sich wie ein dicker Schleier über das Hafenviertel gelegt, die Luft kühl und erfüllt vom salzigen Duft des Meeres. Athera bewegte sich mit schnellen, festen Schritten durch die schmalen, beleuchteten Gassen, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Vitus folgte ihr knapp, sein Blick prüfte jede Bewegung um sie herum. Das Hafenviertel war ruhig, aber in dieser Stille lag etwas Unausgesprochenes, eine Erwartung.
Die Hafenkneipe war von weitem zu erkennen, das Licht ihrer Laternen warf einen flackernden Schein auf die Kopfsteinpflaster. Athera hatte ihren Soldaten präzise Anweisungen gegeben: Gideon beobachtete aus einer angrenzenden Seitengasse die Zugänge, Nicolas hielt sich im Inneren der Kneipe auf und würde sich unauffällig unter die Gäste mischen. Silas und Miguel hatten strategische Positionen in der Nähe des Hintereingangs eingenommen. Chesta war nicht weit entfernt, bereit, falls Verstärkung benötigt wurde.
Athera betrat die Kneipe ohne zu zögern. Der Raum war stickig und erfüllt vom Lärm der trinkenden Männer. Ihre Präsenz wurde von einigen Gästen wahrgenommen, die Blicke blieben jedoch nicht lange auf ihr haften. Sie war inzwischen eine vertraute Figur im Hafenviertel, doch ihre Autorität ließ sie weiterhin aus der Masse hervorstechen. Vitus blieb an der Tür stehen und ließ seinen Blick durch den Raum wandern.
Am hinteren Ende der Kneipe, in einer abgedunkelten Nische, saß ein Mann, der offensichtlich auf sie wartete. Sein feiner Mantel und die ruhige, kontrollierte Haltung verrieten, dass er nicht zu den üblichen Gästen gehörte. Neben ihm standen zwei weitere Männer, die ihm Schutz zu bieten schienen.
Athera näherte sich mit unbeirrtem Schritt. Sie zog sich einen Stuhl heran und setzte sich ohne Umschweife dem Mann gegenüber. Die Anspannung zwischen den beiden Parteien war spürbar, doch Athera ließ sich davon nicht beeindrucken.
"Ihr seid also die Kontaktperson?" fragte sie ruhig, ihre Stimme fest und klar.
Der Mann musterte sie mit einem leicht amüsierten Ausdruck. "Ich bin jemand, der Antworten sucht. Und ihr seid jemand, der mir etwas zu bieten hat. Also ja – wenn ihr wollt."
Athera lehnte sich leicht nach vorn, ihre Bewegungen kontrolliert, als sie das Gespräch eröffnete. Vitus blieb in ihrer Nähe, sein Blick unablässig auf die Szene gerichtet. Draußen hielten ihre Soldaten weiterhin die Umgebung im Blick, bereit, falls die Situation eskalieren sollte.
Der Mann musterte Athera mit sichtlichem Interesse, ein leichtes Lächeln umspielte seine Lippen. "Ich muss sagen..." begann er, seine Stimme ruhig und von einer gewissen Neugier durchzogen, "...ich habe nicht damit gerechnet, dass ich hier einer Frau gegenüber sitzen würde." Athera erwiderte seinen Blick ohne eine Regung. Sie wartete, bis er sich selbst weiter entfaltete.
"Rogwin." stellte er sich schließlich vor, während er sich leicht zurücklehnte und einen Finger auf den Rand seines Weinglases tippte. "Und wie ist Euer Name?"
"Den werdet Ihr schon noch früh genug erfahren!" erwiderte Athera knapp, ihre Stimme klar und sachlich. Rogwin lachte leise, offenbar wenig beeindruckt von ihrer knappen Art. "Nun gut. Ich habe gehört, dass es kürzlich in einem Lagerhaus eines hiesigen Händlers... nennen wir es, ungewöhnliche Vorgänge gab." Sein Blick wurde schärfer. "Es wurde vollständig leergeräumt ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen. Eine saubere Arbeit, wenn ich das so sagen darf. Respektabel." Athera nickte kaum merklich, ohne eine Reaktion auf das Lob zu zeigen.
Rogwin nahm einen Schluck aus seinem Weinglas und betrachtete Athera mit einem Blick, der zwischen Neugier und Berechnung schwankte. "Ihr müsst wissen..." begann er schließlich, "...dass es Menschen gibt, die ein gewisses Interesse an solchen... besonderen Waren hegen. Menschen, die ein Auge für Qualität haben und die richtigen Mittel, um das Potenzial solcher Gelegenheiten voll auszuschöpfen."
Er ließ die Worte einen Moment im Raum hängen, als wolle er die Wirkung auf Athera prüfen. Ihre Haltung blieb unverändert, aufmerksam, aber ohne die geringste Spur von Ungeduld oder Emotion.
"Meine Auftraggeber..." fuhr er fort, seine Stimme nun leiser und einen Hauch vertraulicher, "...sind stets auf der Suche nach verlässlichen Partnern. Partnern, die nicht nur das Richtige beschaffen können, sondern auch diskret genug sind, um die Waren unbemerkt dorthin zu bringen, wo sie am meisten geschätzt werden."
Rogwin lehnte sich zurück, das Glas noch in der Hand, und ließ seinen Blick kurz durch die Kneipe schweifen, als wolle er sichergehen, dass niemand lauschte. Dann sah er wieder zu Athera. "Es wäre ein Geschäft mit großem Potenzial. Vorausgesetzt natürlich, der Lieferant versteht es, sich anzupassen und den richtigen Eindruck zu hinterlassen."
Seine Worte waren bedacht gewählt, jedes Detail schien er bewusst offen zu lassen, als wolle er Athera zu einer Reaktion herausfordern. Doch sie blieb still, ließ ihn ausreden und hielt seinen Blick mit unerschütterlicher Ruhe. Rogwin räusperte sich, seine Unzufriedenheit über die Unnahbarkeit seines Gegenübers war kaum zu übersehen. Er zog ein Pergament aus seiner Tasche und schob es zu Athera. "Diesen Preis sind wir bereit zu zahlen und die Skizze zeigt ein Lagerhaus im Hafenviertel, zu dem Ihr eine Kiste liefern sollt. Wenn wir zufrieden sind mit dem, was wir erhalten, werden wir auf Euch zurückkommen und gewiss auch den Rest kaufen."
Athera faltete das Pergament auf. Das Angebot lag weit unter dem Marktwert der Ware und doch willigte sie ein. Das ganze Unterfangen war nur Mittel zum Zweck, um die Hintermänner auszumachen und zu beseitigen. Da spielte es keine Rolle, wenn sie von Rogwin offensichtlich über den Tisch gezogen wurde. "Ihr bekommt Eure Ware - noch heute Abend." erwiderte sie knapp und erhob sich. "Ich erwarte bis zur nächsten Mittagssonne eine Nachricht von Euren Auftraggebern oder der Handel ist geplatzt."
Rogwin nickte zufrieden, hob das Weinglas und verabschiedete sich mit einem selbstgefälligen Grinsen. Er schien zu glauben, die Zügel in der Hand zu halten und doch war er der Gaul, der den Wagen langsam in Richtung Abgrund zog.
Geändert von Athera (10.12.2024 um 20:50 Uhr)
-
Hafenkneipe
„Ich habe eine Passage nach Gorthar gefunden.“
Der Hüne ließ sich auf den Stuhl fallen, dass das Holz nur so knarrte und knarzte. Er langte nach dem Bierkrug, den Heric und Qarrah in weiser Voraussicht bestellt hatten. Dabei konnte der junge Mann aus Schwarzwasser es nicht wirklich unterlassen, den Kopf des Nordmannes anzustarren. Das lange rote Haar mit dem grauen Ansatz war verschwunden, abgeschoren wie bei einem Aussätzigen. Nur der Bart war geblieben, wenn auch getrimmt. Wo zuvor das Aussehen eines nordmarischen Berserkers gewesen war, herrschte nun der Eindruck eines zwar immer noch nordmarischen Gewalttäters vor, jedoch nicht mehr ganz so wild. Ragnar grinste und genehmigte sich einen Schluck, ehe er den Krug auf die nicht mehr ganz so frische und saubere Holzplatte absetzte.
„Gibt aber einen Haken an der Sache.“
Qarrah seufzte, trank einen Schluck aus ihrem Becher, der mit Wasser gestreckten Wein enthielt. „Das war ja klar.“
Der Hüne hob die Schultern und fuhr fort: „Das Schiff legt erst in vier Tagen ab. Ist ein Überseehändler, der den bürokratischen Wahnsinn macht, als Bewohner des Herzogtums mit dem Großreich Handel zu treiben. Anstatt sich auf dem konventionellen Schlachtfeld zu begegnen – Schwert, Schild, Axt – begegnen sich diese beiden Mächte auf die Art, die diese Hofschranzen in Vengard so lieben. Mit Briefen, Einfuhrzöllen und goldenen Münzen.“
„Also bleiben wir vier Tage in Thorniara“, überlegte Heric laut und rieb sich das Kinn. „Ragnar, ich seh’s dir an, du hast noch etwas …“
Der Hüne verzog das Gesicht, als müsste er eine Niederlage eingestehen. „Hat verdammt viel verlangt, der Hurenbock. Einen Großteil unserer Ersparnisse.“
Die Silberzunge seufzte, als hätte er damit gerechnet. „Man könnte meinen, in dieser Stadt der Ideale Innos‘ herrscht sowas wie Nächstenliebe.“ Er machte eine wegwerfende Handbewegung. „Aber nun, was soll’s. Dein ‚alter Kamerad der Torwache‘ hat schon viel genommen, Qarrahs ‚Vetter zweiten Grades, der Fälscher ist‘ ebenso. Vielleicht treffe ich noch einen alten, zwielichtigen Bekannten, der für sein Dienste Unsummen nimmt.“
„Nun“, begann Qarrah, „zumindest bei unserem ehemals langhaarigen Freund hier müssen wir aufpassen.“
„Wieso?“, knurrte Ragnar und funkelte sie böse an. Die Varanterin ließ sich den Einschüchterungsversuch nicht gefallen, stellte grob den Becher ab und beugte sich vor.
„Wieso?!“, fuhr sie ihn zischend an, „Weil du eine verfluchte Zielscheibe bist, Ragnar. Ja, die Haare sind ab, hurra. Aber die Aktion mit der Torwache: Wieso? Wenn der dich so lange kennt, ist ihm deine Visage bekannt, Haare hin oder her. Was hält ihn davon ab, dich – uns! – zu verpfeifen?“ Sie hob den Zeigefinger, gefolgt vom Mittelfinger.
„Dann das kleine, unwichtige Detail, dass du vor einiger Zeit im beschissenen Armenviertel einen lokalen Verbrecherboss gegen dich aufgebracht hast und seine Lakaien so arg vermöbelt hast, dass zwei immer noch im Tempel kurieren müssen!“
„Qarrah!“, unterbrach Heric sie, nicht unhöflich, aber entschieden. „Mäßige dich. Du bist zu laut.“
Der Blick ihrer dunklen Augen bohrte sich in den Schwarzwässer Jung. Der schüttelte unmerklich den Kopf. Die junge Frau seufzte entnervt, fuhr dann ruhiger fort: „Zumindest vonseiten der Verbrecher droht Ungemach. Vier Tage, sagst du? Vier Tage, die diese Schweinepriester nutzen können, sich zu revanchieren.“
Heric erinnerte sich an seine erste Begegnung mit Ragnar. Die Art, wie er wie ein todbringender Wirbelsturm über die Schlägertypen gekommen war und Gewalt ausgestrahlt hat wie die Sonne am Himmel Wärme. Nochmal wollte er das nicht erleben. Und den Kerlen aus dem Armenviertel traute er leider Lernfähigkeit zu.
„Dann halten wir uns bedeckt?“, fragte er. Ragnar schnaubte.
„Feige.“
„Besser als der Kerker, du Idiot.“
„Sollen wir uns wie Kakerlaken unterm Müll verstecken, du Schnepfe?“
„Götter, seid beide ruhig! Ich mache mich auf die Suche nach einer Bleibe. Eure Gesichter sind hier scheinbar bekannter als meines. Bleibt hier, trinkt etwas, lernt euch kennen oder geigt euch gegenseitig die Meinung, mir egal.“
Heric erhob sich und sah die beiden Älteren an. „Ich wäre wahrscheinlich erfolgreicher, würde ich nach Gorthar schwimmen und Barenzia zum Duell mit dem Degen herausfordern. Aber da das nicht geht, muss ich mich mit dem abfinden, was die Götter mir gelassen haben …“ Er grinste beide an. „… meinem Einfallsreichtum!“
Und so ließ er sie zurück, geblendet von einem Selbstvertrauen, das nur in den Tod münden konnte.
Geändert von Heric (12.12.2024 um 19:23 Uhr)
-
Nienor schritt durch den Stall, in dem die Pferde des Ordens untergerbracht waren. Zumindest diejenigen, die die meist höherrangigen Ordensleute nicht in ihren eigenen Anwesen stehen hatten. Sie hatte sich schon einige angeschaut. Es gab die Pferde für Patrouillenaufgaben, das waren genügsame Tiere, keine speziellen Züchtungen, sie mussten nur ausdauernd sein, jedoch nicht unbedingt schnell und gutmütig, um auch ungeübte Reiter nicht vor Schwierigkeiten zu stellen. Daneben gab ein ein paar wenige schnelle Tiere. Sie waren für berittene Boten gedacht, wurden hier auf Argaan kaum benötigt, denn wohin hätten sie schon reiten sollen, wenn kurz außerhalb der Stadt schon das Territorium, das Myrtana beherrschte, endete? Manchmal machten sich einige Soldaten einen Spaß daraus und trugen kleine Wettrennen in der Arena aus, die direkt neben den Ställen lag, nur um die Pferde regelmäßig zu bewegen.
Einige Tiere waren auch als Passgänger ausgebildet und dienten als normale Reisepferde. Und dann gab es noch die Schlachtrösser, die einige ihrer Besitzer hier gegen Entgelt in Pflege gegeben hatten. Dort stand auch Zephir, den Nienor regelmäßig besuchte. Doch Pferde, wie sie in den Schriften über die Reiterbogenschützen beschrieben worden waren - die gab es hier nirgends. Wendige, flinke und ausdauernde Pferde. Vermutlich mussten sie auch genügsam sein, wenn sie ihren Besitzern in trockene Steppen folgten. Warum sollte der Orden solche Pferde auch besitzen? Schließlich entsprach das, was Nienor vor hatte, überhaupt nicht den Vorstellungen von einem Kampf, wie sie in Myrtana und Argaan herrschten. Myrtanische Reiterabteilungen, die den Feind unablässig umkreisten und mit Pfeilsalven eindeckten? Eine seltsame Vorstellung. Ein solches Pferd musste sie woanders finden. Nienor überlegte, ob es sich lohnen würde, sich auf die Suche danach zu begeben. Vielleicht. Doch zuallererst musste sie überhaupt einmal einige Sicherheit im Umgang mit dem Kurzbogen vom Pferd aus erlangen. Da war es egal, ob das Tier unter ihr eine besondere Züchtung war oder nicht. Sie musste vor allem ein Gefühl für das Steuern ohne Zügel bekommen und sich daran gewöhnen, den Oberkörper vom Auf und Ab des Pferderückens zu entkoppeln, um ruhig zielen zu können. Sie suchte sich eins der Patrouillenpferde aus und ließ es von einem Stallknecht vorbereiten.
Als er seine Arbeit beendet hatte, schwang sie sich in den Sattel und ließ es mit einem Schenkeldruck im Schritt einen Steinwurf weiter in die Arena laufen. Das Pferd war gut ausgebildet und verstand problemlos die Schenkelhilfen für den Gang. In der Arena angekommen, ließ sie es fürs Erste im Trab im Kreis an der Bande entlang laufen und versuchte dann, allein mit dem Druck ihrer Schenkel Richtungsänderungen aus dem Kreis heraus zu bewirken, indem sie sie entsprechend verschob. Doch damit erreichte sie kaum einen Effekt. Nienor versuchte es mit der Änderung des Gewichts auf die eine oder andere Seite, aber das Pferd verstand weiterhin nicht so recht, was damit gemeint war. Sie beschloss, anstatt sich mit dem Pferd zu beschäftigen, sich lieber auf das Bogenschießen zu konzentrieren. Es würde sowieso immer an der Bande entlang im Kreis laufen.
In der Mitte der Arena war ein dicker Pfahl in den Sand gerammt. Die Kriegerin beschloss, ihn als Ziel anzusehen. Sie fasste den Kurzbogen, holte einen Pfeil aus dem Köcher, den sie vorher am Sattel befestigt hatte und legte an. Der Schuss ging weit daneben. Leider. Sie versuchte es erneut. Nicht viel besser. So verschoss sie nach und nach all ihre Pfeile, nur um am Ende keinen wirklichen Fortschritt erreicht zu haben. Nienor ließ das Pferd wieder zurück in den Schritt fallen und hielt dann an, um abzusteigen und die im Arenarund verstreuten Pfeile wieder einzusammeln. Wieder im Sattel probierte sie, aus dem Stand zu treffen. Nur so zur Sicherheit. Das war kein großes Problem. Die Arena war nicht sonderlich groß und die Entfernung zum Pfahl betrug nicht viel mehr als vielleicht 30 Schritt. Es war zwar ungewohnt, zum einen mit dem Kurzbogen - die Sehne musste viel weiter gezogen werden, um den Pfeil entsprechend auflegen zu können - und zum anderen im Sitzen zu schießen, aber das war reine Gewöhnungssache.
Nun probierte sie es im Schritt. Mit ein wenig Schenkelhilfe verstand der Braune, was von ihm erwartet wurde und setzt sich wieder in Bewegung. Nienor konzentrierte sich darauf, möglichst gleichmäßig zu sitzen und die Bewegungen des Pferdes dadurch zu kompensieren. Das Ergebnis ordnete sie selbstkritisch als Katastrophe ein. Auf die Art konnte sie weder richtig reiten noch in Ruhe zielen. Es musste irgendwie ganz anders angegangen werden. Sie beschloss, das Training für heute zu beenden und darüber nachzudenken, was sie noch variieren konnte, um irgendeinen Fortschritt zu erzielen. Nachdem wieder alle Pfeile eingesammelt waren, gab sie das Pferd mit Dank wieder ab und verließ den Bereich der Ställe.
-
Marktschänke
Der Kommandant hatte schon fast vergessen wie laut und stickig es in der Stadt war, dementsprechend hielt sich seine Freude darüber, wieder hier zu sein, doch arg in Grenzen. Sicher sehnte auch er sich, wie alle Männer aus der Truppe, nach einem ausgiebigem Bad, einer köstlichen Mahlzeit und natürlich auch nach dem ein oder anderen Paladiner. Das waren aber auch schon alle Vorteile die Ulrich spontan einfielen, was es an Vorzügen hatte, wieder in Thorniara zu sein. Unter dem Strich etwas dürftig, seiner Meinung nach, aber wenn er sich so umschaute und sah das sich die Männer prächtig amüsierten, musste er einräumen, das er mit dieser Meinung recht allein auf weiter Flur war, vermutlich zurecht. Es wäre wohl das Klügste, wenn sich der Kommandant einfach mit den Gegebenheiten abfindet und das Beste draus macht, alles andere würde wenig Sinn ergeben.
Trotz guter Vorsätze dauerte es eine Weile, bis sich der Kommandant an den Lärm in der Taverne und den Trubel um sich herum, einigermaßen gewöhnt und seine innere Anspannung sich etwas gelegt hatte. Nach einem weiteren Paladiner und dem Verzehr eines köstlichen Schweinebratens, von wohlfühlen konnte zwar noch keine Rede sein, zumindest war Ulrich für den Augenblick recht zufrieden, ein Fortschritt in die richtige Richtung. Während der Paladin auf das nächste Bier wartete, beobachtete er seine Männer, sie unterhielten sich angeregt, sie lachten, sie grölten, kaum zu glauben, das diese ansonsten eher schweigsamen, äußerst disziplinierten Kerle, so aus sich heraus gehen konnten. Für einen Augenblick beneidete Ulrich seine Männer für die Fähigkeit, die Strapazen der Erkundungsmission einfach so hinter sich zu lassen und sich an Kleinigkeiten zu erfreuen. Er selbst war nicht der Typ dafür, besser gesagt nicht mehr, früher konnte er das, aber als Kommandant mit viel Verantwortung, war ihm die benötigte Lockerheit wohl abhanden gekommen.
Während die Bedienung mit seinem Paladiner auf ihn zusteuerte, bemerkte Ulrich, das Jacques ihn im Blick hatte, er winkte den Jüngling kurzerhand zu sich. „Setz dich, wir sollten mal über deine Zukunft sprechen“ brummte der Kommandant, Jacques folgte seiner Anweisung. „Du hast es in der Armee bis zum Gardisten gebracht..., Respekt..., dir stehen nun verschiedene Wege offen und du musst entscheiden in welche Richtung du gehen willst“, begann der Paladin. „Du kannst dir einen bequemen Posten in der Verwaltung suchen, zum Beispiel als Lagermeister für Proviant oder als Zeugwart in der Waffenkammer. Die weiteren Aufstiegschancen sind bei solchen Posten allerdings äußerst gering“ erklärte Ulrich. „Wenn du mehr Verantwortung suchst, dann wäre Wachoffizier werden vielleicht eine gute Wahl. Für die Sicherheit der Stadt sorgen, ist eine herausfordernde Aufgabe, Ausbildung der Rekruten, Planung, Organisation usw. Allerdings mit der Zeit auch sehr eintönig, um irgendwann Ritter zu werden, nicht unbedingt das beste Sprungbett“ gab der Paladin zu bedenken.
„Wenn du bereit bist mehr Risiko zu wagen, echte Herausforderungen suchst, bereit bist im Zweifel dein Leben zu opfern, dann wäre der Dienst unter meinem Kommando eine gute Option. Wie du vielleicht inzwischen bemerkt hast, befehlige ich eine Sondereinheit für spezielle, teils streng geheime Einsätze. Das ist auch der Grund, warum wir innerhalb der Truppe keine offiziellen Rüstungen tragen..., du verstehst?, erwähnte der Kommandant augenzwinkernd. „Jedenfalls sind das so grob die Möglichkeiten, die du hast, nach was steht dir der Sinn? Eher belangloser Soldat, der nicht viel zu sagen hat, das passt eigentlich nicht zu dir. Oder eifriger Soldat der Verantwortung sucht und gerne Leute herumkommandiert, das kann ich mir schon eher bei dir vorstellen. Oder pflichtbewusster Soldat, der aus innerer Überzeugung für das Gute kämpfen und das Böse besiegen will und jede Gelegenheit nutzen möchte, dies zu beweisen?“ schloss Ulrich seinen kleinen Vortrag ab. „Lass dir das in Ruhe durch den Kopf gehen und dann entscheide dich für einen Weg..., falls du noch Fragen dazu hast, nur zu“...
-
In der Marktschänke mit Ulrich und den Roten Adlern
Obwohl Jacques nach dem vierten Paladiner bereits merkte, wie ihm der Alkohol langsam zu Kopf zu steigen begann, konzentrierte er sich mit ernster Miene darauf, was Ulrich ihm zu sagen hatte. Als der Kommandant zu Ende gesprochen hatte, sah Jacques ihm selbstbewusst in die Augen.
„Sir, das ist keine Frage, über die ich lange nachdenken muss. Ich bin mit dem Wunsch nach Thorniara gekommen, Ritter zu werden, aber meine Motive waren dumm und einfältig. Es waren romantische Heldengeschichten, Romane und Märchenerzählungen, die mich dazu anspornten. Es war dumm, und ich weiß inzwischen, wie wenig all diese Geschichten mit der Wirklichkeit zu tun haben. Dass Kämpfe meist wenig Glorie mit sich bringen, dafür aber umso mehr Blut, Dreck, Schmerz und Leid – selbst dann, wenn man gewinnt. Ja, manche Krieger werden noch Generationen nach ihrem Tod in Liedern besungen, aber auf jeden einzelnen von ihnen kommen wahrscheinlich Tausende und Abertausende Soldaten, die auf dem Schlachtfeld den Tod finden und deren Namen nicht einmal ihre eigenen Waffenbrüder kannten. Und selbst diejenigen, die überleben, werden für immer vom Dämon des Krieges besessen sein, der sie in stillen Augenblicken und selbst im Schlaf heimsucht …“
Jacques‘ Blick wurde nachdenklich, und er schwieg für einige Augenblicke, bevor er mit erneuerter Entschlossenheit die Schultern straffte und fortfuhr: „Aber, Sir, ich habe auch gelernt, warum es Männer und Frauen geben muss, die all das auf sich nehmen: Weil die Welt voller Gefahren ist für diejenigen, die sich nicht selbst verteidigen können. Gefahren, die offensichtlich sind, und solche, von denen die meisten Menschen nicht einmal ahnen würden, dass es sie gibt, und doch lauern sie in den finsteren Ecken der Welt und warten nur darauf, zuzuschlagen. Was wäre aus dem kleinen Mädchen vom Pferdehof geworden, wenn Sunder und ich nicht zur Stelle gewesen wären? Welchen Schaden hätten die Mächte anrichten können, denen wir im und unter dem Gebirge begegnet sind? Und wer sollte die Menschen dieser Stadt vor den Echsenmenschen, den Orks oder gar noch Schlimmerem beschützen? Nur dank Leuten wie Euch und euren Männern, die ihr eigenes Leben opfern, indem sie es dem Schutz der Schwachen widmen, können die einfachen Bauern und Bürger in Frieden leben, ihre Felder bestellen, ihrem Handwerk nachgehen, Handel treiben, musizieren, feiern … leben, ohne sich Sorgen darüber machen zu müssen, dass in jedem Schatten das Böse in einer seiner unzähligen Gestalten lauern könnte.“ Jacques musste an Chala und ihre furchtbare Weltsicht denken – Chala, die nichts und niemandem traute, womit sie sich selbst zu einem Leben in Furcht und Paranoia verdammte, was sie mit Unabhängigkeit und Stärke verwechselte. „Meine Prioritäten haben sich geändert. Ich will nicht mehr Ritter werden – jedenfalls, nicht an erster Stelle. Nein, ich will … ein Beschützer sein. Ein Verteidiger. Welche Bedeutung haben schon Titel? Nein, ich will zu denen gehören, die die Last des Kampfes auf sich nehmen, damit diejenigen, die dafür nicht stark genug sind, in Frieden und ohne Angst leben können. Das ist es, was ich will. Und dafür kommt nur ein Weg in Frage.“ Jacques legte eine kurze Pause ein, sah Ulrich ernst an und senkte dann respektvoll den Kopf: „Sir, es wäre mir eine außerordentlich große Ehre, wenn ich weiterhin unter Eurem Kommando dienen dürfte!“
-
Agénor de Bracy hatte Nienor eine Nachricht zukommen lassen. Er fragte nach einem erneuten Treffen und schrieb, dass ihm die Übung auch selbst gut getan hätte und er sich freuen würde, es auf einen zweiten Versuch ankommen zu lassen. Trotz der Verletzungen, die sie beim ersten Mal davon getragen hatte, war Nienor geneigt, dem zuzustimmen. Wie sollte sie auch sonst lernen? Und sie musste zugeben, dass ihr schon die erste Lektion viel darüber gezeigt hatte, wo ihre Schwächen im Kampf zu Pferde lagen. Sie beschied de Bracy also, gerne anzunehmen und am vereinbarten Tage begab sie sich wieder zu den Ställen des Ordens, um Zephir vorbereiten zu lassen.
De Bracy war auch schon zugegen und wirkte sichtlich zufrieden, sie zu sehen.
»Ich muss gestehen, dass mir unsere Übung neulich wirklich gefallen hat«, freute er sich.
»Aber ich muss auch zugeben, dass Ihr mich dabei arg lädiert habt. Ihr werdet also verzeihen, dass ich so lange wartete, bis ich wieder von mir hören ließ.«
Nienor lachte.
»Mir ging es doch genauso. Ich habe mich einige Wochen auskuriert, denn Ihr habt recht erbarmungslos zugeschlagen.«
Es beruhigte sie, dass es ihm genauso gegangen war wie ihr.
»Ich schlage deshalb heute das Schwert vor, es hat weniger Wucht als ein Streitkolben und außerdem fechte ich lieber als nur zuzudreschen«, meinte de Bracy dann.
Nienor war's recht.
Und so begaben sie sich, sobald ihnen ihre gerüsteten Schlachtrösser gebracht wurden und sie mit Hilfe der Stallknechte aufgestiegen waren, gemeinsam zur Arena, um in ihrem Sand einen weiteren Übungskampf zu absolvieren. Nienor fasste den Schild mit ihrem Familienwappen fester und gab Zephir über Schenkeldruck die Anweisung, voran zu galoppieren. Der Schimmel setzte sich in Bewegung und erreichte bald den Galopp. Durch den schweren Rossharnisch war alles ein wenig verzögert, aber an das Tragen des zusätzlichen Gewichtes war Zephir gewöhnt und er stammte immerhin aus der königlichen Zucht Haruthars mit einer langen Linie von Pferden, die allein zum Zwecke des Kampfes erzogen worden waren. Könige, Prinzen, Heermeister und die Marschälle der verschiedenen Orden ritten auf solchen Pferden, während sich normale Ritter für gewöhnlich mit Schlachtrössern aus weniger edlen Zuchten begnügen mussten. Schon allein, weil ihr Wert zu hoch für ihr von der Größe ihres Lehens bestimmtes Einkommen war.
Agénor ließ sich von Nienors ungestümen Angriff nicht überraschen und nutzte seinen Schild, um ihren ersten Ansturm abzuwehren, den diese aus der Geschwindigkeit des Galopps heraus anbrachte. Ihr Schwert traf nur den Schildrand de Bracys und hinterließ eine unbedeutende Kerbe unter vielen im gebördelten Eisenrand. Sie riss Zephir herum und ritt erneut gegen ihn an, um ihn gar nicht erst zur Ruhe kommen zu lassen. Mit dem schlechten Sichtfenster durch die schmalen Schlitze ihres Helms kam sie mittlerweile ein wenig besser zurecht. Vermutlich aus Gewöhnung. Ihr Atem floss von innen gegen das Eisen und prallte warm zurück in ihr Gesicht. Sie wollte es nun von unten versuchen, doch bemerkte noch rechtzeitig, dass de Bracy selber einen Angriff plante und riss ihren Schild gerade noch rechtzeitig hoch.
Nun verkeilten sich ihre Pferde fast ineinander und der Angriff wurde statischer. Wechselseitig hieben und stachen sie aufeinander ein, immer gegenseitig die Lücke in der Deckung ihres Gegners suchend und gleichzeitig den Schild in der anderen Hand möglichst günstig für die eigene Verteidigung platzierend. So wogte der Kampf eine Weile hin und her, bis sie sich wieder voneinander lösten. Nienor gab ein Zeichen für eine Pause und hob ihr Visier.
»Von allen Waffen auf dem Pferd scheint mir der Kampf mit dem Schwert für mich am besten zu gelingen«, stellte sie fest.
De Bracy stimmt ihr zu: »Zumindest muss ich sagen, Ihr seid ein ebenbürtiger Gegner. Welche Waffen beherrscht ihr außerdem?« fragte er dann.
Auch ihm kam die Kampfpause zupass, um wieder ein wenig zu Atem zu kommen und ohne das Visier zu atmen.
»Natürlich die Lanze, wobei ich damit noch viel Übung vom Ross aus brauche.«
»Dann solltet Ihr das aber auch zuförderst üben«, sagte er in gespielt strengem Tonfall.
»Mit dem Schwert habt Ihr jedenfalls keine großen Lücken - soweit ich das jetzt aus eigener Anschauung beurteilen kann.«
»Und dann wäre da noch der Bogen«, sprach Nienor ihr größtes Problemfeld an.
»Der Bogen?«, fragte Agénor verwundert.
»Wann hat man denn jemals einen Ritter mit dem Bogen kämpfen gesehen? Das wird doch allgemein als unritterlich angesehen.«
»Ich weiß«, stimmte ihm die Kriegerin zu.
»Aber man wird einen solchen Angreifer nicht damit abhalten, dass man ihn darüber aufklärt, dass er sich nicht gemäß dem Kodex verhält. Und außerdem habe ich es mir nun einmal in den Kopf gesetzt, dies zu erlernen. Auf meinen zwei Beinen bin ich eine sehr gute Schützin. Für die Jagd zu Fuß ist mein Langbogen ebenso ein guter Gefährte wie bei denjenigen Gelegenheiten, in denen ich im Kampf nicht auf meinen Schimmel zurückgreifen kann. Und da ich von fremden Völkern gelesen habe, die ganze Heere von berittenen Bogenschützen aufstellen, möchte ich mehr über ihre Kampfweise erfahren.«
»Dann würde ich einfach in die Ordensbibliothek gehen und hoffen, dort etwas darüber lesen zu können. Aber sicher wart Ihr dort schon?«, vermutete de Bracy.
»Das ist richtig. Und ich habe dort erfahren, dass für einen derartigen Kampfstil ein Schlachtross denkbar schlecht geeignet ist. Pferde für diesen Zweck müssen wendig und ausdauernd sein und man muss sie in jeder Lage nur mit Schenkeldruck reiten können, ganz ohne Zügel. Doch solche Pferde gibt es hier und in Myrtana nicht. Ich werde sie und am besten ihre Reiter woanders suchen müssen.«
»Das könnte sehr weit weg sein. Seid Ihr sicher, dass Ihr nur dafür eine sehr weite Reise unternehmen wollt?«
»Nein, ich überlege noch. Vielleicht fällt mir noch etwas ein.«
»Zerbrechen wir uns jetzt nicht den Kopf darüber«, schlug er vor. »Üben wir lieber noch eine Runde.«
Und so geschah es. Noch eine Weile versuchten sie, den jeweils anderen zu besiegen - oder doch wenigstens so zu treffen, dass er nicht mit seinem Schild Deckung suchen konnte. Irgendwann war es genug und beide beendeten das kleine Turnier.
»Ihr solltet unbedingt das Lanzenstechen üben«, meinte de Bracy am Ende noch zu ihr. »Vielleicht kommt es in Myrtana ja in Mode. Würde die Kultur ein wenig heben.«
Nienor ahnte, was er meinte. Im alten Reich von Setarrif waren Turniere zwischen den Rittern des Reiches und auch Fremden ein oft gesehenes Schauspiel gewesen. Die Myrtaner hingegen waren eher Fußsoldaten. Die berittene Kavallerie aus Panzerreitern war erst unter Rhobar I. eingeführt worden, als er Varant erobern wollte und den Varantern ebenbürtige Truppen benötigte und seitdem war sie nicht nur nicht fortentwickelt worden, sondern mangels passendem Gegner sogar fast wieder in Vergessenheit geraten. Gegen die Orks war der Nutzen eines gepanzerten Reiters eben nicht besonders hoch. Aber auf Argaan hätte eine derartige Armee in den intensiven Kämpfen der Anfangsjahre des Krieges sicher einen Unterschied gemacht.
-
Am nächsten Abend führte Nienor ihr Weg – sie konnte nicht sagen, warum – in eine der Schänken der Stadt. Ehe sie sich's versah, trat sie durch die Tür einer der Gasthäuser in der Nähe des Hafens. Warme, verbrauchte Luft schlug ihr entgegen. Rauch unterschiedlichster Sorten aus vielen Pfeifen hatte sich zu einer einzigartigen Melange vermischt, wie sie wohl in jeder Kneipe eine andere war. Der Kenner würde hieran sicher erkennen können, wo er war, würde man ihn mit verbundenen Augen hinein führen. Allgemeines Gemurmel erfüllte den Raum, hier und da von einem lauteren Wort oder Gelächter kurz übertönt, ehe die Geräusche wieder auf das allgemeine Lärmniveau zurück fielen. Grob gezimmerte Tische und einfache Stühle und Holzbänke bildeten das Mobiliar. Die Decke aus sich im Laufe der Jahre verzogenen Balken gezimmert hatte rauch und Dämpfe vieler Jahrzähnte in sich aufgesogen. Ab zwei Ketten ragte eine Art Meersungeheuer von den hohen Balken herab und thronte gewissermaßen über aller Köpfe: Ein Wesen, halb Mensch, halb Fisch, mit einem Gesicht wie mit einer Schweineschnauze und zwei großen Eberhauern, die aus dem Mund ragten, wirrem Haar, zwei Armen mit Händen, zwischen deren Fingern sich Fischhaut spannte und an den Hüften in einen grob geschuppten Fischwanz mit großer Flosse übergehend. Die Schuppen mochten einmal in allen Regenbogenfarben geleuchtet haben. Nun jedoch waren sie größtenteils stumpf und schwarz und nur an einigen Stellen konnte man die farbige Pracht noch schwach erahnen.
Die Ordensritterin war natürlich nicht gerüstet gekommen, so das sie nicht als Angehörige des myrtanischen Heeres erkannt wurde und auch keine Unruhe in diesem Bereich der Stadt auslöste. Niemand der Gäste blickte sich nach ihr um, denn dass jemand den Schankraum betrat, war nichts Ungewöhnliches. Doch sie musterte mit einem kurzen Blick, wie er ihr in ihren Patrouillen durch die Stadt schon längst in Fleisch und Blut übergegangen war, die Runde. Nienor sah mutmaßliche Hafenarbeiter, Handwerker, einige Seeleute, Reisende. Keine ungewöhnlichen Gäste. Vielleicht saß ja irgendwo ein finsterer Zirkel von Kultisten, doch wenn, dann waren sie gut als unauffällige Leute getarnt. Der recht absurde Gedanke, dass sich Mitglieder einer verschwörerischen Sekte, die irgendetwas Übles planten, für ihre Zusammenkunft nicht etwa einen geheimen Ort suchten ,wo sie ungestört waren, sondern ihre Pläne mitten in einem Gasthaus ausheckten und sich dazu als harmlose Arbeiter verkleideten, hatte etwas Komisches. Mögliche Mitglieder von Schmugglerbanden waren vielleicht tatsächlich hier, jedoch haten sie im Unauffälligsein üblicherweise viel Übung. Aber es war ihr auch egal. Sie war nicht im Dienst und was die Gäste hier anstellten, war jetzt ohne Belang. Letztendlich gingen Nienor die Gedanken zu ihren Übungen im Reiten mit Waffen durch den Kopf. Sie holte sich beim Wirt einen Becher mit Dünnbier und suchte sich einen der wenigen Tische, die so gut wie leer waren. Schräg gegenüber saß ein weiterer einzelner Gast, ansonsten war sie hier, wo vielleicht sechs oder acht Leute Platz fanden, allein.
Es schien sich möglicherweise um einen Händler zu handeln, denn er kritzelte unablässig auf einigen Zetteln, vielleicht Abrechnungen irgendwelcher Lieferungen oder Ähnliches. Seinen Becher rührte er nicht an in der Zeit, seitdem Nienor hier saß.
»Wie laufen die Geschäfte«, fragte sie ihn nach einer Weile und hob den Tonbecher in seine Richtung.
Er sah auf und schien sie als harmlos einzuschätzen.
»Dazu kann ich nichts sagen«, beschied er ihr dann knapp.
»Keine Sorge, ich komme nicht von der Konkurrenz«, antwortete ihm Nienor und machte ein freundliches Gesicht.
»Ich möchte hier nur in Ruhe meinen Abend verbringen und keinen Ärger.«
»Verstehe«, erwiderte er knapp, sich wohl zu einer Antwort gezwungen fühlend.
Nienor nahm einen Schluck aus ihrem Becher und schaute sich wieder die Gäste an. Nicht weit von ihr wurde mit Karten gespielt. Der Orden missbilligte das Glücksspiel als innoslästerlich, aber meistens hatten die Milizen Wichtigeres zu tun, als ausgerechnet Karten- oder Würfelspielern hinterherzujagen. es war also mehr eine Art moralisches Gebot und jeder wusste, dass Regeln dieser Art sehr volatil gehandhabt wurden. Auch Nienor selbst fand, wenn sie im Dienst war, ihre Zeit zu schade, um sich um derartige Petitessen zu kümmern. Soweit sie es mitbekam, schien einer der Spieler in arge Bedrängnis geraten zu sein. Er wirkte aufgebracht und machte den Eindruck eines Verzweifelten, indem er sich ständig die Haare raufte und ungläubig auf die eigenen Würfelergebnisse und die der anderen starrte. Sie schaute für eine Weile genauer hin und bemerkte, dass die zwei anderen Spieler zusammen arbeiteten, indem der eine dem anderen sehr unauffällig und geschickt Karten zusteckte, die in einer Tasche der Jacke des anderen landeten. die Jacke war so über die Stuhllehne geworfen worden, dass auf möglichst unauffällige Art und Weise die Karten mit einer schnellen Handbewegung erreicht werden konnten. Irgendwann stand sie ihrem inneren Drang nach Gerechtigkeit folgend auf und ging zu dem Tisch der Spieler, die ihr Kommen im Eifer des Spiels gar nicht bemerkten. Sie griff in die Jackentasche und holte einige Karten heraus.
»Hier, die hast du vergessen.«
Sie warf sie offen auf den Tisch.
Der bedrängte Spieler zog die Augenbrauen zusammen, erhob sich und rief wütend: »Ihr elenden Betrüger!«
Die Ertappten ließen sich auf keine Diskussion ein, da sie sofort erkannt hatten, dass sich die Situation zu ihren Ungunsten entwickelt hatte. Schnell stoben sie vom Tisch weg und flohen zum Ausgang, noch ehe sie jemand aufhalten konnte. Karten und Münzen ließen sie einfach liegen - ihre Haut zu retten erschien ihnen nach blitzschneller Abwägung wohl wichtiger als der Verlust einiger ergaunerter Kupfermünzen verschiedener Prägung.
Die Miene des geprellten Spielers erhellte sich wieder.
»Ich danke dir«, wandte er sich an Nienor und stellte sich kurz vor.
»Wie konnte ich nur auf solche stümperhaften Betrüger hereinfallen?«, gab er sich selbstkritisch.
»Immerhin konntest du ihnen schnell das Handwerk legen. Das waren wohl Anfänger. Umso schlimmer, dass ich ihnen auf den Leim gegangen bin. Das sollte mir echt zu denken geben.«
Er raffte die Münzen, die auf dem Tisch verteilt lagen, zusammen und hatte dann eine Idee.
»Ich lade dich ein auf einen Wein. Das ist es allemal Wert!«
Nienor war nicht abgeneigt.
Und so kam sie doch noch zu einem Gesprächspartner und dieser war ihr so dankbar, dass er ihr gerne das eine oder andere erzählte von seinen letzten Reisen. Denn es handelte sich um einen Seemann, der auf einem der Handelsschiffe, das derzeit im Hafen lag, als Maat arbeitete und nun beinahe die Heuer für die letzte Reise verloren hätte. Wenn seinen Worten Glauben zu schenken war, dann kam er offiziell aus Gorthar, jedoch in Wirklichkeit direkt aus Sendar. Der Schiffsführer hatte lediglich den Kurs so gelegt, dass er Thorniara in einem weiten Bogen von Osten her um das nördliche Kap Argaans erreichte und er den Eindruck erweckte, aus dem Osten zu kommen. Doch in Gorthar war das Schiff auf seiner Route nie gewesen. Warum diese Pirouetten? Natürlich, um Probleme zu vermeiden. Myrtana handelte nicht mit dem argaanischen Feind und jedes Schiff von einer der Südlichen Inseln, dass so dumm gewesen wäre, direkt in einen myrtanisches Hafen zu segeln, wäre sofort samt Ladung beschlagnahmt worden. Daher also der Trick samt gefälschter Frachtpapiere. Der Hafenmeister in Gorthar war weit weg und musste nichts von diesen Tricks wissen. Und mit Myrtana hatte Gorthar so wenig direkt zu schaffen wie mit Argaan. Wer sollte das schon kontrollieren können? Solange es keine direkten Patrouillenschiffe zwischen Thorniara und Gorthar gab oder gar feste, begleitete Geleitzüge, war dieser Trick todsicher. Und man sparte jede Menge Zeit und Zölle, indem man überflüssige Häfen vermied.
»Sendar ist wie Setarrif einst war – eine weiße Stadt am Meer«, erzählte er.
»Dort ist der Krieg weit weg, myrtanische Soldaten sind dort nur ferne Legenden und das Leben geht auf Korshaan weiter wie immer. Fast zumindest. Der Handel mit Argaan hat einige Einbußen hinnehmen müssen, nicht nur durch den Krieg, sondern auch durch die Zerstörung von Setarrif und dem Verlust der vielen Einwohner, die seitdem alle als Kunden weggefallen sind. Dafür sind bestimmte Güter umso wertvoller geworden. Das hat einigen der dortigen Handelshäuser viel zusätzlichen Gewinn gebracht und andere in den Ruin getrieben. Je nachdem, auf welche zukünftige Entwicklung man gewettet hatte.«
Er hatte den letzten Zug aus seinem Becher genommen, war bis dahin immer redseliger geworden und bestellte nun neuen Wein.
»Dadurch hat die Pferdezucht neue Wendungen genommen.«
»Wie das?«, fragte Nienor, plötzlich sehr interessiert.
»Oh, das ist so ein großes Ding auf Korshaan«, erklärte er, »das sich leicht erklären lässt: Wer Geld hat, zeigt das, indem er sich die besten Turnierreiter leistet. Auf der Insel gibt es einige Turnierplätze und die Geschlechter mit den dicksten Geldkatzen sind meist die erfolgreichsten darin, die Turniere zu gewinnen. Und da keiner von den adeligen Handelsherren sich selbst der Gefahr beim Turnier aussetzen will, reiten mit ihrem Wappen andere. Und nun, wo seit einigen Jahren dank neuer Handelserfolge neue, bisher unbedeutende Geschlechter nach oben drängen, bauen auch diese Zuchten auf, um Erfolg in den Turnieren zu erzielen und sich einen Namen auf der Insel zu machen. Und dazu kaufen sie Hengste auch aus fernen Ländern, wenn diese einen vorteil für die Zucht versprechen.«
Nienor erkannte plötzlich, dass sich ihr hier eine Chance bot, weiteres Wissen zu finden, ohne tausende Meilen reisen zu müssen, in irgendwelche fremden, unbekannten Länder weit hinter dem Ozean. Vielleicht war Korshaan eine Reise wert, überlegte sie.
Ihre neue Bekanntschaft sprach unterdessen weiter, als er gemerkt hatte, dass sie an seinen Lippen hing.
»Korshaan selbst ragt größtenteils mit schroffen hohen Ufern voller Klippen aus dem Ozean. Es erstreckt sich in Ost-West Richtung und sein Rückgrat bildet eine Gebirgskette, die weiter südlich noch einen kürzeren Zwilling hat. Das meiste Land abseits der schroffen Berge ist sehr fruchtbar und wird für Felder genutzt, auf denen die Ähren fast mannshoch wachsen. Außerdem gedeihen viele Bäume voll mit süßen Früchten auf der Insel. Nicht so etwas wie die sauren Äpfel hier. Süße Pfirsiche, weich und saftig. Und runde Früchte mit orange leuchtender Schale, Orangen, Zitronen, Pampelmusen, ebenso voller Saft, süß oder sauer je nach Sorte. Pflaumen voller weicher Süße. Fast jede Straße ist damit gesäumt. Sie spenden nicht nur Schatten in der heißen Sonne des Südens, sondern bieten auch noch ihre Früchte an. Und Wein ...«, schwärmte er, nahm dann einen Schluck aus seinem Becher und verzog das Gesicht.
»Was wir hier gerade trinken, ist ganz furchtbar dagegen. Damit würde man auf Korshaan nicht einmal seine Knechte abspeisen. Ich sage dir, Korshaan ist wirklich von Adanos gesegnet. Argaan ist nur ein schwacher Abglanz davon. Und Myrtana ... kein Wunder, dass dort alle so kriegerisch sind und andere Länder erobern wollen. Ich wäre auch unzufrieden, wenn ich in diesem kargen Waldland leben müsste und würde mir ein schöneres Fleckchen Erde suchen. Zum Glück geht es bald wieder in den Süden! Sobald wir neue Ladung organisiert haben, geht es wieder zurück! Ist nicht so einfach, hier was zu finden, was sie in Sendar haben wollen, das kann ich dir sagen.«
Nun, ›vielleicht hat er gerade etwas gefunden und weiß es nur noch nicht‹, dachte Nienor bei sich.
Laut sagte sie: »Ich hätte nicht übel Lust, auch einmal dieses Wunderland zu besuchen. Und natürlich behalte ich alles, was du mir heut abend erzählt hast, für mich«, beeilte sie sich zu versichern.
»Das musst du mit unserem Schiffsführer ausmachen«, beschied ihr der redselige Maat, nun plötzlich überraschend einsilbig.
»Das werde ich tun«, versprach Nienor. Um diese Jahreszeit lagen nicht allzu viele Schiffe im Hafen und sie würde schon herausfinden, welches davon in Anführungszeichen aus Gorthar gekommen war. Zur Not fragte sie offiziell in der Hafenmeisterei nach.
Ihr Gegenüber schwärmte dann noch eine Weile von der sanft hügeligen Landschaft mit Feldern, Weilern und Pinien in Korshaan und erzählte am Ende auch noch einige Dinge über das geheimnisvolle Torgaan, das zu großen Teilen von dichtem Dschungel bedeckt war und die Heimat wilder und gefährlicher Bestien und ebensolcher Krieger war. Die Krieger ließen sich manchmal auch außerhalb der Südlichen Inseln anheuern. Und falls sie dann eines Tages mit Geschichten über ihre Abenteuer in der Ferne wieder zurück kehrten, war ihnen laut seinen Worten großes Ansehen gewiss. Aber viel mehr wusste er über die Einheimischen nicht zu erzählen, außer, dass sie dunkelhäutig wären.
irgendwann verabschiedete sich Nienor nach einigen Bechern Wein, die ihr der dankbare Seemann spendiert hatte. Sie hatte genug gehört, um nun zu wissen, wo ihr nächstes Ziel lag.
-
Einfach auf den Atem hören. Einatmen, ausatmen. Er spürte den Luftzug an seinem Gaumen entlang. Spürte wie die Luft durch seine Nase ein und in seine Lungen floss. Dann andersherum. Er seufzte. Was musste er noch einmal heute alles machen? Das Labor aufräumen vielleicht. Einige der Phiolen waren in wirklich keinem guten Zustand mehr. Ja das sollte er sich bald mal anschauen. Er fluchte. Zurück zum Atem. Einatmen, ausatmen. Was war eigentlich aus der Novizin geworden? Er hatte sie schon länger nicht mehr gesehen. Ob ihr etwas passiert war? Vielleicht sollte er mal nach ihr schicken. Seine Augen wollten schon fast aufgehen, als er sich innerlich ermahnte. Doch es war als würde er ein Glas mit Wasser und Dreck schütteln. Es wirbelte umher und seine Gedanken begannen nur noch mehr zu rasen.
Er machte die Augen auf und warf zornig seine Hand nach vorne. Er schnaubte und atmete schwer. Diese gottlose Meditationsübung musste direkt aus Beliars Reich stammen. Wie konnte man Menschen nur so mit Langeweile und Schuldvorwürfen quälen? Wieso musste er hier nur sitzen und das über sich ergehen lassen? Es war zum Mäusemelken. Wobei, wenn er an das Melken von Mäusen dachte: Vielleicht ergaben sich dadurch ja auch noch neue Forschungsfelder. Wenn man es genauer betrachtete hatte die Milch dieser kleinen Wesen vielleicht wichtige alchimistische Eigenschaften, die er sich mal genauer anschauen sollte. Es gab sicherlich signifikante Unterschiede zu Kühen zum Beispiel. Eine Potenzierung konnte vielleicht…
Wieder fühlte er wie Wut in ihm hochstieg. Er schaffte es einfach nicht. Schaffte es nicht seine Gedanken fortzujagen. Je mehr er es versuchte desto mehr wirbelten sie herum. Wie kleine Quälgeister, die nur dazu bestimmt waren ihn heimzusuchen und seine Nerven über jedes gesunde Maß hinaus zu belasten.
Irgendwann, als er sehr müde wurde und als alles andere nicht mehr half, als sein Trotz ihn so weit getrieben hatte, dass er doch auf dem Sessel sitzen geblieben war, da gab er den Widerstand auf. Er lies die Gedanken sein, was sie waren. Er ergab sich seinem Schicksal und lies einfach sein was war. In diesem Moment wurde er ohne sein Zutun in die astrale Ebene gezogen und sein Erleben war etwas völlig Neues.
-
Nienor hatte den Tag genutzt, um ihre Angelegenheiten zu ordnen. Zephir stand gut versorgt im Ordensstall. Sie hatte einem der Pferdeknechte, den sie als am vertrauenswürdigsten ansah, ein Handgeld dafür gegeben, dass er das Schlachross auch wirklich regelmäßig bewegte und zwar mehr als nur das übliche ein paar Mal im Kreis mit ihm gehen. Sie hoffte, die Motivation hielt einige Wochen an, machte sich allerdings auch keine allzu großen Illusionen darüber. Sie durfte einfach nicht zu lange fort bleiben. Ihre Rüstung und den Langbogen ließ sie ebenfalls in Thorniara zurück, denn die rechnete nicht damit, das eine oder andere zu benötigen. Außerdem achtete sie darauf, kein Stück mitzunehmen, dass das Wappen Myrtanas trug. Ihr war klar, dass sie in Feindesland unterwegs war. Nun waren zwar die Kämpfe schon seit Jahren abgeflaut und hatten einem nie erklärten Waffenstillstand Platz gemacht. Aber der Krieg war deswegen nicht offiziell beendet. Je nachdem, was in Vengard entschieden wurde, konnte er auch jederzeit wieder aufflammen. Es war also auf jeden Fall geboten, sich nicht als Teil der myrtanischen Armee erkennen zu geben.
Nienor durchschritt die Gassen der Stadt mit ihren Häusern, die teils aus Fachwerk und - und sofern das Schicksal des Geschäftslebens irgendwann einmal zu den Bewohnern gnädig gewesen war - aus Stein erbaut wurden waren. Die Häuser, die ortstypisch für gewöhnlich mit ihren Giebeln zur Straße zeigten, schienen ihr mit hängenden Gesichtern nachzuschauen, jedenfalls erweckten die Dachschrägen in der Fantasie diesen Eindruck. Im Hafen lagen die gleichen drei Schiffe, wie schon in den letzten Tagen. Eins davon war die ›Innosgeboren‹, ein Schiff der myrtanischen Marine. Das zweite eine etwas größere Slup, für mehr als die Fahrt an der Küste entlang war sie sicher nicht gedacht - sofern der Kapitän nicht besonders wagemutig oder leichtsinnig war. Also blieb nur noch das dritte Schiff übrig, das einen dickwandigen und bauchigen Rumpf besaß, auf dem sowohl ein hohes Achterkastell als auch ein Aufbau am Bug aufgesetzt worden war. Es lag tief im Wasser und machte nicht den Eindruck, ein besonders schneller Renner zu sein. Am Mast war nur eine Rahe angeschlagen. hier wurde noch ganz nach altem Brauch gesegelt, nicht mit den neumodischen Dingen wie Bram- und Marssegel, wie sie manche Schiffbauer anpriesen. Nienor wusste, dass mehr Segel auch mehr Mannschaft bedeuteten. schließlich mussten sie im Grefahrfall möglichst alle gleichzeitig gerefft werden. Und mehr Münder an Bord schmälerten den Gewinn einer Fahrt. Es sei denn, die Geschwindigkeit war entscheidend für den Gewinn. Hier war sie es offensichtlich nicht.
Die Kriegerin trat mit ihrem Bündel auf dem Rücken, dass nur einige Kleidung, ihr Schwert und den Kurzbogen enthielt, auf den Landgang und suchte, an Bord gelangt, jemanden von der Besatzung. Doch sie kam ungehindert bis in die Räume, die im Achterkastell lagen. offenbar gab es auf Deck nichts zu bewachen. Hier hörte sie nun Stimmen, klopfte höflicherweise an, ehe sie die Tür öffnete und eintrat.
»Innos zum Gruß, ich suche ein Schiff, das mich nach Gorthar bringt, wenn ihr versteht, was ich meine.«
Sie machte entsprechende Bewegungen mit den fingern der erhobenen Hände beim Wort Gorthar, um sicherzustellen, dass klar war, was sie in Wirklichkeit meinte.
Im Raum standen ein Mann und eine Frau. Sie unterbrachen ihren Disput.
Er war eher untersetzt, wirkte breitbeinig mit jeder Menge Stoppeln im dunklen Gesicht und sehr kurzem Haar. Zerknitterte Hose und an den beiden Ärmeln verschieden hochgekrempeltes Hemd. Über den linken Unterarm zog sich, soweit die Kleidung die Sicht zuließ, eine lange Narbe. Wie weit sie den Arm noch hinauf lief, konnte nur vermutet werden. Sie hingegen war groß und drahtig, die schwarzen Haare zu einer praktischen Frisur hinten am Kopf zusammengebunden.
»Ah, du meinst dieses Gorthar?« Sie beließ es bei der Betonung.
»Kommt drauf an, was du zahlst. Normalerweise nehmen wir keine Reisenden mit.«
»Aber momentan haben wir genug Platz«, knurrte der Mann schlecht gelaunt dazwischen.
Die Frau seufzte hörbar und verdrehte die Augen.
»Lass gut sein Temo.«
Sie wandte sich wieder an Nienor.
»Für zwölf gortharische Zechinen pro Tag nehmen wir dich mit nach ... Gorthar. Was auch immer du hier verloren hattest oder an unserem Ziel suchst. Da fragen wir nicht nach.«
»Gut, das kann ich zahlen«, stimmte Nienor zu, ohne weitere Verhandlungsversuche zu unternehmen. Vielleicht war es von Nachteil und sie wurde nun als leichte Beute angesehen, die man einfach ausnehmen konnte, aber wenn das tatsächlich jemand versuchte, würde sie schon gebührend protestieren. Die paar Tage der Überfahrt war es auch egal, wie irgendwer auf diesem Schiff sie einschätzte. Vermutlich sah sie diese Leute danach nie wieder.
»Ich bin Niniel«, stellte sie sich sicherheitshalber mit anderem Namen vor.
»Kelani. Ich führe dieses Schiff. Temo hier muss ich ja nicht mehr vorstellen, er ist mein Steuermann. Bezahlt wird übrigens sofort für die ersten sechs Tage. Verpflegung musst du mit dem koch ausmachen oder dir, bevor wir ablegen, selbst etwas besorgen.«
»Also ein Dukat«, erkannte Nienor und nestelte an ihrem Geldbeutel, der Teil ihres Gürtels war. Irgendwo da drin mussten auch noch einige Dukaten sein. Das war schließlich die Währung, die auch außerhalb Myrtanas überall Wert besaß. Gorthar stand für Wertstabilität. Die Dukaten wurden schon seit vielen Generationen mit dem gleichen Feingehalt geprägt und in der dortigen Münzstätte hatte man bisher allen Versuchen widerstanden, daran etwas zu ändern. Nienor hatte also darauf geachtet, dass wenn sie bei ihren Einkäufen Zechinen oder Dukaten bekam, diese zu sammeln und nicht wieder für Käufe bei lokalen Händlern zu verschwenden.
»Such dir einen freien Raum im Vorderkastell«, meinte Kelani, nachdem Nienor das Geld auf den Tisch gelegt hatte.
»Die Laderäume sind Tabu für dich, dort will ich dich nicht erwischen, ansonsten kannst du dich an Deck frei bewegen, versuch nur, meinen Leuten nicht im Weg zu sein.«
Nienor versprach, dies zu beherzigen.
»Wir legen morgen Mittag ab.« Und damit war alles besprochen.
Das war ihr nur recht. Je eher sie ihre Reise beginnen konnte, desto besser. Denn warum noch Zeit verlieren? Während sie über Deck in Richtung des Vorschiffs lief, um sich dort ein Quartier zu suchen, verloschen die Lichter Thorniaras langsam, denn es war mittlerweile Nacht geworden.
 Berechtigungen
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
|







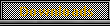



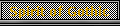










 World of Players
World of Players
 Thorniara #34
Thorniara #34












