-
Bluttal
Ein Mahl zu zweit schmeckte doppelt so gut. So jedenfalls sagte man und in diesem Augenblick war Isidor geneigt der Redensart zuzustimmen. Der etwas befremdliche Wanderer, an dessen Feuer er sich gesellen hatte dürfen, war ein interessanter Gesprächspartner, von dem der junge Schmied viel lernen konnte. Doch um zu lernen, musste man verstehen. Und so sehr sich der lediglich oberflächlich ausgebildete Myrtaner auch bemühte, entglitt ihm immer wieder der Sinn hinter den Worten des Redekünstlers.
In gedanklicher Revue folgte er noch einmal den Sätzen des kleinen Mannes, der sich selbst in dritter Person nannte, wollte nicht unterliegen im freundlichen Wortgefecht zweier Reisender mit demselben Ziel.
„Eine Betstätte Adanos‘ hat sich kürzlich in Stewark gebildet? Was meint Ihr damit? Haben die dort ansässigen Gläubigen einen Tempel errichtet, dessen Einweihung gefeiert wird?“
Seine Frage entsprang ehrlicher Neugierde, denn im Laufe seines Lebens hatte er die heiligen Gemäuer Vengards nur zu selten besucht. Niemals hatte er von einem Adanos geweihten Tempel gehört, geschweige denn das Innere betrachten können. Würde er dort eiserne Reliefs bewundern können? Oder gar Bronzebüsten entdecken, die Gesichter alter Zeiten verewigten?
Während er darüber sinnierte, was für Wunder in Aussicht standen, nahm er dankend ein Stück Apfelsine von Arvideon entgegen. Der Geschmack war so süß und gleichwohl sauer, wie es der Hüne nie zuvor erlebt hatte. Die Früchte des Südens spielten wahrlich mit den Sinnen, auch wenn er gern auf die kleinen weißen Fäden, die sich durch das Fruchtfleisch zogen, verzichtet hätte.
„Ihr würdet mir einen unschätzbaren Gefallen tun, wenn Ihr mir den Weg weisen würdet“, freute sich Isidor über das zuvorkommende Angebot, „Ich wüsste nicht, wo ich enden würde, wenn ich meinen Füßen erlaube den Weg zu suchen.“
Ein leises Lächeln, welches nicht ganz frei von Unmut war, umspielte seine vom Feuerschein erhellten Lippen. Sein Magen erinnerte ihn daran, dass er nicht die Gastfreundlichkeit des Mönches betrügen sollte, weshalb er nach einem Stück gerösteten Brot griff und es seinem baldigen Reisegefährten gleichtat, indem er den intensiv riechenden Käse darauf verteilte.
„Dieser Käse ist wahrlich gut!“, kommentierte er überrascht und schaute verwundert auf den Belag.
Schlussendlich musste sich der Schmied jedoch in Eloquenz geschlagen geben – nicht, dass er je Aussicht auf Erfolg gehabt hätte – als Arvideon in einen wahren Wortschwall überging, in dessen Mitte seine Gedanken nicht mehr mitzuhalten im Stande waren. Etwas ratlos hob er die Hände, Handflächen gen Himmel gerichtet, eine entschuldigende Miene im Gesicht.
„Nun habt Ihr es geschafft, Meister der Worte. Ich muss eingestehen, dass ich nicht so wortgewandt bin, wie ich es gern wäre. Vielleicht würdet Ihr mir eines Tages beibringen, mich ebenso gewählt auszudrücken?“, fragte er vorsichtig nach und deutete den Wunsch auf ein weiteres Aufeinandertreffen in der Zukunft an.
„Gold mag Tand in Euren Augen sein, doch jemand wie ich, ist auch darauf angewiesen. Ich muss Essen und Trinken, ein Schlafplatz will bezahlt sein und erst kürzlich musste ich neue Kleidung kaufen, da meine alte den Launen der Zeit zum Opfer gefallen ist.“
Gedankenverloren schaute er nach Westen. Die letzten Strahlen der Sonne hatte es hinter den Horizont getrieben und die samtene Trägheit eines langen Marsches und guten Essens machte sich in dem jungen Mann breit.
„Ich denke, dass es bald Zeit wird meine Bettrolle auszubreiten. Wie ich sehe nutzt ihr eine Hängematte. Ich hätte nicht gedacht, dass man so etwas außerhalb eines Schiffes nutzen kann“, gab er zu und dachte an die lange Reise über das Meer zurück, welche er diesen Morgen noch beendet hatte. Was für ein ereignisreicher Tag.
-
Bluttal – Vom Zungenschlag im Sauseschritt
Am Morgen weckte sie der erste Sonnenstrahl, der über die schneebedeckten Gipfel des Weißaugengebirges in das Tal hinabfiel. Es herrschte bereits reges Treiben im taunassen Gras. Insekten wuselten umher und die Vögel begrüßten zwitschernd die Sonne und einander und tauschten sich über das beste Frühstück im reichhaltigen Frühlingsbuffet aus.
Isidor und Arvideon brachen zügig ihre Schlafstätten ab, nahmen die letzten Überbleibsel des abendlichen Festmahls zu sich und machten sich auf den Weg. Die Sonne im Rücken tauchten sie in den Wald des Bluttals ein und folgten der Straße nach Stewark.
„Vor dem Dahindämmern fragtet Ihr den unermüdlichen Wandermönch nach dem Tempel zu Stewark? Ende des letzten Sommers sei er unter der Stadt erschienen, so berichtet man auf dem ganzen Eiland. Ein Wunder, dass die Rechtmäßigkeit der Herrschaft Ethorns über die Festungsstadt auf dem Felsen im Meer durch Adanos selbst bestätigt, so trug man es in alle Winde. Arvideon war lange unterwegs fern der Insel, während die Güldene, die alte Königsstadt unterging. Nun ist er begierig, die neue zu sehen und den neuen Tempel, der in sich die reinste Pracht des vor Leben sprühenden Meeres und des ihm ewig trotzenden unbeweglichen Felsens vereinen soll. Mit großen ausschweifenden Festivitäten soll die Einweihung begangen worden sein.“, knüpfte Arvideon an ihr Gespräch vom vorigen Abend an, nachdem er die zerkauten und aufgequollenen Restchen einiger getrockneter Apfelringe mit frischem Wasser aus seinem Schlauch hinuntergespült hatte.
„Ihr ehrt den Vater der falschen Bescheidenheit mit Eurem Lob wahrlich. Doch, ob es gewählt ist, wie sich die Bänder der Stimmung des alten Gnoms schlagen, vermag er in all seiner grenzenlosen Bescheidenheit nicht zu ergründen. Er lehrt zwar gern, doch ob sein Zungenschlag erstrebenswert ist? Ist die Akrobatik seiner Lippen doch eher vom alten Schlag, dem neuen nicht erwachsen, dem modernen weit enteilt. Der Trend geht dieser Tage doch mehr zu Handwerk und Fingerfertigkeit, lies sich Arvideon in seiner gesetzten Weisheit erst kürzlich selbst belehren.“
Irgendwo zerspante ein Specht weithin hörbar Borke und Bast.
-
Zwischen Bluttal und Stewarker Umland
Während die beiden ungleichen Männer nebeneinander voranschritten, das Bluttal im Rücken, den klaren Morgenhimmel über sich und dasselbe Ziel vor sich, verzog Isidor missmutig das Gesicht, während er versuchte einige Ameisen, die sich zwischen Hemd und Oberkörper geschlichen hatten, davon abzuhalten ihm weiteres Unbehagen zuzufügen. Einfach gesagt zappelte er unelegant herum und zerrte an seiner Kleidung bis er sich sicher war, die Plagegeister losgeworden zu sein.
„Ich denke, ich verstehe nun den Vorteil einer Hängematte selbst außerhalb eines Schiffes“, murrte er, ehe er sich wieder dem Gespräch mit seinem sonderbaren Wegbegleiter widmete.
„Also ist der Tempel einfach so erschienen? Und niemand wusste davon? Das klingt wahrlich wunderlich. Ein Ereignis würdig eines Festes“, staunte er über das Gehörte.
Wie konnte es sein, dass derart ehrwürdige Orte einfach so entstanden? Oder aber, wenn es sie schon seit ewigen Zeiten gab, in Vergessenheit geraten? Der junge Schmied wusste leider absolut nichts über diese Insel und mit jedem Schritt an der Seite Arvideons wurde ihm diese Tatsache vor Augen geführt.
„Die güldene Königsstadt? Sprecht Ihr von Setarrif? Ich hörte den Bootsman darüber sprechen, wie ein Drache ihren Untergang besiegelt haben soll. Doch ich hielt es für Seemansgarn, wenn ich ehrlich bin“, klaubte Isidor das wenige Wissen, was er auf der Schiffsreise aufgeschnappt hatte, zusammen.
Je weiter der Weg sie führte, desto mehr wich der Wald einer hügeligen Landschaft. Weite Felder erstreckten sich über flache Hänge, Obstbäume sogen die Wärme des Frühlings in sich auf und wurden von Feldarbeitern gepflegt.
Am schwindenden Waldesrand trat soeben ein Zeidler heraus, der mit frohem Blick zwei große Behälter mit Waben mit sich führte. Das Leben hier schien nicht zu sehr von der drohenden Anwesenheit des myrtanischen Reiches beeinträchtigt zu sein. Doch was sollten die einfachen Menschen auch tun? Sie konnten nicht darauf warten, dass Friede herrschte, denn sie mussten arbeiten, um zu überleben.
„Glaubt einem einfachen Schmiedesohn, wenn er Euch sagt, dass Handwerk und Fingerfertigkeit nur bedingt helfen, wenn einem kein Glauben geschenkt wird, weil man sich nicht auszudrücken oder zu präsentieren weiß“, gab er nicht auf sein Kompliment an den Wandermönch zu bringen.
Er hatte selbst erleben müssen, wie es war, wenn man trotz passablen handwerklichen Geschicks keinen Fuß in einer Gesellschaft fassen konnte, wo andere mit Worten allein ein Leben zu leben in der Lage waren. Unwillkürlich erinnerte er sich an Piero, wobei er nicht wusste, ob der kurze Eindruck, den Isidor von ihm gewinnen konnte, ausreichte um ihn in diese Schublade zu stecken.
-
Orkwald, am Karrek
Rhythmisch wiegte sich Proyas Oberkörper vor und zurück, ihre Augen bewegten sich hektisch unter den geschlossenen Lidern, brachten sie zum Zucken. Dichte Schwaden verbrennender Kräuter füllten das Zelt der Schamanin, verdichteten die Luft erzeugte eine nahezu greifbare Spannung. Die Dämpfe drangen in Mund und Nase der Oraka, beflügelten ihren Geist auf der Suche nach Antworten. Sie suchte nach IHR, jener Präsenz, die sie anleitete, seit sie vor all den Jahren auf Argaan angekommen war. Noch immer begriffen weder sie, noch Melog, was für einem Wesen sie folgten, wie SIE mit dem Schöpfer in Verbindung stand. Immer wieder hatte Proya in den letzten Monden versucht der Spur der dämonischen Präsenz, die sie in ihren Träumen heimsuchte, zu folgen. Etliche Male hatte sie die Steintafeln, die sie einst im Gebirge gefunden hatten, zu deuten versucht. Doch all ihre Versuche waren erfolglos gewesen. Immer, wenn sie IHR näherzukommen glaubte, entfloh ihr das Gefühl der Kontrolle und die Geister trieben sie gewaltsam aus ihrem Reich, zurück in ihr Zelt, wo sie erschöpft zu Boden sacken würde.
Doch nicht heute. Dieses Mal würde sie sich nicht vertreiben lassen. Dieses Mal würde sie ihren Wert beweisen, die Wächter hinter dem Schleier überzeugen oder bezwingen. Ihr Atem rasselte in der rauchgefüllten Kehle, während all ihre anderen Sinne bereits abstumpften. Sie nahm den Geruch der brennenden Kräuter nicht mehr wahr, der Geschmack von Eisen und Ruß hatte sie verlassen und ihre Bewegungen waren längst nicht mehr ihrem eigenen Willen unterworfen.
Ihr Bewusstsein trat durch den Schleier, folgten den magischen Pfaden, auf denen sie schon so oft gewandelt war. Stimmen der Vergangenheit prasselten auf sie ein, gierten nach ihrer Aufmerksamkeit, nach Akzeptanz, Streit oder auch Tod. Der Wille der Seelen war so vielfältig wie jener der Lebendigen.
SIE ist nicht dein zu ergründen…
…die Schleier lichten sich nicht…
Die Dunkelheit, die du suchst, wird auch in dir suchen!
Die Stimmen wurden lauter, Bilder von Unheil und Verfall traten vor ihr geistiges Auge, Warnungen und Drohungen, was geschehen würde, wenn sie ihr Ziel nicht aufgab.
Verirrte Tochter des schwarzen Felsens, kehre zurück…
Die Macht, die du zu beherrschen suchst, wird am Ende dich beherrschen.
Die Antworten, die du begehrst, zahlst du mit mehr Leid, als du zu ertragen im Stande bist.
Mit aller Macht versuchte sie die Geister von sich abzustoßen, ihre Warnungen, Verheißungen und rätselhaften Phrase verstummen zu lassen. Doch sie strauchelte, verlor den Pfad der Magie vor sich aus den Augen, drohte abzustürzen in die Tiefen des Geisterreiches, als…
„Hhhhhmmmmggg“, entwich ein erstickter Schrei der Schamanin, als sie durch das Gefühl des Fallens aus ihrer Trance gerissen wurde.
Panisch riss die die Lider auf, suchte Halt am fellbedeckten Boden ihres Zeltes. Sie hustete, stieß den Rauch aus, der sich in ihrer Lunge gesammelt hatte. Sie musste nach draußen, heraus aus dem Dunst und den berauschenden Wirkstoffen der verbrannten Kräuter.
Auf ihren rituellen Speer gestützt schritt sie aus ihrem Zelt, noch immer stieß sie hustend Rauch hervor, sodass sich einige der Oraks zu ihr umwandten. Sie musste sich stark zeigen, durfte nicht wirken, als wäre sie schwach. Mit funkelnden Augen entgegnete sie den Blicken der Krieger und Späher, die sich respektvoll zeigten. Gut.
Sie würde sich bald wieder Zasa widmen müssen, doch für den Moment brauchte sie etwas Abstand vom Ort ihrer Geisterreise. Sie hörte noch immer die Stimmen nachhallen, weshalb sie das Lager verlassen wollte. Zumindest bis sie einen klaren Kopf zurückerlangt hatte.
-
Orkwald
Den feuchten Sumpf hinter sich zu lassen war definitiv eine Wohltat für Chalas Haar. Immerhin waren ihre natürlich krausen Locken geradezu euphorisch, wenn sie genügend Feuchtigkeit bekamen. Doch sie hingegen hasste es, wenn ihr die Haare unbändig in alle Richtungen abstanden. Vielleicht sollte sie sie einfach abschneiden, so kurz, dass sie sie nicht mehr darüber ärgern musste. Doch es würde wohl wie jedes Mal ablaufen, wenn sie glaubte bereit zu sein, diesen Schritt zu gehen. Also verwarf sie den Gedanken wieder und dachte lieber noch einmal darüber nach, was sie mit Freiya ausgemacht hatte. Sie würden sich wiedersehen, doch dann mit widergewonnenen Erinnerungen. Für die Aranisaani fühlte es sich ein wenig so an wie die Zeit mit Sahar, bevor die Varanterin sie verraten hatte. Die Gemeinsamkeit verband sie miteinander und für den Moment freute sich Chala einfach, jemand gefunden zu haben, der ihr Vorfreude auf ein weiteres Treffen bescherte.
Der gewundene Pfad führte sie alsbald in den Orkwald, der durch ein fast gänzlich dichtes Blätterdach immer so wirkte, als wäre der Tag bereits vorüber. Kaum ein Vogel war zu hören und jedes Rascheln ließ dem unbedarften Wanderer die Haare zu Berge stehen.
Zwar war Chala gegenüber der rothaarigen Jägerin selbstbewusst gewesen, doch tatsächlich erwartete sie stets hinter jedem Stamm eine Bedrohung, der sie in den meisten Fällen wohl allein nicht gewachsen wäre. Sie war gut darin ihre mangelnden Kampffertigkeiten zu überspielen, war ja auch nicht gänzlich unbrauchbar. Doch dass sie mit vielen Kämpfern des Waldvolks nicht mitzuhalten vermochte, empfand sie als Anreiz, sich weiter zu verbessern. Die Jahre waren nicht gut zu ihr gewesen und sie hatte ihr eigenes Wachstum zum Wohle des sterbenden Dunklen Bundes eingedämmt. Dabei hätte sie das Pferd von hinten aufziehen sollen, denn nur ein starker Anführer brachte ein ambitioniertes Vorhaben zum Erfolg.
Beinahe bemerkte sie es nicht, während sie ihren Gedanken nachhing. Und dass, obwohl sie sich zuvor selbst ermahnte in dieser gefährlichen Gegend nicht unachtsam zu werden. Ein leises Rascheln vor ihr erweckte ihre Aufmerksamkeit und aus dem Unterholz des Waldes trat eine Gestalt, wie Chala es noch nie zuvor gesehen hatte. So schnell sie konnte drückte sie sich hinter den nächsten Stamm einer massiven, alten Erle. Ihr Herzschlag intensivierte sich und sie versuchte zu lauschen, ob man sie entdeckt hatte.
Aus den Schatten des alten Waldes war sie getreten. Sie war kleiner, als die Aranisaani angenommen hatte, wenn sie den Geschichten über Orks gelauscht hatte, doch es bestand kein Zweifel daran, dass unbändige Kraft in ihren muskulösen Armen schlummerte. Ihre Haut war von einem hellen Grünton, der sich im Schatten mit den Farben der Blätter mischte und im fahlen Licht fast zu leuchten schien. Scharfe Gesichtszüge und spitze Hauer zeugten von einer Wildheit, die nicht einmal die Natur selbst zu bändigen vermochte.
Ihr Haar, ein langer Zopf aus blutrotem Haar, wehte wie eine Kriegsfahne hinter ihr her, während sie auf den Weg schritt. Rote Tätowierungen, die ihr Gesicht und ihren Körper zierten, waren Zeichen ihrer Stellung und Taten, wenn Chala ihrem geringen Wissen über diese Wesen trauen konnte. Metallene Ringe und Knochenstücke, die sie sich durch Ohren und Nase getrieben hatten, klirrten leise bei jeder Bewegung, und ihre verzierte Knochenhalskette, die einem großen Raubtier entstammen musste, war ein stummer Zeuge ihrer Stärke und ihres Mutes.
Ihre Kleidung, ein Ensemble aus braunen Leinen, war so kunstvoll um ihre Gestalt gewunden, dass es wenig Schutz, doch viel Freiheit bot. Ein aufwendig gestalteter Rock erinnerte die Dunkelhäutige an jene, die die Schamanen ihres Volkes trugen, nur wilder.
In ihrer Hand hielt sie einen grausamen Speer, der ebenfalls mit klimpernden Knochen verziert war. Die Orkin war nicht aus darauf unentdeckt zu bleiben, sondern wusste um ihre Fähigkeiten und fürchtete keine Gefahren im Orkwald, ihrem Heim.
Jede Faser von Chalas Körper war angespannt, ihr einziger Instinkt die Flucht. Doch wohin sollte sie laufen? Sie hörte seltsame, gutturale Laute aus der Richtung dieses Wesens und sie wollte sich nicht ausmalen, was geschah, wenn sie entdeckt würde.
Wohin…, dachte sie panisch und blickte sich um.
In den Wald konnte sie nicht fliehen. Vielleicht warteten dort noch mehr dieser Gestalten. Zurück nach Tooshoo könnte sie, doch wenn ihre Flucht bemerkt wurde, konnte sie nicht darauf hoffen zu entkommen. Hoch ins Gebirge? Ganz hier in der Nähe gab es einen Hang, den sie mit etwas Mühe würde erklimmen können. Sie erinnerte sich, dass sie dort Rast gemacht hatte, als sie vom Silbersee aus gen Sumpf gewandert war.
Ja, das schien die beste Option zu sein. Vorsichtig und so leise sie konnte drückte sie sich von dem dicken Baumstamm ab, lief nach Osten, die entgegengesetzte Richtung ihres eigentlichen Ziels. Doch was nutzte es, wenn sie niemals in Stewark ankommen würde, nur weil sie den schnellsten Weg wählte?
Sie war noch nie im Weißaugengebirge gewesen, doch sie erinnerte sich, dass es östlich der Silberseeburg einen Pass in die Berge gab. Wenn sie den irgendwie erreichen konnte, würde sie mit einem Tag, vielleicht auch zweien, Verzögerung in Stewark eintreffen. Doch dafür musste sie unbemerkt den Hang erreichen.
-
Orkwald - Am Karrek
Das Schamanenfeuer knisterte und knackte durch das trockene Nadelholz. Melog warf ein wenig nach und Feuerpartikel stoben mit dem Rauch auf.
“Wilden Jagd dein Volk Ehre gemacht.”, waren die Worte des Orks, nachdem der Ulumulu-Träger aus den Sümpfen von Tooshoo berichtet hatte. Natürlich hatte Ornlu viele Details ausgelassen. So wie es Melog sicher auch tun würde.
“Ja. Es wird uns stärker machen nicht heute. Aber im Morgen.”, sagte der Druide.
“Großer Wolf hat seine Zöpfe abgeschnitten. Du Rache ausgelebt für tote Brüder?”, fragte Melog. Ornlu schmunzelte.
“Es war ein harter Kampf für mich. Mein Haar war ein gutes Opfer für den Sieg.”
“Hmm…nimm was… Und erzähl mir, ob du Knochenbrecher gesehen hast.”, sagte der Schamane und reichte Ornlu Orkkraut zum kauen. Bitter, hart und mit dem süßlichen Geschmack von faulen Früchten, wenn man es lang genug kaute. Ein wenig belebend und nichts was man als Mensch täglich zu sich nehmen sollte.
Ornlu nahm es und biss etwas davon ab.
“Nichts…sie sind entweder weg oder wurden vernichtet. Das ist anzunehmen bei der großen Bedrohung. Ein dritter Gedanke ist, dass sie selbst verändert wurden und in irgendeiner Tempelruine tief verborgen überleben, bis ihre Zeit kommt. Das wäre mein schlimmster Gedanke und deswegen ist er genauso wahrscheinlich. - Unsere Jäger trafen im Süden auf einen untoten Ork. Doch der war beschworen worden. - Eure Krieger sind in Bewegung und tragen Rüstungen Wohin zieht die Horde?”, fragte der Druide ohne es zu umspielen, dass er viele Gedanken hatte die auch sein Volk betreffen könnten. Melog lächelte kehlig auf.
“Du spät fragen offensichtlich Sache. Aber so ihr Morras. Melog deine Gedanken beruhigen. Frieden mit Waldmorras kein Problem. Waldmorras aber nicht wachsam wegen Wilde Jagd, heh? Alte Stadt im Osten haben neue Herrscher. Sein Orks von Schiff. Die Karrek sich das mal anschauen. Alle Karrek gespannt ob sein Freund oder Feind. Verstehen was bedeuten?”
“Ja. - Stört euch nicht an unseren Leuten, wenn sie sich das mal im Osten ansehen und wissen wollen, ob es eure Freunde oder Feinde sind. Wir sind nur neugierige, gute Nachbarn, die sich die neuen Bewohner von Setarriff ansehen wollen. Vielleicht bringen wir sogar Salz und Brot. Wobei es uns momentan an beiden Dingen mangelt. - Erinnert euch an uns, wenn es die große Liebesgeschichte wird und vergesst nicht, dass die Menschen der Städte gerade schlafen. Seid nicht so laut, sonst bellen die Hunde.”, entgegnete der große Wolf und schmeckte nun endlich den süßlichen Geschmack.
“Wie sagen die Morras. Hunde was bellen…nicht beißen? Ha! Orkhund nicht bellen. Reißen Kehle aus! - Wir sehen werden was Schicksal bringt. Vielleicht auch Ende von allen Oraks und Morras gewinnen ohne Preis von Blut. Großer Wolf erzählen, wenn finden Knochenbrecher? Melog und Tat'ank'ka Wort gegeben zu vernichten persönlich. Waldmorras Wort gegeben, das Karrek sie jagen dürfen im Schatten von Tuu'shaa.”
“Unser Wort steht auch und mein neuer Häuptling Mertens erneuert dieses Versprechen. - Das hier soll ich als Geschenk überbringen. Heilpflanzen und Sumpfkraut.”
Ornlu klopfte auf das große, feuchte Paket mit Sachen, die man im Orkwald so nicht bekam. Melog nickte und akzeptierte das Geschenk.
“Vor Abreise du bekommen Geschenk von Karrek für Häuptling Mertens. Wir keine schlechten Nachbarn.”
“Das seid ihr nicht. Vielleicht nur ein wenig orkisch. Aber kein Vorwurf, Melog. Hab Dank für die Gastfreundschaft und das gute Gespräch. Bewahre!”, wünschte Ornlu und erhob sich gleichzeitig mit Melog. Dann befahl der Schamane einer jungen Orkin etwas und führte den Druiden noch einmal kurz durch das Lager der Orks.
Sie hatten sich richtig heraus geputzt und seit seinen letzten Besuch hier, hatte sich das Lager um den großen schwarzen Fels noch einmal weiter entwickelt. Aus dem hölzernen Orkfort entwickelte sich so langsam eine Orkburg. An manchen Stellen war schon eine zwei Mann hohe Steinmauer hochgezogen worden. In einigen Jahren könnte das hier noch eine richtige Festung werden. Falls die Karrek so lange überlebten. Der Stamm allein war keine Bedrohung für Stewark oder Thorniara und umgekehrt würde es für jede Garnison ein Phyrrussieg werden, wenn sie die Karrek angreifen würden. Davon würde nur die andere Seite profitieren. Sollten in Setarrif Orks sein, die sich mit den Karrek verbündeten, dann würden die Karten auf Argaan neu gemischt werden. Die Frage war ob sich die Menschen der Städte verbünden würden oder die Orks auf ihre Art dieser Insel eine neue Geschichte geben würden. Was wäre, wenn sie den Osten beherrschen würden und dann über das Gebirge kommend noch die Silberseeburg holen würden? Sein Volk würde handeln müssen, denn sonst würde es sie isolieren. Ornlu war nicht so naiv und glaubte, dass die Neutralität dann noch irgendwie gewahrt werden würde. Es würde spannend werden.
Sie hielten an und Ornlu blickte auf. Ein großes Büffelfell auf den Schultern, die schwarze Mähne zu Kriegszöpfen gebändigt und zwei Äxte dunkler wie die dunkelste Nacht. Das Gesicht mit grauer Asche und Tierblut bemalt stand der gewaltige schwarze Ork, Häuptling und Berserker der Karrek vor dem großen Wolf. Seine Augen musterten ihn und ohne Worte blickte er zu seiner Rechten. Zu der jungen Orkin deren Fell das Schwarz des Vaters und ein Grün der Mutter besaß. Neben ihr stand eine abschätzend musternde grüne Orkin, die dem Jadewolf als Proya einmal vorgestellt worden war.
“Zasa!”, knurrte Melog sie an. Die knurrte zurück und blickte dann Ornlu an.
“Daassss…Gabaaa vohh Karrek! Daasss…Wun voohh Pall Tat'ank'ka!”, sagte die Orkin mit Widerwillen in ihrem Ton. Wie eine wütende Schlange. Als hätte man sie gezwungen die Menschensprache zu sprechen. Dann übergab die Orkin - die so groß wie Ornlu selbst war - ein Paket das nach Orkkraut roch und in dickes Ripperleder gewickelt war.
“Danke! Zasa! Danke Tat'ank'ka! Bewahret!”, wünschte der Druide und verneigte sich diplomatisch angemessen. Dann ging er los und hielt seinen Druidenstab und gleichzeitig sein Ulumulu stolz durch das Fort der Karrek. Sie sollten alle sehen, dass er in Frieden mit ihnen ging. Mertens dürften die neuen Wahrheiten interessieren.
Geändert von Ornlu (06.07.2024 um 13:33 Uhr)
-
Orkwald
Endlich! Endlich ging es los und das dann gleich mit Trommeln und Hörnern.
Die Karrek zogen los und ganz vorne war er - ihr Häuptling. Gargo schlug auf eine gewaltige Trommel die er bei sich trug und Tat'ank'ka stieß in ein großes Büffelhorn, um den Abmarsch zu befehlen.
Die Trommel gab den Takt vor und die Orks stampften in loser Formation los. Schwer bewaffnet und in Rüstungen, die nach all der Zeit auf der Insel erneuert oder erweitert wurden. Keine klassischen Teile der imperialen Orkarmee, aber angemessen für Ihr Dasein am Karrek.
Tat'ank'ka vorne weg und dahinter alle Karrek die kampffähig waren und nicht die ehrenhafte Aufgabe bekommen hatten den schwarzen Felsen und die nicht Kampffähigen zu beschützen.
Veteranen, Orkkrieger, Späher und gut ein Viertel von ihnen waren die ersten Karrekorks die in den Stamm geboren wurden. Darunter seine Tochter Zasa, die im Gegensatz zu drei ihrer Brüder, die Zeit seit ihrer Geburt durch Hunger, Schläge, Kämpfe mit anderen Heranwachsenden und vielen anderen Gefahren getrotzt hatte. Diese Auslese war hart unter den Orks, aber nur so bekam man Orks die allen Widerständen trotzen konnten.
Zwei weitere Söhne von sieben und acht Wintern blieben am Karrek.
“Glaubst du sie kämpfen?”, fragte Gorbag.
“Ich glaube nicht. Sie brauchen Orks die sich hier auskennen. Die Frage ist eher, ob wir sie brauchen.”, sagte Tat'ank'ka zu seinen Waffenbruder, mit dem er seit Faring und ihrer beider Anfänge als Orkarbeiter des Imperiums zusammen unterwegs war.
“Höchstens ihre Waffen, Ausrüstung und ihre Galeere. Hrhrhr.... Ich bin gespannt…”, entgegnete der Shak zum Urkma.
-
Bluttal – Zurück am Scheideweg des Lebens
Da saß er wieder. Er, der ewig Umtriebige. Da, wieder im Bluttal, wieder auf dem Findling, abermals allein, nur diesmal umgeben vom Regen durchnässten Gras und nirgends jemand anderes auf Durchreise. Alle schienen weitergezogen, die Menschen, die Tiere, selbst das Unwetter. Nur er war zurück geblieben, übrig nach den reinigenden himmlischen Fluten.
Arvideon hatte sich die offensichtlich einzige bereits trockene Stelle im Tal gesucht, um seine Rast einzulegen. Einiges hatte er in Stewark getan und doch hatte er unverrichteter Dinge den Rückweg antreten müssen.
Nun fühlte er sich allein, so allein wie er war und vielleicht noch etwas verlassener. Der ehemalige Hohepriester des Innoskultes vom Östlichen Archipel war müde, müde der Anstrengungen, müde der Verlassenheit, die er fühlte. Vor mehr als vierzehn Jahren hatte Adanos ihn aufgefordert zu leben, doch er fühlte sich ziellos. Es musste Sinn in seinem Leben geben, doch er sah ihn nicht. Wozu sollte er leben? Was mit seinem Leben anstellen?
Eine Antwort darauf, hatte er sich von Adanos erhofft, doch im Tempel hatte er sie nicht erhalten. Wo sollte er noch suchen? Was sollte er tun? Ziellos trudelten seine Gedanken im Kreis, genährt von dem schwülwarmen Wetter, dass auch nach dem Regen nicht nachlassen wollte.
Habe ICH dir nicht gesagt, du sollst leben und handeln, wie immer dir beliebt, Arvideon?
Arvideon schrak auf, als die zugleich machtvolle, wie auch sanfte, ja liebevolle Stimme einer Frau an sein Ohr drang. Der kleinwüchsige Wandermönch sprang auf und sah sich um. Er war immer noch allein.
Du wolltest MICH aufsuchen, Arvideon?
„Adanos?“, fragte Arvideon ungläubig. Konnte das sein?
Die Stimme die er hörte, sie war ihm so bekannt und doch gleichzeitig völlig neu. Doch ja, es war dieselbe, die er auch damals in der Wüste vernommen hatte, ganz bestimmt. Aber es war eindeutig eine Frauenstimme, war es auch damals schon die Stimme einer Frau gewesen? Dunkel schien da etwas zu dämmern, doch die Erinnerung, sie ließ sich nicht fassen.
Weitere Fragen bestürmten seinen Geist. Warum hörte er jetzt erst die Stimme Adanos‘? Wieso hier? Warum nicht im Tempel? War er hier Adanos näher?
GOTT ist den Menschen überall gleich nah, Arvideon. Hier scheint ER dir nur näher zu sein, weil du dir hier selbst näher bist., bemerkte das sanfte Timbre der Stimme belustigt und beantwortete seine Fragen, obwohl er sie nicht laut ausgesprochen hatte.
Arvideon atmete tief aus und ein. Er war erleichtert und beunruhigt zugleich.
„Der unentwegte Weitgereiste kann nicht anders als zuzustimmen: Oft entspricht die Erwartung dem naheliegenden, oft dem offensichtlichen - nicht immer aber nur das erstere auch dem letzteren.
Gerne hält das nächstliegende sich bedeckt, verbirgt sich in seiner Gewöhnlichkeit. Nicht selten scheint das Offensichtliche näher und liegt doch eigentlich so fern, weil der Weg nicht der Sichtlinie folgt, sich außerhalb des Blickfelds unendlich windet.“
Der kleinwüchsige Wandermönch ließ sich wieder nieder.
„Vor vielen Jahren wähltest DU ihn aus, er solle leben, doch er ist rastlos, ziellos, weiß nicht, wie er noch von Nutzen sein kann.“
ICH wählte dich aus, MIR mit deinem Leben zu dienen. Doch was für ein kleiner GOTT wäre ICH, würde ICH dir jeden Schritt vorschreiben, den deine Füße tun, Arvideon? Habe ICH nicht die Wesen in Freiheit erschaffen, damit sie sich ihre eigenen Pfade bahnen?
„DEIN williger Diener war bei deiner Priesterschaft, doch dort fand er nicht, wonach er suchte. Er zog weiter, fand Beschäftigung als Ratgeber und Begleiter für die Diener DEINES Bruders Innos‘, doch es nagte Zweifel an ihm, ob er nicht hätte länger aushalten, nicht hätte zurückkehren sollen, zu denen die DIR in Blau dienen.“
Wieso glaubst du, du könntest MIR nicht an anderer Stelle zu Diensten sein? Die Priesterschaft des Wassers war nie der Ort deiner Bestimmung, Arvideon.
Ihre entgegnende Frage brachte ihn etwas aus dem Konzept.
„Aber bist du nicht Adanos, der Gott des Wassers, die Priesterschaft des Wassers deine Diener? Wie kann ich DIR dienen, wenn nicht dort?“
War sein Platz bei den Myrtanäern? Sollte er am Ende gar die Feuermagier für Adanos unterwandern? War dies seine Aufgabe im ewigen Reigen der sphärischen Mächte?
Alle dienen MIR, die berufenen, wie die nicht berufenen dienen MIR. Die, die Macht haben über das Feuer, die, die Macht haben über das Wasser, selbst die, die Macht haben über die Finsternis. Im Geschenk der Macht, im Geschenk der Freiheit, im Geschenk der Existenz, im Geschenk des Lebens. Viele meinen, dass sie erwählt sind und sie sind es. Doch nur, weil alle erwählt sind, alle, die sind und die nicht mehr sind und die noch nicht sind. Niemand mehr als andere. Führung erfahren die, die Führung suchen. Nicht mehr, nicht weniger. Doch führt die Führung auch immer in die Richtung der Suche.
Arvideons Augen wurden groß, staunend hörte er zu. Konnte er dem trauen?
Traue dem, was du erkennst, Arvideon. Erst erkannten sie wie Neugeborene das Antlitz der MUTTER. Dann wurden sie älter und erkannten das Gesicht der drei BRÜDER. Nun erkennen sie langsam wieder die MUTTER, die sie einst vergaßen. So meinen sie, ihnen stünde die Weisheit des Alters, dabei wissen sie weniger, als zu ihren ersten Zeiten, erfassten zu allen Zeiten nie das ganze Bild. Wer ist BRUDER, wer SCHWESTER, wer ist VATER und MUTTER? Sind nicht VIELE EINS und das EINE VIELE zugleich? Doch sie trauen nicht der WAHRHEIT, die sie nicht verstehen, die sie nicht begreifen. Verneinen, was sie nicht begreifen. Akzeptieren nicht, dass sie nicht begreifen können.
"Was...", versuchte der alte Gnom zu begreifen, doch die Stimme ließ ihn noch nicht zu Wort kommen.
Am Morgen bin ICH die SONNE, am Abend die DUNKELHEIT und in der Nacht das LAND, das MEER, der WIND. Am MITTAG das LEBEN und der TOD, der ANFANG, der KREISLAUF und sein ENDE.
Diese Worte. Arvideon starrte wie einer, der einen Fluss gesucht und einen Ozean gefunden hatte. Er hatte es selten nötig etwas abzustreiten, so auch jetzt nicht. Er selbst hatte sich für weise gehalten, hielt sich immer noch dafür, doch konnte er das alles nicht mit dem Verstand fassen, was sein Gott, seine Göttin ihm da offenbarte. Dennoch, er spürte es, spürte die tief liegende vielschichtige Wahrheit, der er nicht widersprechen konnte, nicht widersprechen wollte und zu seiner Erleichterung auch nicht widersprechen musste. Der kleine Wandermönch war gestrandet an neuen Ufern, doch er gewöhnte sich schnell wieder an den festen Boden.
Suche meine Spuren, wenn dein bisheriger Dienst an MIR dir nicht genug ist, Arvideon.
„Wo, oh ERHABENDSTE soll der Meister des geschwungenen Wortes DEINE Führung suchen?“, fing sich der kleine Wandermönch nun doch ein wenig.
Suche sie in MEINEN NAMEN, Arvideon, suche sie in MEINEN NAMEN.
„DEINEN Namen?“
Suche MEINE Spuren, suche die Spuren des Pfades, der für dich seit Anbeginn der Zeiten angedacht. Folge dem Pfad der
ADA’E INOSIR.
-
 Lehrling
Lehrling

Bauernhof nahe Stewark
"Du wolltest doch in die Stadt oder?" fragte Gernot den einstigen Ordenskrieger. Tatsächlich hatte Thorek noch viele weitere Wochen auf dem Bauernhof verbracht und nicht nur im nahegelegenen Waldstück nach Wild gejagt, sondern gelegentlich auch bei der Feldarbeit geholfen. Dabei stellte er sich zwar nicht sonderlich geschickt an, aber die Arbeiter waren dankbar über jede helfende Hand.
Sein Ziel hatte Thorek dabei zugegebenermaßen etwas aus den Augen verloren. Eigentlich wollte er in Stewark nach Arbeit suchen und sich alsbald den Rebellen um König Ethorn anschließen. Die Frage von Gernot sollte dieses Ziel wieder in Erinnerung rufen. "Ja, das stimmt! Wieso fragt Ihr?" erwiderte Thorek. "Es müssen Werkzeuge zum Schmied gebracht werden. Er soll sie reparieren und schärfen. Das kannst du doch übernehmen?" Nachdenklich nickte der Jäger. Die Zeit war nun also endgültig gekommen und wenn er die günstige Gelegenheit nicht ergreifen würde, dann würde Thorek vermutlich auf ewig als Tagelöhner für den alten Bauern arbeiten. "Ja, das mache ich!" erwiderte er.
Gernot nickte zufrieden. "Sehr gut!" stieß er aus. "Geh am besten gleich morgen früh los! Der Schmied ist in der Nähe des Stadttores, du kannst ihn gar nicht verfehlen. Ach und sag ihm, er soll mir einen guten Preis machen, wenn ich ihn bei der nächsten Ernte nicht vergessen soll."
-
Hof südlich der Gespaltenen Jungfrau
Es machte leider alles den Anschein, als müsste sich Corsika jetzt um zwei Patienten mit Gehirnschäden kümmern. Dabei war Alfons noch harmlos, denn er rührte sich ja nicht weiter, als sich sein Brustkorb hob und senkte. Das Problem war eher Dion, der seit den Ereignissen in der Gespaltenen Jungfrau wie ein anderer Mensch daherkam. Sie hatte von so etwas schon mal gehört; Menschen, die in eine grauenvolle Schocksituation geraten waren, verdrängten diese Erlebnisse, indem sich ein bestimmter Teil in ihrem Kopf einfach schlafen legte. Bei Dion musste das mit seiner Todesangst zu tun haben, die er bis zu dem Moment noch verspürte, an dem Corsika ihr geschauspielertes Ritual durchgeführt hatte. Danach war alles anders, so als hätte sie ihn von seiner tief verwurzelten Furcht befreit. Doch nicht nur sie fehlte ihm, jetzt mangelte es ihm scheinbar gänzlich an Menschlichkeit. Er verhielt sich wie ein Untoter und war drauf und dran, den armen Jungen zu verspeisen. Sie musste etwas dagegen tun!
„Hier auf dem Hof finden wir sicher etwas anderes zu essen für dich. Gehirn ist gar nicht so lecker wie du denkst, glaub mir.“
Zumindest traf das auf rohes Gänsehirn zu. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass das bei anderen Lebewesen einen Unterschied machte.
„Wir braten es …“, schnaubte Dion nur und leckte sich vorfreudig über die wulstigen Lippen. Ein kalter Schauer legte sich wie ein Umhang über Corsikas Schultern. Was, wenn er völlig den Verstand verloren hatte und des Nachts plötzlich auf die Idee kam, an ihr herumzuknabbern?
„Wir fragen erst einmal, ob wir den Herd benutzen können“, sagte sie. „Überlass mir das Reden, okay?“
Ohne seine Reaktion abzuwarten, klopfte sie an der Tür des fremden Gehöfts an und stellte überrascht fest, dass sie offen war. Instinktiv wanderte ihre Hand zu der Sichel an ihrem Gürtel. Irgendetwas stimmte hier nicht.
„Gehen wir vorsichtig rein und …“ Sie stoppte mitten im Satz und trat einen Schritt beiseite. Ihr war eine Idee gekommen, die sie einfach nachprüfen musste. Seit Dion seinen Knacks wegbekommen hatte, verhielt er sich zwar seltsam, befolgte aber jeden ihrer Wünsche wie ein willenloser Diener.
„Geh du rein und sieh nach dem Rechten“, befahl sie. „Ich halte hier die Stellung.“
Und tatsächlich, er befolgte ihren Wunsch, ohne zu murren. Lediglich sein Magen gab ein unzufriedenes Knurren von sich, aber auch das legte sich, als er endlich drinnen war.
„Und, alles in Ordnung?“, fragte Corsika nach einer Weile, als er sich nicht mehr zu Wort meldete. Als keine Antwort kam, betrat sie selbst die Stube.
Es handelte sich um eine schlichte Hütte mit einem großen Raum, der sowohl zum Arbeiten, Essen, als auch Schlafen genutzt wurde. Jetzt war anscheinend gerade Essenszeit, denn der große Holztisch im Zentrum war für mindestens vier Personen gedeckt und in dessen Mitte wiederum stand – bildschön drapiert – ein saftiger Braten, in den sich der hungrige Adlatus längst verbissen hatte. Von den Bewohnern des Hofes fehlte nach wie vor jede Spur.
„Hey, lass mir gefälligst auch was übrig“, schimpfte Corsika und bewaffnete sich bereits mit einer Gabel. „Das ist ein Befehl!“
-
 Lehrling
Lehrling

„Fleiiiisch…“, grunzte Dion nur zur Antwort und stopfte sich ein weiteres Stück des Bratens in den Mund, das er mit bloßen Händen abgerissen hatte. Ein wenig ekelte er sich dabei vor sich selbst. Er war immerhin gut erzogen worden und da hatte auch eine gewisse Etikette beim Essen mit dazugehört. Messer und Gabel trug er in seiner Gürteltasche bei sich. Das Problem war nur: wie jedermann wusste, aßen Zombies eben nicht zivilisiert, sondern schlangen ihren Fraß in sich hinein, wie … Zombies eben. Also blieb ihm keine Wahl. Ab jetzt wurde mit den Händen gegessen!
Dass er jedoch kaum auf Corsikas Befehl reagierte, ihr etwas übrig zu lassen, überraschte ihn. Es musste wohl so etwas wie eine Art Instinkthierarchie bei Untoten geben? Erst kam das Fressen, dann das Gehorchen? Ja, das musste es sein, das klang vernünftig! Und außerdem musste sich Corsika keine Sorgen machen – der Braten hätte auch für vier gereicht, sogar wenn man Dions Appetit als Untoter in die Rechnung mit einbezog. Ein Zombie konnte zwar nicht satt werden (nahm Dion jedenfalls an), aber irgendwann war er einfach voll.
Beim (Fr)essen waberten dem Adlatus allerlei Fragen durch den Kopf. Warum war die Hütte scheinbar verlassen, aber ein üppiges Mahl angerichtet? Das passte nicht zusammen. War es moralisch vertretbar, den Besitzern einfach ihr essen wegzuessen, auch wenn sie gerade nicht zu sehen waren? Zum Glück waren Denken und Moral zwei Dinge, die er ab sofort den Lebenden überlassen konnte. Als Zombie war er schließlich kaum mehr als ein Automat, der Befehlen und Instinkten folgte. Alles andere war jetzt Corsikas Aufgabe.
Als er sich schließlich den Wanst so vollgeschlagen hatte, dass er beim besten Willen kein noch so hauchdünnes Minzplättchen mehr hätte essen können, ohne zu platzen, lehnte sich Dion mit einem zufriedenen Seufzer zurück und schloss für einen Moment die Augen. Der Braten war köstlich gewesen – er bezweifelte, dass sogar Alfons‘ Hirn hätte besser schmecken können. Manchmal war das Leben – halt, nein, der Untod! – doch gar nicht so schlecht …
„Sieh mal nach, was der Bengel macht!“, wies ihn Corsika an, die sich gerade noch eine Scheibe vom Braten herunterschnitt. Gehorsam wankte Dion zu Alfons herüber, den er auf einer Bank in der Nähe des Kamins abgelegt hatte. Der Atem des Jungen ging noch immer flach, aber gleichmäßig.
„Nichsssss neussss…“, konstatierte Dion nuschelnd und fügte noch ein zünftiges Untoten-Stöhnen an.
„Kannst du irgendwas tun, dass er wieder zu sich kommt?“
Dion schüttelte den Kopf. Die oberflächlichen Verletzungen des Jungen hatte er behandelt, so gut er konnte, aber die waren nur leichter Natur. Der Grund für Alfons‘ andauernde Bewusstlosigkeit musste tiefer liegen – da hätte er schon das Gehirn des Burschen in Augenschein nehmen müssen. Corsika kratzte sich nachdenklich am Kopf.
Bevor sie aber einen Entschluss fassen konnte, lenkte ein lautes Pochen und Meckern die Aufmerksamkeit der beiden auf sich: Es war Timo, der sich, statt beim Rest der Herde im Hof zu bleiben, wohl während des Essens unbemerkt ins Haus geschlichen hatte und nun an einer Stelle vor der dem Kamin entgegengesetzten Wand auf und ab sprang. Seine Hufe verursachten dabei ein Geräusch, als würde er auf einem leeren Fass herumhüpfen.
„Timo!“, grunzte Dion und erhob sich schnaufend, um zu dem kleinen Ziegenbock hinüberzuschlurfen. Das Tier legte den Kopf schief und sah ihn mit seinen gelben und beunruhigend intelligent wirkenden Augen an, bevor es noch einen Hopser tat und dann mit der Nase irgendetwas auf dem Boden vor sich anstupste. Dion kniete sich nieder und wischte Sand und Sägespäne bei Seite.
„Eine Kellerklappe!“, stellte er überrascht fest und vergaß dabei sogar, wie ein Zombie zu klingen.
-
Vicious trottete die Straße entlang, die von Thorniara in das Umland führte. Geradewegs in Richtung Bluttal. Das Ziel war eine Hütte unweit der Mündung zum Tal. Ganz so wie es die beiden Kinder gesagt hatten. Was hatte sie nur dazu bewogen, diesem Hirngespinst nachzugehen? In erster Linie wohl Langeweile. Dann noch die Aussicht auf eine Belohnung. Das wäre das Naheliegendste. Doch hatte die Kopfgeldjägerin gar nichts gegen Langeweile. Ganz im Gegenteil. Sie liebte es, zu faulenzen. Und obendrein war es äußerst fraglich, ob sie tatsächlich eine Belohnung erhalten würde. Oder überhaupt einen Auftrag. Was also trieb sie? Vicious hatte nicht den blassesten Schimmer. Sie war einfach losgegangen und ihrer Nase gefolgt.
In der Ferne blökten Ziege und Schafe. Das musste es sein. Je weiter sich die Fremdländerin von der Stadt entfernt hatte, desto seltener waren die Häuser geworden. Hier und dort stand noch ein Kotten in der Wiese. Selbst das hatte bald aufgehört. Nun waren es nur noch Wiesen und Wälder. Vor einer Weile hatte ein heruntergekommenes Straßenschild auf das Bluttal verwiesen und Vicious konnte bereits die Ausläufer des Gebirges erkennen, die das Tal wie eine Mauer vom hiesigen Teil der Insel abtrennten. Nur das Blöken gab einen Hinweis darauf, dass hier tatsächlich jemand lebte.
Die Kopfgeldjägerin folgte den Geräuschen und meinte einen Trampelpfad vor sich zu sehen. Wer auch immer hier lang kam, tat es nicht oft. Schließlich lichtete sich die Bewaldung vor Vicious und gab den Blick auf ein winziges Häuschen frei. Davor befand sich ein kleiner Kräutergarten, in dem auch einige Sonnenblumen standen. Sie reichten der Fremdländerin bis zum Haupt. Zwischen all den Blumen, Kräutern und Büschen tummelten sich ein gutes Dutzend Ziegen und Schafe.
Plötzlich dröhnte ein tiefes Bellen an Vicious' Ohr. Ein riesenhafter Hirtenhund preschte zwischen den anderen Tieren hervor und stellte sich schützend vor die Herde. Zähnefletschend knurrte er die Kopfgeldjägerin an, als wollte er sagen 'keinen Schritt weiter!'.
Eine zarte Stimme rief aus dem Haus und der Hund spitzte sofort die Ohren. Vicious ließ er trotzdem keinen Moment aus den Augen.
»Was ist denn los, Benno?«
Eine rüstige, alte Frau kam aus dem Häuschen. In der Hand hielt sie ein Hackebeil.
»Wer bist du?«, fragte sie die Fremdländerin forsch. »Wenn du gekommen bist, um mich auszurauben, denk noch mal drüber nach!«
Die Großmutter machte keine Anstalten, den großen Hund zurückzupfeifen.
»Ich bin gekommen, um den Wolf umzulegen.«, sagte Vicious.
»Was? Welchen... Woher weißt du von dem Wolf? Wer bist du überhaupt?«, fragte die alte Frau sichtlich verwirrt.
»Vicious nennt man mich.«, antwortete die Fremdländerin. »Zwei kleine Burschen in der Stadt haben mir von ihrer Omi und dem bösen Wolf erzählt.«
Mehr Verwirrung machte sich im Gesicht der Großmutter breit.
»Torsten und Torben. So heißen sie.«, ergänzte Vicious. »Falsches Haus?«
Beim Nennen der beiden Namen meinte die Kopfgeldjägerin eine Veränderung in der Alten erkennen zu können.
»So heißen meine Enkel.«, sagte sie schließlich. »Was bei Beliar hast du mit meinen Enkeln zu schaffen?«
»Sie haben mich auf dem Markt angesprochen. Erzählten mir, dass ihre Omi Hilfe mit einem Wolf braucht. Sie dachten ich sei...«, kurz pausierte Vicious. »Sie sagten, ich sehe aus wie ein Hexer, wie ein Monsterjäger.«
Innerlich bereute die Fremdländerin inzwischen gekommen zu sein. In ihrem Kopf konnte sie sich das alles noch verargumentieren. Doch wenn sie es aussprach, hörte es sich wirklich dumm an.
»Das sind doch nur Geschichten.«, antwortete die Frau.
»Der Wolf auch?«
»Der ist sehr echt und lebendig.«
»Gegen Bezahlung erschlag ich das Ding.«
»Bei Fuß, Benno!«, rief die Alte den Hund zu sich, der sofort gehorchte. »Das ist nicht so einfach. Komm. Ich habe frische Limonade gemacht. Bei einem Glas werde ich dir alles erklären. Ach, bevor ich es vergesse. Ich bin Erika.«
-
Eigentlich hatte auch Corsika genug Hunger, um zumindest ein Viertel des ganzen Bratens zu verputzen. Doch die vielen Ungereimtheiten in dieser Situation ließen sie zögern. Es musste einen logischen Grund dafür geben, warum die Bewohner des Hauses sich nicht hier beim Essen versammelten, sondern sich entweder versteckten oder den Hof verlassen hatten. Im schlimmsten Fall handelte es sich um eine perfide Falle und sie waren schon längst hineingestolpert. Corsika rechnete bereits damit, von einem Pfeil erwischt zu werden, aber dafür verhielten sich die Tiere draußen viel zu ruhig. Und wenn das Essen vergiftet war? Es wäre dann schwer zu sagen, ob sich Dion wegen seines vorherigen Sinneswandels oder des Giftes so eigenartig verhielt. Sie würde ihn wohl einfach noch eine Weile beobachten müssen und später etwas vom Braten essen. Auch wenn das saftige Stück geradezu verführerisch von ihrer Gabel auf den Teller rutschte. Sie war kurz davor, es zu riskieren, als sie plötzlich Dion nach seinem Lieblingsziegenbock rufen hörte.
Sie war schneller auf den Beinen als ihr korpulenter Begleiter und schlich sich, so gut es ihr eben möglich war, in Richtung der Klappe, die Timo entdeckt hatte. Wenn da drinnen jemand auf einen Überraschungsangriff wartete, dann hatte er den passenden Moment definitiv verpasst. Corsika besah sich vorsichtig die Klappe und erkannte ein einfaches Loch, durch das man den Finger stecken konnte, um sie zu öffnen. Sie lief aber erst einmal zum Kamin, schnappte sich den Schürhaken und stach ihn durch das Loch. Doch von da unten zeigte sich keine Reaktion.
„Na gut, schauen wir mal, ob sich da unten im Keller noch ein paar Fässer Wein verstecken.“
Sie reichte Dion den Schürhaken und ging selbst wagemutig mit ihrer kleinen Sichel bewaffnet voran. Der Keller war nur schwach durch ein schmales Fenster beleuchtet und führte kaum tiefer als anderthalb Meter. Sie musste sich bücken und da sie keine Fackel dabeihatte, stolperte sie glatt über einen alten Sack, der mitten auf dem Boden herumlag.
„Ach nicht schon wieder“, schimpfte Corsika, als sie erkannte, dass es sich bei dem Objekt nicht um einen Sack Gerste handelte, sondern tatsächlich um einen Mann höheren Alters, der gefesselt hier unten lag. Dieser alte Sack war zumindest nicht bewusstlos, sondern nur geknebelt. Sie entfernte ihm den Stofffetzen aus dem Mund und ließ ihn erst einmal zu Atem kommen.
„Meine Frau“, japste er und deutete mit einem Nicken zur Wand an der gegenüberliegenden Seite des Fensters. Corsika konnte eine weitere Gefangene erkennen und krabbelte zu ihr, um auch ihr zumindest den Knebel am Mund zu entfernen.
„Seid Ihr bei Sinnen?“, fragte die Fremde.
„Ich schon“, erwiderte Corsika, die lieber nur für sich selbst sprach. Ihr Begleiter steckte gerade den Kopf durch die Kellerluke.
„Was ist hier passiert?“, fragte Corsika. Sie wollte das ältere Pärchen erst befreien, wenn sie sicher war, dass von ihnen keine Gefahr ausging.
„Der Schamane“, entgegnete die Gefangene leise. „Er bereitet ein Opfer vor. Wir müssen schnell fort von hier und unseren Sohn finden, bevor er ihn in die Finger bekommt.“
„Meint Ihr zufällig einen Jungen namens Alfons?“
„Ja … ja! Mein Alfons! Habt Ihr ihn getroffen?“
Corsika nickte. Für sie ging von den beiden Alten keine Gefahr aus, wenn man mal von der schlechten Erziehung absah, die sich im Verhalten des Jungen widergespiegelt hatte. Vielleicht konnten sie dem Jungen helfen.
„Dion! Komm runter und hilf mir, die beiden zu befreien.“
„Hääh … hngh …“
„Und lass das Theater jetzt endlich gut sein, wir sind vielleicht in Gefahr.“
„Aber ich … hnnnghng …“ Er japste. „Ich stecke fest.“
-
 Lucky 7
Lucky 7

Venom schritt mit festen Schritten voran, während sich die Obstbäume dicht um ihn und seine Gefährten schlossen. Das Zwitschern der Vögel und das Rascheln des Windes in den Blättern waren die einzigen Geräusche, die ihre Schritte begleiteten. Die Spur von Draven hatte sich langsam verloren, und das flaue Gefühl im Magen, das Venom schon seit ihrem Aufbruch begleitete, verstärkte sich.
„Sieht aus, als hätte der Kerl sich aufgelöst“, murmelte Hailey hinter ihm, wobei ihre Stimme eine Mischung aus Spott und Erleichterung verriet. Sie mochte Draven nicht – das wusste Venom. Doch er wusste auch, dass es für sie mehr als nur Abneigung war. Da lag Hass, tief verwurzelt, zusammen mit etwas, das Venom nicht ganz greifen konnte.
„Oder er hat uns eine Falle gestellt“, erwiderte Venom leise, ohne sich umzudrehen. Die letzten Worte hallten in seinem Kopf nach, während er versuchte, seine Gedanken zu sortieren. Er liebte die Pirsch, die Jagd, doch diese Spur führte ins Nichts. Und er spürte das Chaos, das in ihm brodelte. Es war ein Gefühl, das er zu unterdrücken versuchte – zu gefährlich, zu verwirrend.
Colbart keuchte hinter ihnen, offenbar froh über die Pause. „Verdammte Hitze“, murmelte er, während er mit einer Hand den Schweiß von seiner Stirn wischte und sich gegen einen Baumstamm lehnte. „Diese Spur... sie führt ins Nichts. Vielleicht ist der Kerl längst über alle Berge.“
„Oder er ist näher, als wir denken.“ Haileys Augen funkelten, wie sie es oft taten, wenn sie sich einer Herausforderung näherte. Venom erkannte in diesem Blick sowohl ihre Spielfreude als auch ihre Ungeduld. „Vielleicht wartet er nur darauf, dass wir uns verheddern.“
Sie war unberechenbar, wie immer. Und doch spürte Venom, wie eine tiefe Zuneigung in ihm aufstieg – eine Zuneigung, die ihn irritierte. Waren ihm solche Gefühle doch eigentlich fremd und jetzt war erst recht keine Zeit dazu. Er war Venom und er durfte sich nicht von seinem eigenen Herzen schwächen lassen.
„Wir machen weiter“, sagte er schließlich und drehte sich zu den beiden um. „Der Pass liegt vor uns. Wenn wir Glück haben, führt er uns näher an Draven heran.“
Colbart stöhnte leise, doch Hailey lächelte. Sie war immer bereit, weiterzugehen, selbst wenn der Weg noch so gefährlich war. Doch Venom wusste, dass ihre Furchtlosigkeit oft aus dem fehlenden Blick für die Konsequenzen stammte.
Während sie weitergingen, glitt sein Blick immer wieder zu Hailey. Sie ging vor ihm her, leichtfüßig, fast verspielt. Ihr Speer schwang lässig an ihrer Seite, und ihr kurzes, unruhiges Lachen brach die Stille der Obsthaine. Es war dieses Lachen, das ihn quälte, das ihn an das erinnerte, was er niemals haben konnte.
Er spürte, wie sich seine Brust zusammenzog, und richtete seinen Blick starr nach vorne. Er musste sich auf das Wesentliche konzentrieren: Draven finden, ihn unschädlich machen, und dann wäre endlich Ruhe.
„Venom?“ Ihre Stimme riss ihn aus seinen Gedanken.
„Ja?“ Seine Antwort klang rauer, als er beabsichtigt hatte.
„Was machst du, wenn wir ihn finden?“ Ihre Augen hatten diesen leichten Glanz, der ihm sagte, dass sie auf mehr als nur eine einfache Antwort hoffte.
Er schnaubte und schaute sie nicht direkt an. „Draven? Ich werde ihn töten.“ Es war die einzige Antwort, die er geben konnte, die einzige, die seine Rolle als Anführer bewahren würde. Doch in ihm schrie etwas auf, als sie nickte und ihr Blick kurz zu Boden wanderte.
„Komm, wir haben noch einen Weg vor uns“, sagte er schließlich und setzte sich in Bewegung. Hailey folgte ihm ohne weiteres Wort, und Colbart holte schnaufend auf.
Venom warf einen letzten Blick auf sie, bevor er sich wieder nach vorn richtete. Ihre Schritte waren leicht, und doch wusste er, dass sich die Schwere der unausgesprochenen Worte zwischen ihnen ausbreitete.
-
 Lucky 7
Lucky 7

Die Bäume ragten hoch und dicht um sie herum auf, ihre Kronen bildeten ein dichtes Dach aus Blättern, das das Licht der sinkenden Sonne nur spärlich hindurchließ. Die Geräusche des Waldes – das Rascheln des Laubs, das Zwitschern der Vögel und das Knacken von Ästen – umgaben sie, während sie durch das Bluttal schritten. Der befestigte Pass lag hinter ihnen, und mit ihm die Hoffnung, Dravens Spur zu finden. Es war, als wäre er im Nichts verschwunden.
„Das führt doch zu nichts“, murrte Colbart, der schon seit einer Weile nur mühsam mit ihren Schritten mithielt. Er schleppte sich mit gesenktem Kopf hinter ihnen her, sichtlich erschöpft. „Wir sollten umkehren. Draven hat uns reingelegt.“
Venom antwortete nicht sofort. Seine Augen durchkämmten die Umgebung, suchten nach Anzeichen, nach irgendetwas, das ihm verriet, dass sie auf dem richtigen Weg waren. Doch außer den dichten Laubwäldern, den verschlungenen Wegen und den schier unendlichen Baumreihen gab es nichts. Kein Zeichen von Draven, keine Spur. Es war, als hätte der Mann sich in Luft aufgelöst.
„Venom?“ Haileys Stimme war ruhig, aber auch sie schien etwas von der Unsicherheit zu spüren, die sich wie ein Schatten über die Gruppe legte.
Venom hielt inne und drehte sich zu ihr um. Sie war nicht die einzige, die Fragen hatte. Auch in ihm brodelten Zweifel. Warum war Draven verschwunden? Hatte er die Stadt tatsächlich verlassen, oder war dies alles Teil eines größeren Plans? Diese Unklarheit nagte an ihm.
„Wir schlagen hier ein Lager auf“, sagte Venom schließlich, während er sich umsah. „Es wird bald dunkel. Wir brauchen eine ruhige Nacht, um unsere Kräfte zu sammeln.“
Colbart schnaubte erleichtert auf, während Hailey mit einem Nicken zustimmte. Auch wenn sie nichts sagte, erkannte Venom die leichte Spannung in ihren Schultern. Sie machte sich Sorgen, auch wenn sie es nicht offen zeigen wollte.
Gemeinsam suchten sie nach einem geeigneten Platz. In einer kleinen Lichtung, abgeschirmt durch Felsen und dichte Büsche, fanden sie schließlich einen Ort, der ausreichend Schutz für die Nacht bot. Venom begann, mit Hailey das Lager aufzubauen, während Colbart das Feuer entzündete.
Die Flammen loderten bald hoch und tauchten die Umgebung in warmes Licht. Der Rauch stieg leise in den Himmel und vermischte sich mit den Gerüchen des Waldes. Doch auch das Feuer vermochte es nicht, die kühle Beklommenheit zu vertreiben, die sich in die Gruppe eingeschlichen hatte.
Venom saß auf einem umgefallenen Baumstamm, den Blick auf die Flammen gerichtet. Seine Gedanken wanderten zurück zu Draven. Etwas stimmte nicht, das spürte er. Doch genauso klar war ihm, dass sie nicht ewig in diesem Tal umherirren konnten. Wenn Draven wirklich verschwunden war, dann musste es einen Grund dafür geben.
„Was, wenn er uns voraus ist?“ fragte Hailey plötzlich, während sie neben Venom Platz nahm. Ihre Augen ruhten auf den Flammen, doch ihre Stirn war in Falten gelegt. „Was, wenn er genau das geplant hat? Dass wir uns hier verlaufen, während er weiterzieht?“
Venom sah sie aus dem Augenwinkel an. Ihre Worte trafen einen Nerv. Draven war kein Mann, der etwas dem Zufall überließ. Wenn er tatsächlich voraus war, dann würde er einen Vorteil haben. Einen tödlichen.
„Möglich“, gab Venom zu, doch er wollte ihr nicht alle seine Gedanken offenbaren. „Aber er hätte einen Fehler gemacht. Jeder lässt irgendwann Spuren zurück.“
Hailey lächelte schief, als hätte sie nicht viel Vertrauen in seine Worte. „Das ist wahr. Hast du eine Idee was er vorhaben könnte?“
Venom wich ihrem Blick aus. „Nein. Nur du hast ihn wirklich gekannt.“
Schweigen breitete sich aus. Venom spürte, wie die Beklommenheit, die er zu verdrängen versucht hatte, langsam in ihm aufstieg. Es war nicht nur die Jagd auf Draven, die ihn beschäftigte, sondern auch Hailey. Er hatte diese Gefühle lange unterdrückt, doch in Momenten wie diesen, wenn sie sich so nah waren und das Feuer vor ihnen tanzte, fühlte er, wie sein Widerstand schwand. Er durfte sich das nicht erlauben. Nicht hier. Nicht jetzt.
Hailey schien seine Unruhe zu spüren. Sie blickte ihn an, ihre Augen forschten in seinem Gesicht, als wollte sie etwas finden, das ihm selbst nicht bewusst war. Doch er schwieg, lenkte seine Gedanken zurück auf das Wesentliche: Draven, die Jagd, die Gefahr, die vor ihnen lag.
„Du warst immer der, der einen klaren Kopf behält“, sagte Hailey leise, fast sanft. „Das ist es, was uns vorwärts bringt.“
Venom schnaubte leise. „Vielleicht. Aber manchmal frage ich mich, wohin uns das führt.“
Sie lächelte. Es war ein Lächeln, das Wärme ausstrahlte, aber auch etwas Wehmütiges hatte. „Ich glaube, wir wissen beide, dass du mehr bist als das, was du dir selbst zugestehst.“
Venom spürte, wie sein Herzschlag schneller wurde. Er wollte etwas sagen, irgendeine Antwort, doch die Worte blieben ihm im Hals stecken. Hailey sah ihn noch einen Moment lang an, bevor sie sich zurücklehnte und die Augen schloss.
Er blickte auf das Feuer und die Glut, die in der Nacht aufstieg. Es war nicht einfach. Die Nähe zu Hailey machte ihn verletzlich, und Verletzlichkeit war eine Schwäche, die er sich nicht leisten konnte. Nicht jetzt. Nicht bei dem, was noch vor ihnen lag. Aber sie hatte recht: Er war nicht nur der Jäger, nicht nur der Krieger. Da war mehr in ihm, etwas, das er lange Zeit ignoriert hatte.
Die Nacht zog über das Bluttal herein, und mit ihr kam die Kälte. Die Dunkelheit schien das Lager zu umschlingen, während der Wald in Stille versank. Nur das Feuer hielt die Finsternis in Schach.
Venom saß regungslos da, den Blick in die Ferne gerichtet. In ihm tobte ein Kampf, den er nicht gewinnen konnte – ein Kampf zwischen der Dunkelheit, die ihn umgab, und der leisen Hoffnung, die Haileys Worte in ihm geweckt hatten.
Doch er durfte sich nicht von ihr ablenken lassen. Draven war draußen, irgendwo in diesem Tal, und solange er atmete, gab es keine Ruhe.
-
 Lehrling
Lehrling

Früher am Abend, auf einem kleinen Bauernhof südlich der Gespaltenen Jungfrau
„Hnnnng … grrrrrh … pffff!“, japste Dion und versuchte, sich durch die enge Kelleröffnung zu quetschen. Erfolglos. Ob er mit den Beinen strampelte oder sich mit den Armen abdrückte – er bewegte sich keinen Millimeter. Sein Bauch und Hinterteil waren fest zwischen den Wänden der Kellertreppe eingeklemmt.
„So ein Mist!“, fluchte er. Wie hatte das nur passieren können? War er wirklich so … wohlgenährt, dass er nicht einmal mehr durch eine Kellerluke passte? Aber das konnte doch nicht sein, oder? Einen Moment lang zweifelte Dion an sich selbst, doch dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: Als Zombie konnte er zwar sehr viel fressen, aber er hatte ja gar kein funktionierendes Verdauungssystem mehr! Daran musste es liegen! Der Braten, den er in sich hineingeschlungen hatte, hatte seinen Leib so aufgebläht! Und jetzt würde er hier stecken bleiben, bis …
„Äh … Corsika … wann fange ich an, zu verwesen?“
Die Antwort von unten war unverständlich. Zu dumm, dass man im Hintern keine Ohren hatte! Dion versuchte noch ein paar Mal, sich zu befreien, gab dann aber erschöpft auf. Timo beobachtete ihn dabei die ganze Zeit und stieß ab und zu ein leises Meckern aus, das verdächtig nach spöttischem Gekicher klang.
„Jaja! Lach du nur! Wenn du ein Zombie wärst, der feststeckt, dann würdest du nicht so–“
Auf einmal fingen die Schafe, Ziegen und Gänse im Hof an zu blöken, zu meckern und zu schnattern in einer Lautstärke, dass Dion sich die Ohren zuhalten musste. Was war da nur los? War etwa ein Wolf auf den Hof gekommen? Timo fuhr herum und senkte demonstrativ den Kopf, die kleinen Hörnchen drohend auf die Tür gerichtet.
Schlurfende Schritte näherten sich von draußen, untermalt von Geklapper und Geklimper…
Die Tür flog auf und der grauenhafte Anblick ließ Dion ungewollt einen spitzen Schrei ausstoßen. Ein verhutzeltes Männlein, kaum größer als ein Schaf, stand im Türstock. Es trug nichts als einen Lendenschurz aus grobem Leder, der mit zahlreichen Knochen, Pflanzenbüscheln und Münzen verziert war, in die Löcher gebohrt worden waren, so dass man sie an Schnüren auffädeln konnte. Die runzlige Haut des Männleins war von grau-grüner Farbe, primitive Muster waren mit getrocknetem Schlamm und Blut auf seinen nackten Oberkörper gezeichnet. Es hatte eine breite, platte Nase und spitze Ohren und seine kleinen gelben Augen funkelten boshaft. Ein Goblin!
„Eiiiii!“, schnarrte der Goblin und fuhr sich mit seiner langen Zunge über die rissigen Lippen. Sein Mund war gespickt mit spitzen, fauligen Zähnen. „Guuuutes Fang, ja-ja!“
Der Goblin kicherte und trat in die Hütte. Er hielt einen knorrigen Stock in den Händen, der ihn um eine gute Haupteslänge überragte und an dessen gebogenem oberen Ende ähnliche Verzierungen hingen wie am Lendenschurz – Dion erkannte die Unterkiefer von Raubtieren neben Federn, Münzen, Glasscherben, bunten Steinchen… Die Schmuckelemente hingen allesamt an Schnüren aus Leder oder getrockneten Pflanzenfasern und Klickten und Klackten bei jeder Bewegung. Für Dion hörte es sich an, wie sich ein widerbelebtes Skelett anhören musste, wenn es sein Opfer (also ihn!) verfolgte, um sich an dessen Lebensessenz gütlich zu tun (oder was auch immer Skelette mit ihren Opfern anstellten, er war zum Glück noch keinem begegnet) …
„W-w-was willst du?“, stammelte Dion. Der Goblin musterte ihn und sein Grinsen wurde immer breiter.
„Grooooßes Opfer! Fettes Opfer! Eiiiii!“, verkündete er und nickte, sichtlich zufrieden. Dann hob er seinen Stab, legte den Kopf in den Nacken und begann, einen seltsamen, kehligen Singsang auszustoßen. Die Worte waren für Dion vollkommen unverständlich, aber er konnte sie – fühlen! Sie fühlten sich nach Macht an, nach Macht und Boshaftigkeit! Fast so, wie der Zauber, mit dem Corsika ihn in einen Zombie verwandelt hatte …
Der Singsang des Goblins wurde immer lauter, seine Stimme viel dröhnender und durchdringender, als es für ein Wesen seiner Größe möglich sein sollte. Zugleich hatte Dion das Gefühl, dass es im Raum kälter und dunkler wurde – die Härchen an seinen Armen stellten sich auf und ihn fröstelte.
Das, so musste er feststellen, würde aber bald sein geringstes Problem sein – denn der Goblin erhielt eine Antwort! Ein tiefes, langgezogenes Brüllen aus den Wäldern, die Stimme einer Bestie, die gewaltig sein musste. Sie kam dem Adlatus unangenehm bekannt vor. War es nicht eben dieses Gebrüll gewesen, vor dem er sich in einer Höhle im Wald hatte verstecken wollen, wodurch er erst auf Corsika gestoßen war? Jetzt hatte ihn seine Flucht über Umwege wohl direkt ins Maul der Bestie geführt, denn der Goblin hatte ganz offensichtlich nichts anderes vor, als ihn dem Monster als Opfer darzubringen! Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, dass er ein Zombie war! Jetzt konnte ihn nur noch ein Wunder retten! Dion schloss die Augen, faltete die Hände vor der Brust und fing an, zu beten.
Poltern. Scheppern. Der Gesang stoppte abrupt und der Goblin kreischte. Unbändige Wut lag in seinem Gezeter. Verzerrtes Meckern, das beinahe so klang, als wollte es menschliche Worte formen, am Ende aber doch nur unverständliche Silben hervorbrachte.
„Aaaah, kleiner Sückmist!“, fluchte der Goblin. Dion öffnete zögerlich die Augen und sah Timo breitbeinig über dem am Boden liegenden Schamanen stehen. Der Ziegenbock hielt den Kopf bedrohlich gesenkt und fletschte die Zähne wie ein Raubtier.
„Shuuuuub!“, krächzte er. „Niiigh! Fhtagn!“
Der Goblin stieß Timo von sich und rappelte sich auf. Er holte mit seinem Stab aus, um nach dem Böcklein zu schlagen, hielt aber mitten in der Bewegung inne, als erneut ein lautes Brüllen von außen ertönte. Lauter diesmal. Näher, viel näher…
… und es klang wütend!
Der Goblin stieß ein Wort aus, das keiner Übersetzung bedurfte, um zu wissen, dass es sich um eine Unflätigkeit handeln musste, und rannte zur Tür hinaus, ohne sich noch einmal umzudrehen. Timo meckerte ihm triumphierend hinterher, aber Dion war sich leider sehr sicher, dass der Goblinschamane nicht vor dem kleinen Ziegenbock geflohen war.
Schritte näherten sich von draußen.
Schritte von etwas… sehr, sehr Großem!
-
Corsika hätte sich liebend gern selbst ein Bild von der Situation gemacht, von dem epischen Duell zwischen der Ziege Timo und dem finsteren Gesellen, der ihrem doch nicht ganz so toten Begleiter in Angstschweiß baden ließ, doch ihr blieb nicht mehr als der Blick aus dem schmalen Kellerfenster. Ein Schaf trottete daran vorbei und blockierte ihr die Sicht. Doch schon im nächsten Moment wurde es laut mähend angehoben, ein brachiales Knirschen war zu vernehmen und nichts als ein Fetzen ausgerissener, blutiger Wolle landete vor dem Fenster.
„Was zum …?“
Corsika fiel panisch zurück und krabbelte rückwärts tiefer in das Loch. Zwischen ihr und diesem gewaltigen Monster, das da draußen über die Hoftiere herfiel, stand nur eine lächerliche Kellerklappe und die war ausgerechnet mit ihrem schreienden Begleiter verstopft.
„Verflixt, wenn der so weiterbrüllt, wird dieses Vieh noch auf uns aufmerksam!“, teilte Corsika ihre Gedanken mit dem alten Bauernehepaar, das sich ebenfalls hier im Keller versteckte. „Helft mir mal, ich nehme das eine Bein und ihr das andere und dann ziehen wir.“
Gesagt, getan, doch Dions Körperwiderstand war der eines noch lebenden Wesens. Ein Untoter hätte weder gebrüllt noch besäße er eine so intakte Körperspannung.
„Wenn du den Bauch nicht einziehst, schneide ich dir ein Stückchen heraus!“, drohte Corsika und endlich, mit einem lauten Ploppen, als hätte sie eine Weinflasche entkorkt, purzelte der Adlatus zu ihnen hinab und riss sie alle mit zu Boden. Gleich hinterher folgte ihm die Ziege Timo und damit nicht genug; der Bock zerrte ebenfalls den ohnmächtigen Jungen am Kragen hinterher, als wolle er ihn wirklich vor dem Bösewicht und seinem riesenhaften Haustier beschützen.
„Schnell die Klappe zu!“, rief jemand, aber dazu war nicht einmal die geschickte Ziege fähig. Corsika befreite sich aus dem Körperknäuel und schloss den Keller ab. Alles, was ihnen jetzt noch blieb, war zu hoffen, dass das Monster sich an den Tieren draußen sattessen würde. Ob Corsikas Gänse wohl eine Chance zur Flucht hatten?
Ein lautes Rumoren ließ sie aufschrecken. Es kam von drinnen.
„Ich glaube dein Verwesungsprozess hat begonnen“, stellte Corsika nüchtern fest. Der viele Braten hatte ihrem Begleiter wohl zu sehr auf den Magen geschlagen. Eine schwere Überlebensprobe für sie alle.
Die nächste Stunde verbrachten sie in unbeschreiblicher Angst vor dem Unbekannten. Dion klärte sie über die Begegnung mit dem Goblin auf und das alte Ehepaar erklärte in kurzen Worten, dass sie der Magie dieses kleinen Gesellen zum Opfer gefallen waren und den Braten für ihn und seine Bestie vorbereitet hatten, dann jedoch gefesselt und als Nachspeise in den Keller geworfen worden waren. Aber anscheinend hatte es sich der Goblin jetzt anders überlegt und sich nach dem Kampf mit der Ziege aus dem Staub gemacht, um nicht selbst zum rituellen Opfer seiner unkontrollierbaren Bestie zu werden.
„Hätte ich es nicht selbst erlebt, würde ich glaube, diese Geschichte hätten sich zwei Idioten im Vollsuff ausgedacht“, merkte Corsika an. Wie dem auch sei, irgendwann schien die Luft rein zu sein, denn die schweren Schritte des Monsters verhallten allmählich in der Ferne.
-
 Lucky 7
Lucky 7

Der Wald des Bluttals war still, abgesehen vom leisen Rascheln der Blätter unter ihren Füßen und dem fernen Rufen von Vögeln. Venom ging voraus, gefolgt von Hailey und Colbart, die in gebührendem Abstand schritten. Ihre Schritte wurden langsamer, als sie die Spuren entdeckten: tiefe Fußabdrücke im feuchten Waldboden, die eindeutig in östlicher Richtung führten.
„Das könnte er sein,“ murmelte Hailey leise und blickte zu Venom, der mit verschränkten Armen auf die Abdrücke starrte.
„Vielleicht,“ sagte er, ohne den Blick von den Spuren abzuwenden. „Aber wir wissen nicht, ob er allein ist oder was uns erwartet.“
Venom war angespannt, seine Augen verengten sich, während er die Umgebung prüfte. Die Spur war frisch, doch etwas an der Situation ließ ihn zögern. Ein Gefühl der Unruhe kroch in ihm hoch, ähnlich wie damals, als sie Draven in Stewark aufgespürt hatten. Er spürte die Blicke der beiden anderen auf sich, doch er konnte sich nicht abwenden. Sie hatten keine Wahl – die Spur musste verfolgt werden.
„Wir folgen ihm,“ sagte Venom schließlich und setzte sich wieder in Bewegung. Er konnte Haileys leises Seufzen hinter sich hören. Sie war erschöpft, aber sie war hart. Eine Eigenschaft, die er an ihr bewunderte.
Der Weg führte sie tiefer in den Wald. Das dichte Laubwerk schloss sich über ihnen und machte es immer schwerer, die Spur zu verfolgen. Die Bäume standen so eng beieinander, dass die Sonne kaum durch die Blätter drang. Es wurde immer dunkler, je weiter sie nach Osten gingen. Der Boden wurde unebener, und immer häufiger stolperten sie über Wurzeln und Steine.
Nach einer Stunde Marsch blieb Venom abrupt stehen. Sie hatten den Rand des Waldes erreicht. Vor ihnen lag das Weißaugengebirge, dessen gewaltige, schneebedeckte Gipfel am Horizont aufragten. Der Weg führte sie noch nicht direkt in die Berge, aber sie kamen ihnen gefährlich nahe.
„Hier machen wir halt,“ entschied Venom, während er den Blick nicht von den fernen Bergen abwandte. „Wir brauchen einen sicheren Lagerplatz für die Nacht.“
„Bist du dir sicher, dass es Dravens Spur ist?“ fragte Colbart und trat neben ihn.
„Nein,“ antwortete Venom knapp, seine Augen fixierten den fernen Horizont. „Aber wir haben keine anderen Hinweise.“
Die Gruppe begann, ein provisorisches Lager aufzubauen. Während Colbart das Feuer entzündete und Hailey sich darum kümmerte, Schlafplätze vorzubereiten, wanderte Venom ein Stück abseits, um den Umkreis zu sichern. Er blickte in die Düsternis des Waldes zurück, den sie gerade durchquert hatten. Es war ein Ort der Geheimnisse und der Unsicherheit, und er konnte nicht abschütteln, dass etwas in den Schatten auf sie lauerte.
Seine Gedanken wanderten zu Hailey. Ihre Entschlossenheit, ihr Mut – sie erinnerte ihn an etwas oder vielleicht auch an jemanden. Er bewunderte sie, mehr als er zugeben wollte. Doch etwas in ihm hielt ihn zurück. Es war, als stünde eine unsichtbare Barriere zwischen ihnen, etwas Dunkles und Unüberwindbares.
„Venom?“ Haileys Stimme holte ihn aus seinen Gedanken. Sie trat leise zu ihm und blickte ebenfalls in den Wald.
„Glaubst du wirklich, dass wir ihn finden werden?“ fragte sie leise.
Venom zögerte. „Ich weiß es nicht. Aber wir müssen es versuchen.“
Hailey nickte langsam, und für einen Moment stand sie schweigend neben ihm, ihre Blicke in die gleiche Richtung gerichtet. Dann drehte sie sich um, als wolle sie wieder zum Lager zurückgehen. Doch kurz bevor sie ging, sprach sie leise: „Ich vertraue dir.“
Venom sah ihr nach. Ihr Vertrauen bedeutete ihm mehr, als er zugeben konnte. Doch dieses undefinierbare Gefühl hielt ihn zurück – und deshalb durfte er sie nicht zu nah an sich heranlassen. Er drehte sich um und ging zum Lager zurück, wo das Feuer bereits brannte.
Die Nacht brach über das Bluttal herein, und die drei lagen still in ihrem Lager, das Feuer war die einzige Lichtquelle in der zunehmenden Dunkelheit. Der Wind rauschte durch die Bäume, und der ferne Ruf eines wilden Tieres hallte durch die Schluchten. Venom legte sich auf den Rücken und starrte in die Sterne, die über den Baumwipfeln flimmerten. Gedanken an Hailey drängten sich wieder in seinen Geist, aber er verdrängte sie, wie er es immer tat.
Das Weißaugengebirge lag vor ihnen – und mit ihm vielleicht die nächste Spur von Draven.
-
Es war noch dunkel gewesen, als sie erwacht war. Scheinbar war sie so ausgelaugt gewesen, dass sie am Strand in sitzender Position eingeschlafen war. Ihre Rüstung hatte in Einzelteilen zerstreut gelegen und ihr Schwert und die Wurmesser waren unbeaufsichtigt gewesen. Glücklicherweise hatte sich niemand an ihrem Hab und Gut zu schaffen gemacht und sie hatte die Ruhe der Morgendämmerung genutzt, um sich vom Silbersee aufzumachen, Richtung Norden, dem Bluttal entgegen. Erinnerungen an diesen Ort, an die Lage, in der sie sich damals befunden hatte, schob sie entschieden beiseite. Heute war es nur ein verschlafenes Tal inmitten eines üppigen Waldes, welches von verkohlten Knochen und Echos der Vergangenheit eine Bedeutungsschwere erhielt, die man nicht vermuten wollte.
Eine ausgebrannte Feuerstelle am Rand, wo einst ein Fort gestanden hatte, zeugte davon, dass noch immer Wanderer hier vorbeikamen und kampierten. Es war ein zentraler Ort des westlichen Teils der Insel und egal, ob man nach Thorniara, Stewark oder zur Burg Silbersee reisen wollte, ein Ausgangspunkt, der in etwa zwischen all diesen besiedelten Städten lag.
Chalas Weg führte sie nach Westen, einen leichten Anstieg in der Straße folgend, die sie so früh morgens nur mit einigen Rehen und Vögeln teilen musste. Doch für den Frieden und die einfache Schönheit dieses Momentes hatte die Aranisaani kein Auge. Viel zu sehr plagten sie die Gedanken an das, was war und an das, was hätte sein können. Die unangenehme Schlafposition hatte dem Schmerz in ihren Rippen keinen Abbruch getan, ihn vielmehr verstärkt. Auch ihre Beine schmerzten. Scheinbar hatte sie den Sturz in die Tiefe nicht so glimpflich überstanden, wie sie zunächst angenommen hatte.
Bald schon kam in der Ferne der Grenzposten in Sicht, der das erste Anzeichen von Menschen in dieser Gegend bot. Das Tor war verschlossen und eine gebeugte Silhouette zeichnete sich gegen die ersten Straheln der Sonne ab, welche in Chalas Rücken über die Gipfel des Weißaugengebirges aufstieg. Eine trügerische Helligkeit, die der Dunkelheit spottete, die sich in den Eingeweiden der Berge eingenistet hatte. Eine Dunkelheit, derer sie um Haaresbreite entkommen war. Entkommen? Nein, viel mehr wurde ihr genommen, was sie als Mantel zu tragen bereit gewesen war. Verloren hatte sie eine weitere Möglichkeit zu werden, was ihr vorhergesagt worden war. Zerronnen die Chance sich weiterzuentwickeln, nicht mehr auf der Stelle zu treten.
Doch all dies musste sie loslassen, denn es gab weitere Pfade, die sie bestreiten konnte und der nächste mündete in Stewark, führte direkt durch diesen Grenzposten, der sich nun direkt vor ihr erhob. Der Wachposte hatte sie noch nicht bemerkt, schien dem Schlafe nahe zu sein. Offenbar stand ein Schichtwechsel kurz bevor oder ließ sogar auf sich warten.
„Hey! Lass mich passieren!“, rief die dunkle Kriegerin dem Mann entgegen, der aus seinem dösenden Zustand aufschreckte, die Hellebarde griff, welche ihm beinahe aus den Fingern geglitten war und den Helm richtete.
„Wa…Wer ist da und was willst du in der Baronie Stewark?“, fragte er routiniert, konnte eine gewisse Schläfrigkeit jedoch nicht aus seiner Stimme verbannen.
„Chala Vered“, nannte sie ihren Namen, „Ich wurde zu den Wassermagiern mit einer Nachricht geschickt.“
„Und wie lautet diese Nachricht und von wem stammt sie?“
„Der Inhalt ist persönlich, der Absender ist ein Mann und seine Tochter auf Reisen, deren Familie in Stewark lebt.“
„Gut, soll mir egal sein. Wenn du auf dem Weg einen Stadtwächter siehst, tritt ihm in den Arsch. Ich warte hier schon seit einer Stunde auf meine Ablösung!“, bat er sie und machte sich seinem Ärger Luft.
„Werde ich machen“, stimmte sie zu und grinste zu ihm herauf, selbst wenn die Freundlichkeit der Worte ihre Augen nicht erreichte.
Mit etwas Körpereinsatz öffnete der Wachtposten das Tor einen Spaltbreit, sodass sie hindurchschlüpfen konnte. Das Stewarker Land erstreckte sich vor ihr.
-
 Lucky 7
Lucky 7

Der Wind nahm zu, je weiter sie sich dem Gebirge näherten. Die letzten Bäume des Bluttals blieben hinter ihnen zurück, und vor ihnen erhoben sich die schroffen Hänge des Weißaugengebirges. Venom hielt inne, sein Blick folgte einer Reihe tiefer Abdrücke im weichen Boden, die in östlicher Richtung führten – genau dorthin, wo die steinigen Pfade des Gebirges begannen.
„Das sieht aus wie ein verdammter Todesmarsch,“ murmelte Colbart, der neben Venom stand und sich die schweißnasse Stirn wischte. „Das Gebirge ist nicht ohne Grund gefürchtet. Wer auch immer da hoch ist, hatte entweder einen verdammt guten Grund oder ist schlichtweg verrückt.“
Hailey lachte leise und klopfte ihm auf die Schulter. „Wo ist dein Abenteuergeist geblieben, Fettsack? Dies hier könnte dein großer Augenblick sein.“ Ihr spöttischer Tonfall konnte die Anspannung in ihren Augen nicht verbergen.
Venom hielt ihren Austausch nur halb im Ohr, seine Gedanken kreisten um die bevorstehende Herausforderung. Er spürte das Gewicht der Entscheidung auf seinen Schultern. Wenn Draven tatsächlich den Aufstieg gewagt hatte, dann würde es bedeuten, dass er nicht nur gut vorbereitet war, sondern auch furchtlos. Und das machte ihn umso gefährlicher.
„Wir gehen weiter“, entschied Venom und drückte seine Hände fester um den Speer. „Draven ist nicht der Typ, der sich leicht versteckt, aber er ist auch nicht dumm. Wenn er hochgegangen ist, hat er eine Spur hinterlassen. Aber wir müssen auf alles vorbereitet sein.“ Er spürte, wie die kühle Bergluft seine Haut kühlte, während sie sich weiter den Pfad hinaufarbeiteten.
Der Aufstieg war hart. Der Pfad wurde steiler, und bald hörten sie nur noch das Knirschen von Kieselsteinen unter ihren Stiefeln und den Wind, der durch die Felsen pfiff. Die steilen Hänge waren gesäumt von scharfen Kanten und tiefen Spalten, die nur darauf warteten, einen unachtsamen Wanderer hinabzuziehen. Venom blieb immer wieder stehen, um die Umgebung zu prüfen, ob sich Dravens Spur irgendwo verlor oder auf eine andere Route hinwies. Doch sie führte unermüdlich weiter ins Gebirge.
„Was für ein Mistkerl“, zischte Hailey irgendwann, als sie einen besonders schmalen Grat überwanden. Ihre Stimme klang gepresst, aber sie ließ sich nichts anmerken. „Er hat sich immer für unbesiegbar gehalten. Wahrscheinlich genießt er es, dass wir ihm bis hierher folgen.“
Venom warf ihr einen kurzen Blick zu, seine Augen von der Sorge um sie beschattet. Er wusste, dass der Aufstieg Hailey ebenso zusetzte wie ihm, doch sie würde es nie zugeben. Diese waghalsige, fast kindliche Unbekümmertheit war eines der Dinge, die ihn an ihr gleichzeitig bewunderte und beunruhigten. Sie schien das Chaos zu lieben, als könnte sie in der größten Unordnung noch einen Tanz finden. In diesem Moment, als sie in die schroffen Berge hinaufstiegen, fragte er sich erneut, ob er sie jemals verstehen würde.
Die Baumgrenze kam schneller als erwartet. Das Weißaugengebirge verdiente seinen Namen – selbst im Sommer waren die Gipfel schneebedeckt, und die karge Landschaft, die sich vor ihnen auftat, war unbarmherzig und kalt. Der Wind, der zuvor nur eine kühlende Brise gewesen war, heulte jetzt um die Felsen, und die Sonne schien wie ein kaltes, blasses Licht am Himmel zu hängen.
„Wir sollten ein Lager aufschlagen“, schlug Colbart keuchend vor und ließ sich schwer auf einen Felsen sinken. „Ich bin für heute fertig mit Klettern.“
Venom nickte langsam. Die Spuren führten weiter hinauf, aber die Dämmerung setzte bereits ein, und er wusste, dass ein nächtlicher Aufstieg Wahnsinn wäre. Sie hatten bis zur Baumgrenze den härtesten Teil des Weges hinter sich gebracht, aber was vor ihnen lag, konnte noch schlimmer sein.
„Wir rasten hier“, entschied er. „Colbart, such uns etwas Brennholz. Hailey, hilf ihm.“
Hailey grinste schief. „Was, keine Beschwerden, Fettsack?“
„Ach, Prinzessin“, erwiderte Colbart grummelnd, während er sich langsam wieder aufrichtete, „ich werde dich schon noch retten, wenn dir der Arsch abfriert.“ Hailey schüttelte nur lächelnd den Kopf, während sie gemeinsam in Richtung der letzten Bäume gingen.
Venom blieb alleine zurück und ließ den Blick über die verschneiten Bergspitzen schweifen. Seine Gedanken kehrten zurück zu Draven. War er wirklich hier?
Doch der andere Teil... der andere Teil war sich nicht sicher, ob er das Unvermeidliche wirklich wollte. Er spürte eine Unruhe, die nichts mit der bevorstehenden Konfrontation zu tun hatte. Hailey. Ihre Nähe machte ihm mehr zu schaffen, als er sich eingestehen wollte. Er musste sie schützen, das wusste er, aber was, wenn er derjenige war, vor dem sie sich schützen musste?
Die Kälte kroch ihm langsam in die Glieder, als er sich dazu zwang, seine Gedanken wieder auf die bevorstehende Aufgabe zu richten.
 Berechtigungen
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
|







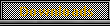



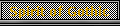










 World of Players
World of Players
 Westliches Argaan #17
Westliches Argaan #17

















