-
Wettbewerbsbeitrag von El Toro
Lieber Leser,
weißt du noch, wie Morgan an einem heißen Tag nach Khorinis kam, um dort ein dystopisches Chaos vorzufinden? Wie Jenna in einem Verlies in der Hafenstadt erwachte, und ihr Wächter nicht mehr so ganz lebendig war, aber alles andere als tot? Erinnerst du dich an den lieben Onkel Ezechiel?
Was damals in Khorinis passiert war, konnten Jenna und Morgan nur erahnen – und ebenso alle anderen Bewohner der Hafenstadt, ob sie den Fluch nun tot oder lebendig… oder irgendwas dazwischen überstanden haben.
Betrachten wir die Ereignisse aus der Perspektive anderer Personen und statten wir Khorinis einen Besuch ab, an einem Tag, der so heiß war, dass er einem die Luft aus der Brust zu saugen schien.
Es wird nicht lange dauern, also, lieber Leser, setz dich zu mir und komm ein bisschen näher. Ich beiße nicht… allerdings vermute ich, dass du weißt, dass das nicht so ganz stimmt.
Jedenfalls wünsche ich dir und mir und meinen Figuren eine Menge Spaß auf den Irrungen und Wirrungen, durch die uns John in den nächsten Wochen schicken wird!
Geändert von El Toro (16.05.2017 um 15:14 Uhr)
-
Kapitel 1: Ein unverhoffter Gruß
An einem Tag in Khorinis, der so heiß war, dass er ihm die Luft aus der Brust zu saugen schien, bevor ihr Körper sie verarbeiten konnte, saß Cassia ermattet auf der Bank vor Matteos Laden für allerlei Ramsch, wie sie ihn nannte, und säuberte sich die Fingernägel mit einer Ahle. Sie hatte den ganzen Vormittag damit zugebracht, ein herrliches Perlencollier zu suchen, das ihr unglücklicherweise aus der Tasche geglitten war – und das ausgerechnet in den Rohren und Tunneln der Kanalisation von Khorinis, diesen dunklen und übelriechenden Eingeweiden der Hafenstadt, in denen es bei dieser Hitze gärte und faulte, dass dieses Unterfangen wahrlich keine Freude gewesen war. Die Ratten unter der Stadt wurden in diesem Sommer so groß wie die räudigen Köter, die oben durch die staubigen Straßen streunten, und mindestens ebenso bissig.
Cassia seufzte und blickte auf ihre Fingernägel. Geronnenes Rattenblut ließ sich schwer entfernen. Immerhin hatte sie das elende Collier in einem weichen Haufen schleimiger Schwammpilze wiedergefunden und es Matteo angedreht, dessen Bedarf an Schmuck zweifelhafter Herkunft zurzeit weder Maß noch Ziel zu kennen schien. Zusätzlich hatte er ihr sogar diese Ahle geschenkt, als Dreingabe für ihren Aufwand. Als Cassia daran dachte, wie überrascht Matteo ob seiner eigenen, unerwarteten Großzügigkeit gewesen war, musste sie ein wenig lachen.
Eine schläfrige Stille hatte sich über die Stadt gelegt. Hin und wieder hörte man das müde Kläffen eines Hundes oder das Rumpeln der Räder eines vereinzelten Wagens auf der holprigen Straße. Einzig die Grillen schienen in der Hitze des Tages nicht zu ermüden, im Gegenteil: Sie spielten zu einem furiosen Streichkonzert auf, das untermalt wurde von dem silbrigen Läuten kleiner, verträumter Glocken, die man am Adanostempel befestigt hatte, um für das Feuerblütenfest gerüstet zu sein. Alle Bewohner der Insel liebten dieses Fest – die Kinder, weil in diesen Tagen Händler aus allen Teilen Myrtanas Wagenladungen klebriger Honigbonbons, Konfekts, Zuckerstangen und von Sirup triefenden Gebäcks in die Stadt bringen würden; die ehrbaren Matronen von Khorinis liebten die edlen Stoffe und feinen Schmuckstücke, die die Kaufleute von den südlichen Inseln mit sich brachten - die weniger ehrbaren liebten die glutäugigen Kaufleute selbst -; die Männer, weil sie so viel blanke Haut zu sehen bekamen wie sonst nie, und das zu erstaunlich günstigem Preis, und Cassia, ja, Cassia liebte das Feuerblütenfest am allermeisten von allen, denn in diesen wenigen Tagen machte sie bessere Beute als im übrigen Geschäftsjahr. Das Stehlen hatte ihr schon immer im Blut gelegen. Eine der seltenen schönen Erinnerungen an ihre Kindheit war der Geruch von süßen Kuchen, gebratenen Äpfeln und dem verschwitzter, staubiger Gewänder, an die sie sich als Kind gedrückt hatte, um im Gedränge vorsichtig ihre kleine Hand in eine schlecht bewachte Tasche zu schieben. Wenn ihre Mutter das gewusst hätte! Cassia kicherte leise. Die Geschicklichkeit war ihr angeboren, aber wie sie ihre Fingerfertigkeit einsetzen musste, das hatte ihr ihre Schwester gezeigt.
Jenna.
Cassias Kichern vertrocknete in ihrer Kehle.
Während sie so in der drückenden Hitze auf Matteos Bank saß und spürte, wie der Schweiß den Rücken ihres nicht mehr ganz sauberen Kleides durchweichte, rumpelte ein Wagen so dicht an ihr vorbei durch den Staub der Straße, dass sie aus ihren Gedanken gerissen wurde. Sie nieste den Staub aus ihrer Nase und blickte dem von zwei Eseln gezogenen Gefährt nach, das eben durch das Stadttor gekommen war und sich nun anschickte, zum Marktplatz abzubiegen. Der Wagen holperte über einen zu weit hervorstehenden Stein – Cassia spürte wie so oft fassungslose Verärgerung in sich aufsteigen, wenn sie daran dachte, wie schlecht die Straßen der Stadt gepflegt wurde, während Larius in seinem Statthalterpalast saß wie eine fette Made und ihm die Steuergelder nur so aus den Ohren quollen -, und durch die Erschütterung fiel ein kleines buntes Bündel herab in den Staub. Cassia sah dem Wagen nach, bis die Biegung der Straße ihn verschluckt hatte, dann ließ sie die Ahle achtlos fallen, erhob sich so mühsam, als wäre sie achtzig und nicht dreißig, und strebte dem kleinen Bündel entgegen, das da vom Wagen gefallen war. Es handelte sich um einen kleinen Strauß hübscher bunter Sommerblumen, die noch so frisch waren, dass sie bis vor wenigen Stunden noch ungestört auf einer Lichtung im kühlen Wald gestanden haben mussten, die Schatten der mächtigen Bäume genießend, noch nicht eingedenk des Schicksals, das ihnen dräute… Cassia seufzte erneut. Es ist alles eitel, dachte sie und strich den Blumen sanft über die zarten Köpfe. Was itzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden…. Bald würden die Blumen überall in Khorinis die Tore und Tempel schmücken, und sie würden in der unfassbaren Hitze welken, ihr Geruch würde schwer und süß über der Stadt liegen…
Eine Stimme durchbrach die drückende Stille wie das Knacken eines trockenen Astes.
„Cassia?“
Cassia fuhr zusammen. Sie unterdrückte den Impuls, den Blumenstrauß hinter ihrem Rücken zu verstecken. Es war Hanna, die hinter ihr aus dem Boden gewachsen zu sein schien wie einer dieser unheimlichen Pilze, die sich manchmal über Nacht auf der Wiese beim Steinkreis aus der Erde hoben, als würde sie jemand – oder etwas – mit aller Kraft nach oben drücken.
„Hallo“, sagte Cassia und strich sich eine Strähne ihres dunklen Haares aus der schweißnassen Stirn. Hanna sah sogar an einem Tag wie diesem betörend gut aus, und Cassias Mund wurde noch trockener als zuvor. Sie war sich ihrer eigenen matten, zerzausten Erscheinung nur allzu bewusst. Besonders ihres Geruchs – eine exquisite Mischung aus Schweiß und Kanalisation, mit der Herznote Ratte. „Was gibt’s?“
Hanna lächelte für einen kurzen Augenblick so strahlend, als nähme sie Cassias derangiertes Aussehen überhaupt nicht wahr oder störte sich zumindest nicht daran. In Cassias Kopf drehten sich Gedanken in einem angenehmen, leichten Schwindel. Das Zirpen der Zikaden dröhnte in ihren Ohren. Dann runzelte Hanna ihre glatte, milchweiße Stirn und sagte: „Ich muss dich sprechen – aber nicht hier auf der Straße. Komm mit!“ In ihrer sanften Stimme schwang ein besorgter Unterton mit, der so beunruhigend war wie das Summen eines großen Insekts in einem dunklen Zimmer. Sie fasste Cassia am Oberarm - eine Berührung, die sie unter anderen Umständen hätte erschauern lassen – und zog sie sanft, aber bestimmt mit sich. Das, was sie zu sagen hatte, duldete offenbar keinen Aufschub.
Hanna zog die Tür mit dem hübschen, handgemalten Tonschild „Privat“ - das auf Cassia immer sehr verheiungsvoll wirkte - hinter sich zu und bedeutete ihr, sich zu setzen. Verglichen mit der Hitze draußen war es in Hannas Arbeitszimmer fast angenehm. Durch das leicht geöffnete Fenster drang das silberne Läuten der Glocken am Adanostempel wie eine zarte Melodie. Der Blumenstrauß, den Cassia gefunden hatte, stand nun auf Hannas Schreibtisch und sog gierig das Wasser aus der Porzellanvase, in der Hanna ihn arrangiert hatte. Hanna hatte außerdem einen Krug kühles Wasser bereitgestellt, das nach den exotischen Kräutern und Früchten duftete, die daran schwammen. Cassia musste sich beherrschen, ihr Glas nicht ebenso gierig mit einem Zug herunterzustürzen – das wäre ihr sehr undamenhaft vorgekommen, besonders in Tateinheit mit ihren ungepflegten Fingernägeln. Also nippte sie an ihrem Getränk und sah Hanna erwartungsvoll an.
Hanna zögerte. Offenbar wusste sie nicht, wie sie beginnen sollte. Sie legte ihre weiße, zierliche Hand auf Cassias dunkle, raue und sagte: „Ich weiß, dass du darüber nicht sprichst. Du wirst deine Gründe dafür haben, und ich möchte dich auch nicht damit bedrängen. Aber…“
Cassia spürte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss. Sie öffnete den Mund, um irgendetwas zu sagen, aber Hanna fuhr bereits fort: „Es war gestern Abend. Er kam einfach hier herein, hat sich an den Tresen gestellt und nach dir gefragt.“
Cassia brauchte einen Moment, um sich zu sammeln. „Nach mir gefragt? Wer? Und warum? Und was hast du gesagt?“
„Im ersten Moment dachte ich, es wäre einer dieser verdeckten Stadtmilizen, die auf ihre plumpe Art versuchen, uns aufs Kreuz zu legen. Aber dann… dann habe ich ihn erkannt, glaube ich.“
„Wen? Wen hast du erkannt? War es Larius? Oder der König höchstpersönlich? Jetzt spuck es doch endlich aus!“ Cassia schien es, als würden sämtliche Nervenstränge ihres Körpers in höchster Anspannung vibrieren. Sie konnte sie förmlich in ihrem Inneren summen hören. Sie konnte sich ihre eigene Unruhe nicht richtig erklären, aber sie spürte, dass es sich hier um schlechte Nachrichten handelte. Ganz schlechte Nachrichten.
„Es war der Bruder deiner Mutter. Ezechiel, glaube ich. Ich bin mir fast sicher.“
Cassia lachte auf. Ganz schlechte Nachrichten? Weit gefehlt! Schlechte Nachrichten waren so bedeutungslos wie das geronnene Rattenblut unter ihren Fingernägeln, verglichen damit.
Hanna blinzelte unsicher, als Cassia nicht aufhörte zu lachen. Als sie sich endlich beruhigt hatte, stieß sie hervor: „Soso, Onkel Ezechiel war hier. Was wollte Onkelchen denn von mir?“
Hanna fuhr in etwas kühlerem Ton fort: „Ich weiß nicht, was in eurer Familie vorgefallen ist und es geht mich auch nichts an. Aber gestern Abend kam ein Mann in mein Hotel, etwas älter, aber noch sehr, naja, gewinnend, und behauptete, dich zu kennen. Er sagte, er habe gehört, dass du manchmal in meinem Hotel zu finden seist. Ich habe nichts dazu gesagt, aber er schien von seinem Anliegen sehr überzeugt zu sein. Es ginge um deine Schwester und noch viel mehr und er müsse dich unbedingt sprechen.“ Hannas Stimme wurde wärmer. „Cassia, wann hast du zuletzt etwas von deiner Schwester gehört?“
„Jenna ist tot“, erwiderte Cassia tonlos. „Tot oder so gut wie tot. Ich habe seit zwanzig Jahren nichts von ihr gehört. Unsere letzte Unterhaltung endete damit, dass sie mir eine solche Ohrfeige verpasst hat, dass mein Blut Mutters guten Tischläufer versaut hat.“
„Sie ist weggelaufen, nicht wahr? Sie war damals noch ganz jung, glaube ich. Weißt du, warum sie fortgegangen ist?“
„Weil sie eben Jenna war. Sie hatte vielleicht einfach keine Lust mehr, sich um mich zu kümmern.“
Hanna schlug die Augen nieder und schwieg.
„Was hast du ihm denn gesagt?“, wollte Cassia wissen.
„Gar nichts. Er hat mir gesagt, dass er dich sprechen muss. Er hat einen alten Hof auf der Hochebene gepachtet und sich dort eingerichtet. Du sollst ihn dort besuchen, sobald du kannst.“ Hanna sah Cassia nachdenklich an. „Weißt du, woran ich ihn erkannt habe? An seinem Lächeln. Nicht, weil es deinem ähnlich wäre, nein. Er hatte immer noch diesen Goldzahn, den er schon früher hatte, als wir noch klein waren. Ist das denn zu glauben?“
Als Cassia sich spät am Abend auf dem Lager umherwälzte, dass sie sich mit Attila teilte, war sie fast entschlossen, Onkel Ezechiel einen Besuch abzustatten – einen Besuch, den er nicht vergessen würde. Sie wusste nicht, was Jenna, das kleine Miststück, dazu veranlasst hatte, Khorinis fluchtartig zu verlassen, als sie kaum vierzehn war, aber Ezechiel war der einzige Mensch, der es tatsächlich wissen konnte. Cassia vermutete, dass er irgendetwas damit zu tun hatte, vielleicht hatte er sogar dazu geraten – die Dinge hatten nicht gut gestanden zwischen Jenna und ihrer Mutter. Jedoch war es in Cassias Familie gute Tradition gewesen, Probleme dort zu belassen, wo sie hingehörten: Unter den dicksten Teppich, der zu finden war. Dann rückte man noch ein paar Schränke und Kommoden darauf und hoffte, dass das hässliche Etwas, das sich darunter verbarg, einfach irgendwann absterben würde. Ezechiel und ihre Mutter hatten nach Jennas Weggang nicht mehr miteinander gesprochen, und was Cassias Mutter Recht war, war Cassia selbst nur billig gewesen. Aber das Ding unter dem Tepich war immer noch am Leben, und es war wütend. Cassia hatte eigentlich kein Interesse daran, was Ezechiel wohl auf dem Herzen haben mochte – sie würde ihn dafür zur Rechenschaft ziehen, dass er sie im Stich gelassen hatte, dass er ihr Jenna weggenommen hatte und vor allem dafür, dass er es jetzt wagte, einfach wieder in ihrem Leben aufzutauchen. Außerdem war es längst an der Zeit, einige Antworten einzufordern, auch wenn sie ihrem alten Onkel dabei Fingernägel oder Goldzähne würde herausreißen müssen, um diese zu erhalten.
Cassia spürte, dass sie im Dunkeln zu lächeln begonnen hatte. Attila gab im Schlaf ein merkwürdiges Geräusch von sich, und Cassia drehte sich mit nicht zu leugnendem Widerwillen von ihm weg. Ja, sie würde Ezechiel besuchen. Am liebsten wäre sie gleich aufgesprungen und noch in dieser Nacht zur Hochebene über der Stadt marschiert, aber im Augenblick war sie hier unabkömmlich. Das Feuerblütenfest stand bevor, es galt Pläne zu schmieden, ihre Leute strategisch günstig in der Stadt zu verteilen, die Kaufleute auszuspionieren, die Hafenhuren zu bestechen, mit den Hehlern der Stadt bereits im Voraus Festpreise zu vereinbaren … so viele Verpflichtungen!
Nun, wenn sie zwanzig Jahre mit den Fragen in ihrem Herzen hatte leben können, würde sie es auch noch einige Tage lang aushalten, bis sie die rührende Familienzusammenführung durchführen konnte, die sie im Sinne hatte. Mit diesen Gedanken schlief sie ein.
-
Kapitel 2: Ein Geräusch, wie wenn einer versucht, kein Geräusch zu machen
„Ramirez, du kontrollierst den Bereich um den Marktplatz. Sieh zu, dass uns nicht wieder diese Trampel von Ortega versuchen, das Geschäft abzunehmen. Rengaru ist für die Hauptstraße zuständig. Jesper hat den nördlichen Hafenbereich im Blick, Joe den südlichen. Hanna ist Anlaufstelle für alle Belange, die mit den Wachplänen der Milizen zusammenhängen. Irgendwelche Fragen?“
Cassia strich sich einige Strähnen aus der Stirn, die sich aus ihrem sorgfältig frisierten Knoten gelöst hatten.
Nagur räusperte sich: „Ähm, Kardif findet, dass seine Provisionen angepasst werden sollten, und Nadja sagt, ihre Mädchen bräuchten eine Auffrischung bei Ramirez. Sie hat letztes Jahr doch noch einige Unzulänglichkeiten bei Olivia und Lyrella festgestellt.“
Ramirez lachte meckernd wie ein Ziegenbock. Cassia fand, dass das gut zu seinem Geruch passte. „Olivia und Lyrella sind doch fingerfertig genug, das kann euch jeder Bürger von Khorinis bestätigen.“ Ramirez brach über seinen eigenen Witz wieder in Gemecker aus.
Cassia ignorierte ihn und sagte: „Gut, Kardif kann drei Prozent mehr haben, aber keinen Deut mehr; Ramirez geht morgen Vormittag zu Bromor und nimmt seine Übungsdietriche mit. Dafür muss Nadja aber zwei ihrer Mädchen für ein Wochenende für Rangar freistellen, als kleinen Dank für sein Entgegenkommen. Sonst noch was?“
„Zuckerpüppchen, was mache ich denn dieses Jahr? Du wirst mich doch wohl nicht vergessen haben?“ Attila warf Cassia einen Blick unter einer leicht hochgezogenen Augenbraue zu, den er selbst sicherlich für feurig und verführerisch hielt.
„Du, mein Hübscher, darfst in diesem Jahr den Chef spielen“, lächelte Cassia. „Du bist einfach überall präsent und zugleich unsichtbar, jederzeit und für alle ansprechbar, dabei völlig unauffällig und im Hintergrund. Traust du dir das zu, Großer?“
Attila schien anzuschwellen wie der Kamm eines gereizten Hahns, als er erwiderte: „Ob ich mir das zutraue? Süße, ich bin zum Führen geboren. Du kannst dich ganz auf mich verlassen. Du lehnst dich einfach zurück und lässt Papa Attila machen, ja?“
„Klar doch“, sagte Cassia und konnte ein leichtes Schaudern nicht unterdrücken. Wie immer bemerkte es niemand. Sie würde Attila machen lassen, aber sie würde sich ganz bestimmt nicht zurücklehnen, denn sie hatte Geschäfte in eigener Sache zu erledigen.
Als sie sich am Abend auf ihrem ungemütlichen Lager wälzte und für einen kurzen Moment gestattete, sich zwischen die blütenweißen Laken und seidigen Kissen eines ganz anderen Bettes zu wünschen, legte sich eine Hand schwer auf ihre Hüfte. Sie widerstand dem Drang, sie abzuschütteln.
„Zuckerpüppchen, was ist denn los mit dir? Übermorgen beginnt das Fest des Jahres, wir haben alles im Griff. Wir könnten uns doch jetzt noch ein paar Runden im Heu wälzen, wenn du verstehst, was ich meine.“ Attila seufzte. „Aber du liegst neuerdings nur da, starrst an die Decke und lässt dich nicht mehr anfassen. Ich würde ja gern glauben, dass du mir die Leitung übertragen hast, weil du mich für so fähig hältst, aber…“
Cassia drehte sich zu Attila um. „Attila, ich halte dich für fähig. Du wirst das großartig machen. Mir geht zur Zeit so vieles durch den Kopf.“
„Und ich bin wohl der Letzte, mit dem du darüber reden würdest, nicht wahr?“ Attila schaffte es, so betroffen auszusehen wie ein geprügeltes Molerat.
„Es sind Dinge, über die ich mit niemandem reden würde.“
„Nicht mal mit Hanna?“, fragte Attila spitz, und jetzt war es Cassia, die betroffen schwieg. Dann brach es aus ihr heraus: „Ich bin wütend. Ich bin seit vielen Jahren wütend, und seit kurzem glaube ich zu wissen, warum ich wütend bin. Es ist eine Familienangelegenheit, und ich werde mich morgen darum kümmern.“
Sie spürte, wie sich Attilas Hand von ihrer Hüfte hob und er sich von ihr wegdrehte. Das machte sie noch ein wenig wütender, denn obwohl sie nicht gerade wild auf seine ungelenken Berührungen war, hinterließ seine Hand eine Art kühle, leere und einsame Stelle auf ihrem Körper. Sie wartete, bis sie hörte, wie sein Atem ruhiger und gleichmäßiger wurde, erhob sich dann von ihrem Lager und schlich mit der ihr eigenen Behändigkeit hinaus in die dunkle Nacht.
Cassia blickte hinauf zur unendlichen Weite des Firmaments. Das Silber der Mondrinde hatte sich in ein fahles Weiß verwandelt, das die Berge mit kalter Leichenblässe überzog, und die Sterne funkelten hart und schonungslos. Es schien ihr, als könnte sie durch kleine Löcher, die ein böser Gott mit einer weißglühenden Nadel in den Himmelssamt gestochen hatte, das kalte Licht sehen, das alle sterblichen Wesen am Ende ihres Weges erwartete. Der gewaltige Felsen, auf dem das Kloster in den schwarzen Himmel ragte, war bereits in Sichtweite.
Cassia zog den leichten Umhang fester um ihre Schultern. Die Luft um sie herum war warm wie eine Wanne Badewasser, aber das kalte Licht ließ sie frösteln. Ein Lederbeutel von mittlerer Größe baumelte beruhigend schwer an ihrer Seite. Ein kleines Mitbringsel für Onkel Ezechiel, dachte Cassia und verzog den Mund zu einem nicht sehr damenhaften Grinsen. Vielleicht würde er ihr freiwillig sagen, was sie wissen wollte. Aber das wäre nur die zweitbeste Möglichkeit. Viel besser würde es ihr gefallen, wenn er ihr nur mit seinen Altmännerproblemen auf die Nerven fallen wollte – wenn er Geld von ihr haben wollte, oder Mädchen… dann waren in diesem Beutel genau die richtigen Dinge, um ihn zum Reden zu bringen. Ramirez war geradezu besessen von kleinen, metallenen Instrumenten, deren Wirkung er gerne an Kanalratten oder Mitgliedern von Ortegas Bande demonstrierte, wenn er eines davon in die Finger bekam. Man brauchte überhaupt nicht viel Kraft… es ging ganz leicht… der Effekt war immer wieder verblüffend. Cassia sah hoch zu den kalten Sternen. Nichts erfüllte sie mit größerer Bewunderung als das bestirnte Firmament über ihr und der Erfindungsreichtum des menschlichen Geistes, wenn es um Folterwerkzeug ging.
Als sie die Hochebene erreichte, sah sie den Hof im Dunkeln liegen wie ein großes, schlafendes Tier. In einem der Fenster schimmerte ein mattes Licht. Gut so, dachte Cassia, der alte Bastard kann nicht schlafen. Sie schlich durch die Schatten der Nacht, und die Büsche rauschten leise im sanften Wind, der über die Ebene strich.
Na, dann mal los, dachte Cassia und drückte gegen die Tür, die sofort nachgab.
Nicht verschlossen.
Im Eingangsbereich war es dunkel, nur ein schwacher Lichtschein fiel aus irgendeinem der Zimmer auf die Holzdielen. Cassia rümpfte die Nase. Es roch nach Staub, gekochtem Kohl und altem Mann.
Das Licht schimmerte unter der Tür zu ihrer Linken hindurch. Dahinter würde Onkelchen sitzen… und auf sie warten.
Der Gedanke gefiel Cassia nicht besonders gut. Sie tastete nach ihrem Lederbeutel. Lautlos schob sie sich auf die Tür zu, hinter der sie Ezechiel vermutete. Sie war nur angelehnt. Sachte, ganz sachte, öffnete sie die Tür, erst einen Finger breit, dann zwei, und spähte in die Stube. Auf einem groben Holztisch stand eine kleine Lampe, im Dunkeln waren ein paar Regale zu erkennen. Cassia konzentrierte sich auf das einzig wirklich interessante Objekt im Raum. Es war ein wuchtiger Sessel, der mit dem Rücken zur Tür stand – und darin saß jemand. Cassia konnte den obersten Teil seines Kopfes über die Lehne hinausragen sehen.
Zu groß. Viel zu groß.
Onkel Ezechiel musste erhöht auf einem Kissen sitzen. Oder?
Sie glitt geräuschlos durch das Halbdunkel des Raumes, blieb einige Schritte von dem Sessel entfernt stehen und sagte, so süß sie konnte:
„Guten Abend, mein lieber Onkel.“
Daron war erschöpft. Es war eine anstrengende Zeit, einer Zeit der Prüfung. Er hoffte, dass es dem Herrn Innos gefiele, dem Bösen Einhalt zu gebieten, aber er war sich da nicht so sicher. Daron starrte auf die eisernen Haken, die aus den Stümpfen seiner Arme ragten. Er hatte jahrelang gekämpft, er hatte sogar seine verdammten Hände geopfert, um die Bedrohung abzuwenden, aber seit kurzem hatte er den Verdacht, dass der Herr damals nicht Seine schützende Hand über ihn gehalten hatte, um ihn, Daron, zu erretten, sondern um ihn nur umso tiefer fallen zu lassen. Seine Hände hatte er in Innos‘ heiliger Flamme verbrennen können, aber was sollte er nun tun, da der Dämon in seiner Brust hauste?
Und was tat man, wenn man nicht wusste, wie man das Übel noch abwenden sollte? Man musste es kleinhalten, vor den Augen der Welt verbergen, bis zum letzten Atemzug darum kämpfen, dass zum Übel nicht noch die Schande kam, weil man sonst eben nichts tun konnte. Er dachte an Gorax’ Worte nach dem Vorfall während der Sonnenfinsternis vor vielen Jahren.
Wenn ihr nach Hause kommt und findet euren Vater überfallen und eure Mutter geschändet vor, was tut ihr dann? Ihr bedeckt zuerst ihre Blöße, und erst dann überlegt ihr, wem ihr von dieser grässlichen Tat berichtet. Die Kirche Innos ist uns Vater und Mutter zugleich, und es ist unsere heilige Pflicht, ihre Blöße zu bedecken, damit sie nicht dem Spott der Welt anheimfallen!
Daron seufzte. Er hatte vielleicht keine Hände mehr, aber als Präses der Kirche der Heiligen Flamme hatte er tausend Augen und tausend Ohren – und einem davon war zugetragen worden, dass ein gewisser alter Mann aus Gründen, die vor seinem demütigen Diener Daron zu verbergen Innos gefiel, das Gerücht verbreitete, ein Dämon, der in irgendeinem Zusammenhang mit der heiligen Mutter Kirche stünde, wolle über die Menschheit kommen wie ein riesenhafter Wolf über eine Herde wehrloser Schafe. Das war nach Daron Einschätzung völlig zutreffend, und deshalb musste er nun alles daransetzen, dass dieser Mann verstummte. Aller Wahrscheinlichkeit nach war dieser alte Mann ein Verrückter, ein Wahnsinniger, dessen verdrehter Geist nur in - zugegebenermaßen unheimlicher – Koinzidenz die Wahrheit verkündete. Innos gefiel es nicht, Seine Worte durch den Mund von Schwachsinnigen zu künden; der Herr hatte immer auf die gesetzt, die da geistig reich waren. Dennoch durfte die Kirche kein Risiko eingehen: Wenn sie den Dämon, der nach Darons Ansicht kurz vor dem Wiedererwachen stand, nicht in die Schranken weisen konnte, musste sie doch den Schaden so gering wie möglich halten.
Also hatte er sich mit einem kleinen Trupp vertrauenswürdiger Novizen auf den Weg gemacht und hatte den Aussiedlerhof auf der Hochebene aufgesucht, in dem sich der Schwachsinnige dem Vernehmen nach aufhielt. Daron musste zugeben, dass ihn eine gewisse Neugierde gepackt hatte. In den tiefsten Kellergewölben des Klosters würden sie aus dem Verrückten schon herausbekommen, woher er seine Kenntnisse bezog. Das dürfte interessant werden. Daron trauerte seinen Händen zweifellos nach, aber manchmal, ja manchmal, da waren stählerne Haken eine ungemein spannende Alternative.
Nachdem die Novizen den Alten aufgescheucht und zum Kloster abtransportiert hatten, hatte sich Daron noch eine Weile in seinem Haus umsehen wollen. Die Befragung würde bis morgen warten können. Daron wusste nicht, wonach er suchte, und ob es überhaupt etwas gab, wonach man suchen konnte, aber sein Gefühl sagte ihm, dass er gründlich vorgehen musste. Nichts durfte übersehen werden, wenn der Ruf der Heiligen Flamme auf dem Spiel stand. So war er eine Weile durch den heruntergekommenen Hof gestreift, hatte Kisten und Schränke durchsucht, aber das einzige, was er zu Tage förderte, war fleckige Altmännerwäsche und ein Haufen nutzloser Krimskrams.
Erschöpft hatte er sich auf einen Sessel fallen lassen und starrte nun auf eine Reihe staubiger Bücher, die in einem Regal vor ihm aufgereiht waren. Eines dümmer als das andere. Er würde bald aufbrechen, aber etwas hielt ihn zurück. Es war anders als das Kribbeln und Jucken in seiner Brust, das er seit einiger Zeit verspürte. Es war eine Unruhe, die ihn ergriffen hatte, eine erwartungsvolle, gespannte Unruhe, die etwas unmittelbar Bevorstehendes anzukündigen schien. Es war, als stünde er auf einer hohen Klippe, das schäumende Meer unter ihm, und als würde sich plötzlich ein Umriss unter der Wasseroberfläche abzeichnen, undeutlich noch, aber so riesenhaft, dass man ihn nicht ignorieren konnte.
Daron schloss seine brennenden Augen und wartete auf die Eingebung, die der Herr ihm möglicherweise schicken würde, als er plötzlich ein kleines Geräusch hörte, so leise, dass man es sicher nicht wahrnehmen würde, wenn man nicht gerade mit geschlossenen Auge auf eine göttliche Inspiration wartete. Ein Geräusch, wie wenn einer versucht, kein Geräusch zu machen, dachte Daron. Seine Nerven vibrierten wie bis zum äußersten gespannte Bogensehnen. Er befahl seinem erschöpften Körper und seinem müden Geist, alle verbliebenen Kräfte zu sammeln, um bereit zu sein für das, was da kam.
„Guten Abend, mein lieber Onkel.“
Verblüfft wandte sich Daron um. Er hatte nicht mit einer jungen Frau gerechnet, die in der Mitte des dämmrigen Raumes stand und dem Wahnsinnigen offenbar einen Familienbesuch abstatten wollte. Dennoch: Wenn sie ihm so nahestand, dass sie ihn mitten in der Nacht besuchte, konnte sie auch im Besitz von Informationen sein. Es war also Vorsicht geboten.
Daron erhob sich schwerfällig und legte alle Güte in seine Stimme, die er aufbringen konnte:
„Mein liebes Kind, sei getrost. Dein guter Onkel brauchte dringend die Hilfe der frommen Männer Innos‘ und befindet sich gerade in ihrer Fürsorge. Er wird bald wieder gesund sein und zurückkehren.“
Die Frau starrte ihn an. Sie kam ihm vage bekannt vor; ohne Frage war sie eine Bewohnerin der Hafenstadt, aber vermutlich keine besonders ehrbare. Soweit er das beurteilen konnte, erschien sie nicht zur Heiligen Messe.
Als sie die Sprache wiedergefunden hatte, entgegnete sie mit einer Kälte, die Daron erstaunte: „Wo ist der alte Mistkerl? Sag es mir!“
Daron ging bedächtig um den Sessel herum, so dass ihr seine ehrfurchtgebietende Robe unmöglich entgehen konnte, und antwortete: „Tochter, er befindet sich im Kloster, wo ihm geholfen werden kann.“
„Ich bin hergekommen, um ihm zu helfen, alter Mann“, sagte sie. „Was macht ihr mit ihm im Kloster?“
Das Kribbeln und Jucken in Darons Brust wurde stärker. Die aufsteigende Wut schien dem Dämon zu gefallen.
„Tut mir leid, das kann ich dir nicht sagen. Wir müssen sein leiden noch genauer untersuchen, aber ich fürchte…“ – Daron machte eine, wie er fand, effektvolle Pause – „… sein Leiden liegt hier.“ Er deutete an seine Stirn. „Dein Onkel hat sich an uns gewandt, weil er in letzter Zeit an Gedanken litt, die dem Herr Innos ein Gräuel sind und jeglicher natürlichen Ordnung völlig zuwiderlaufen. Was immer er in den vergangenen Wochen gesagt haben mag, mein liebes Kind: Es steht zu befürchten, dass all das nur Auswüchse einer entarteten menschlichen Vorstellungskraft gewesen sind. Es tut mir leid, meine Liebe. Aber er wird unter Hand des Herrn Innos bald wieder gesund werden.“
Die Frau starrte ihn wieder an, und zwar so eindringlich, dass es Daron körperlich unangenehm war. Es war offensichtlich, dass sie ihm kein Wort glaubte.
„Ob er gesund wird oder nicht interessiert mich nicht. Ich brauche nur ein paar Antworten von ihm. Lass mich mit ihm reden, und danach könnt ihr mit ihm machen, was ihr wollt, und ich werde niemals erwähnen, dass ich dich hier angetroffen habe, alter Mann.“
Darons Brust juckte fast unerträglich, und er musste sich anstrengen, um sich nicht mit seinen blanken Haken das Fleisch zu zerkratzen.
„Ich bin Meister Daron, Frau, also erwarte ich von dir Respekt und keine Drohungen. Ich sage dir, was du tun sollst, und nicht andersherum.“
„Ich weiß sehr gut, wer du bist, alter Mann. Wir hatten schon miteinander zu tun, auch wenn es bereits eine Weile her ist – du hattest damals noch Hände und nicht diese Dinger.“
Daron schwieg verwirrt. Es lief nicht nach Plan. Aber bevor er sich Gedanken um das weitere Vorgehen machen konnte, fuhr die Frau fort:
„Du erinnerst dich sicher nicht an mich, aber du erinnerst dich an die Sonnenfinsternis über Khorinis, nicht wahr?“
Daron stockte der Atem. Was wusste dieses Weibsstück? Wusste sie, was damals geschehen war?
„Ich sehe, du erinnerst dich zumindest daran“, sagte die Frau mit einem Lächeln, das Daron eher tödlich als freundlich erschien. „Es ist mir gleich, welche Erinnerung du daran hast, alter Mann, aber als meine Schwester unmittelbar nach der Sonnenfinsternis verschwand, hast du dafür gesorgt, dass ich in die Obhut der Barmherzigen Schwestern Innos‘ kam, damit ich nicht auch dem Herrn verloren gehe, wie ihr es ausgedrückt habt.“
Vor Darons Augen flatterte der Zipfel einer trüben Erinnerung. Ein junges Mädchen, das sich zweifellos einem Seemann, einem fahrenden Händler oder Schlimmerem an den Hals geworfen und mit ihm davongemacht hatte. Die kleine Schwester, zu deren Erziehung die Mutter – der Vater war unbekannt, ein klassischer Fall! – offensichtlich nicht geeignet war und der er, obwohl er weiß Innos genug eigene Probleme hatte, einen Platz im Schutz der behütenden Hand des Herrn verschafft hatte.
„Dann solltest du mir dankbar sein, liebe Tochter. Während deine Schwester, so sie denn überhaupt noch am Leben ist, sicherlich alle Hände voll damit zu tun hat, die Mäuler ihrer unehelichen Bälger zu stopfen, lebst du nun ein innosgefälliges Leben…“
De Frau lachte so trocken auf, dass es wie das Zischen einer Schlange klang. „Du hast Recht, Daron, beinahe alles, was mich ausmacht, habe ich in der Anstalt der Barmherzigen Schwestern gelernt: Lügen, Betrug, Heuchelei. Dafür danke ich dir.“ Sie deutete einen Knicks an. Dann fuhr sie fort: „Ich bin heute Nacht hierhergekommen, um einen alten Mann büßen zu lassen. Ezechiel ist nicht hier, aber einen alten Mann habe ich trotzdem gefunden.“
Mit einem Lächeln griff sie nach dem Lederbeutel, der an ihrer Schulter hing.
-
Für Hanna war der frühe Morgen die Nacht der Seele. Wenn sie in diesen Stunden erwachte, fand sie sich begraben in einer Finsternis, in der man vor allem Angst hat, was einem in den Sinn kommt. Ihr Körper zeichnete sich in dunklen, feuchten Schweißspuren auf dem Laken ab, und im Laufe des Tages würden diese Spuren zu einem feinen, weißen Salzumriss trocknen, mit leichten Abweichungen zu den anderen, schwach erkennbaren Umrissen der vergangenen Tage, so dass sich das ewige Abbild ihres zusammengekauerten Körpers auffächerte wie ein Kartenspiel. Vor ihren Augen stiegen dann beunruhigende Bilder auf, etwa das Bild zweier blutiger Zähne, die sie als kleines Mädchen einmal hinter dem Schuppen gefunden hatte, das Bild ihrer Großmutter, die mit einem grässlich rasselnden letzten Atemzug starb, während ihr rechter Fuß zuckte.
Das Wachliegen war eine schlimme Sache. Aber noch schlimmer war es eigentlich, wenn sie nicht wach war, sondern zwischen Wachsein und Schlaf schwebte, unentrinnbar eingesponnen wie in einem Spinnennetz, und sich nicht wehren konnte gegen die Träume. Und die waren eine wirklich schlimme Sache, zumindest in den letzten Wochen, in denen Khorinis vor ihren Augen in Strömen von Blut versank. Dunkelheit umfing sie, aber eigentlich stimmte nicht einmal das. Zu beiden Seiten ihres Sichtfelds türmten sich die Ruinen ihres Lebens auf.
Grauer Stein, in sich zusammengefallen, mit rostroten Sprenkeln, die vielleicht nur Farbe waren, vielleicht aber auch nicht, welkende Blumen, vermodertes Holz – alles, was Menschen einmal Sicherheit und Geborgenheit geboten hatte, war nun zu einem stummen Mahnmal für die göttliche Grausamkeit geworden.
Aber das war nicht alles. Sie kannte diesen Traum, sie hatte ihn schon drei Dutzend Mal geträumt. Mindestens. Als sie den Blick auf die Straße vor sich richtete, wie sie es schon Dutzende Mal getan hatte, war er wieder da. Er sah sie wie immer an und stand genau vor ihr, als brennender Kontrast zu der Zerstörung um sie herum. Erstaunliches, goldrotes Abendlicht umfloss ihn, und irgendwo über den Ruinen stieg die goldrote Kugel des Mondes auf, angeschwollen und kalt, während die Sonne als blutrote Feuerkugel versank; eine Mischung von Licht, so grausam und schön, dass sie vielleicht tödlich war.
Wie immer konnte Hanna die Gestalt nicht erkennen. Ihre Augen, ihr Gesicht, ihren Körper…sie konnte sie zwar mit ihren Blicken erfassen, aber ihrem Geist verweigerte sie sich, und so war die Gestalt nichts anderes als ein undeutlicher Schemen. Eine Gestalt mit Hörnern.
Bist du auch wieder hier?, dachte sie. Bewegungen taten sich in ihren Augenwinkeln auf, und sie wusste genau, was das bedeutete: Noch mehr Schemen kamen auf sie zu, einige gekrochen, andere stolperten ungelenk und steif wie schlecht gearbeitete Holzpuppen auf sie und das vor ihr stehende Wesen zu, aber auch sie waren nicht zu erkennen.
Panik stieg in ihr auf wie Luftblasen, die an der Oberfläche ihres Geistes zerplatzten, und obwohl ihr dieser Traum so vertraut war wie nichts anderes in ihrem Leben, obwohl sie genau wusste, was passieren würde, fürchtete sie sich beinahe zu Tode. Doch als die erste schemenhafte Gestalt sie erreichte und sie zwang, in ihre grauenvolle, unerkennbare Fratze zu blicken, fuhr Hanna aus ihrem Traum hoch. Vielleicht hatte sie ein Geräusch gehört, vielleicht auch nicht, und sie setzte sich auf und sperrte den Traum sofort in das kleine, fensterlose Verließ am Ende ihres Bewusstseins, das sie eigens für ihn eingerichtet hatte.
Das Licht des tief stehenden Mondes fiel auf ihr schmales Bett, in dem sie ihre einsamen Nächte verbrachte. Hanna erhob sich und sah aus dem Fenster, nur um ganz sicher zu gehen. Die Stadt lag träumend und unverändert so, wie sie sie am Abend zurückgelassen hatte. Keine Trümmer, keine Ströme von Blut und, was das wichtigste war, keine Gestalten. Nur das verträumte Läuten der Glöckchen. Vielleicht würde sie doch noch eine Stunde Ruhe finden, bevor sie…
Hanna stockte der Atem. Dicht an ihrem Fenster huschte ein Schatten vorbei, eine verhüllte Gestalt, die fast mit den Schatten der Nacht verschmolz… aber eben nur fast. Sie bewegte sich in Richtung des Osttores, und ihre Bewegungen war weder steif noch ungelenk, sondern so geschmeidig und anmutig wie…
„Cassia“, flüsterte Hanna. Was in Dreigötternamen machte Cassia in der totesten Stunde der Nacht auf der Straße? Sie würde doch wohl kaum auf Beutezug sein, so kurz vor dem Feuerblütenfest? Es wäre Wahnsinn, die Bewohner, Gäste und nicht zuletzt die Stadtwache gerade jetzt in Alarmbereitschaft zu versetzen! Ganz schlecht fürs Geschäft.
Ein unangenehmer Gedanke beschlich Hanna. Die Gestalt, von der sie sich sicher war, dass es sich um Cassia handelte, bewegte sich auf das Osttor zu, im Schutz der Dunkelheit und ohne Begleitung. Zum Osttor hinaus musste man gehen, wenn man eine gewisse Hochebene erreichen wollte, auf der ein gewisser alter Mann seiner so schmerzlich vermissten Nichte dringend etwas anvertrauen wollte, um die er sich jahrelang nicht gekümmert hatte.
Eine Falle, dachte Hanna. Ihr Kopf arbeitete fieberhaft. Jemand, vermutlich ein Mitbewerber um die fette Beute des Feuerblütenfestes, wollte Cassia aus dem Verkehr ziehen und hatte sie, Hanna, dazu benutzt, Cassia eine Falle zu stellen. War das denkbar? Sicherlich, dachte Hanna. Es war sogar recht wahrscheinlich. Wenn Cassia nun etwas zustieße, weil ein zweitklassiger Schurke wie Ortega sie, Hanna, und einen vielleicht verrückten alten Mann wie Marionetten verwendet hatte! Cassia war von Natur aus misstrauisch genug, um allen Nachstellungen bisher entgangen zu sein, aber vielleicht hatte jemand ihren wunden Punkt herausgefunden und spielte in perfider Weise diese Karte aus.
Sie musste etwas tun. Hanna warf sich ihren dünnen, fliederfarbenen Mantel über und schlüpfte in ihre Schuhe. Einen Moment lang stand sie unschlüssig in der Tür, dann drehte sie sich noch einmal um, nahm den großen, scharfen Brieföffner aus Nordmarer Stahl, der auf ihrem Schreibtisch lag, und trat auf die Straße. Es war immer noch warm in der Hafenstadt, obwohl ein mäßiger Wind vom Meer her wehte und ihre offenen Haare zerzauste. Sie konnte Cassia nirgends sehen, aber wenn ihr Gefühl sie nicht trog – und das tat es fast nie -, brauchte sie nur zum Osttor zu gehen. Als Hanna den Tempel passiert hatte und in die stille, schlafende Händlerstraße einbog, konnte sie gerade noch einen dunklen Schemen erkennen, der durch die kleine, nun unbewachte Pforte neben dem geschlossenen Tor schlüpfte. Die Kapuze des Mantels war ein wenig verrutscht, und im Mondlicht schimmerte dunkles Haar wie blauer Samt. Es war zweifellos Cassia, die da gerade die Stadt verließ, um möglicherweise ein schreckliches Ende zu finden. Hanna ging schneller. Sie unterdrückte ein Keuchen, denn sie wollte lieber nicht entdeckt werden. Als sie auf die Handelsstraße vor der Stadt trat, war Cassia nicht mehr zu sehen. Hanna fürchtete sich allein hier draußen, vor den Wölfen, den Wegelagerern und vor allem vor der Gestalt aus ihrem Traum, aber darauf konnte sie keine Rücksicht nehmen. Die Wahrheit lächelte so schlicht auf sie herab, dass Hanna einen Augenblick lang vor Verblüffung stehenblieb: Wenn Cassia etwas zustieß, und dann auch noch durch ihr Verschulden, würde Hanna es nicht überstehen.
Einige Zeit später musste sich Hanna eingestehen, dass sie wahrlich kein Kind der Wildnis war. Sie hatte Cassias Fährte verloren, und zwar bereits in dem Moment, in dem sie die Stadt verlassen hatte. Die Geräusche um sie herum machten ihr Angst, sie konnte die Welt um sich herum nur schemenhaft erkennen. Ihr blieb nichts weiter übrig, als sich auf ihr Gefühl zu verlassen und nach der Hochebene zu eilen, so sehr sie in diesem Dunkel eben eilen konnte, ohne gegen einen Baum zu laufen, in einen Graben zu stürzen und sich beide Beine zu brechen.
Nach einem ermüdenden, aber ereignislosen Marsch hatte sie die Hochebene tatsächlich erreicht. Sie war schweißgebadet, und die Insekten der Nacht umschwirrten sie gierig. In einiger Entfernung lag der Hof, von dem Ezechiel, wenn er es denn tatsächlich gewesen war, gesprochen hatte. Er lag in völliger Dunkelheit… oder doch nicht? Hanna glaubte, ein schwaches Licht in einem der Fenster erkennen zu können, aber sicher war sie nicht.
Sie schlich näher an das schlafende Haus heran, wobei sie den matten Lichtschein im Auge zu behalten versuchte, den sie ausgemacht zu haben glaubte. Sie war bis auf etwa hundert Schritte an den Hof herangekommen, als dort drinnen ein goldrotes Leuchten wie ein riesiger Funke aufglomm. Das ganze Haus schien für einen Augenblick in einem stummen, gleißenden Licht aufzulodern, ein Licht, das sie wenige Stunden zuvor schon einmal gesehen hatte. Vögel spritzten in wirbelnden Scharen aus den Kronen der Bäume. Dann erlosch das unheimliche Leuchten und der Hof lag wieder in völliger Dunkelheit, doch vor Hannas Augen tanzten noch die grellen Schemen, als würde sie das Gebäude durch ein seltsam geschliffenes Glas betrachten.
Eine Gestalt löste sich aus der Schwärze, die den Hof umgab, und schien auf Hanna zuzufliegen, denn ihre Bewegungen waren furchterregend schnell und irgendwie unmenschlich, obwohl es sich um einen Menschen handeln musste. Hanna erstarrte, doch die Gestalt bemerkte sie entweder nicht oder schenkte ihr schlicht keine Beachtung, denn die raste an Hanna vorüber und wurde von der Finsternis verschluckt. Hanna lehnte sich an einen Baumstamm und schnappte nach Luft. Ihre Haut, ihre Augen, ihre Lungen brannten, als hätte die Gestalt das schreckliche Feuer, das Hanna gesehen hatte, mit sich getragen und sie damit gestreift. Eine Weile lang starrte sie in die Nacht hinaus, dann wieder auf den wie tot daliegenden Hof, bis endlich ein einziger Gedanke ihren Kopf erfüllte: Cassia?!
Hanna machte ein paar taumelnde Schritte auf das Bauernhaus zu, als eine zweite Gestalt aus der Türöffnung kam, ebenfalls taumelnd und mit zerzaustem Haar so dass Hanna einen Moment lang dachte, sie würde in einen Spiegel sehen. Cassia!
Die beiden Frauen liefen aufeinander zu, und Hanna rief: „Cassia! Was ist passiert?“
Cassia blieb einige Schritte von Hanna entfernt stehen, dann ließ sie sich ins nachtfeuchte Gras sinken, zog die Knie dicht an den Körper und verbarg ihren Kopf zwischen den Händen. Ihre Schultern bebten. Hanna eilte zu ihr, ließ sich neben Cassia auf die Knie fallen und legte ihr nach kurzem Zögern eine Hand auf den zuckenden Rücken.
„Innos, was ist nur passiert?“
Cassia gab ein Geräusch von sich, das Hanna zunächst für ein Schluchzen hielt.
„Sch, ruhig, Cassia, es ist alles gut, es ist alles gut…“
Cassia gab wieder diesen unheimlichen Laut von sich, dann hob sie den Kopf und sah Hanna an.
Hanna erkannte, dass sie sich gründlich geirrt hatte. Cassia schluchzte nicht, sie weinte nicht, sie lachte. Ihr Gesicht war von hysterischer Heiterkeit verzerrt, und das war noch viel unheimlicher. Sie lachte kreischend in die Nacht hinaus, japste nach Luft, ihre Schultern bebten, ihr ganzer Körper zuckte.
Hanna setzte sich neben sie ins Gras, streichelte sanft ihre Schultern und wartete darauf, dass der Anfall – denn um nichts Anderes konnte es sich handeln – zu Ende ging.
Irgendwann versiegte das Lachen, und Cassia wischte sich einige Tränen aus dem Gesicht. Ihre Züge entspannten sich langsam, und es stieg nur dann und wann ein einzelnes, blubberndes Kichern aus ihrer Kehle.
Als sie endlich anhob etwas zu sagen, war ihre Stimme heiser: „Weißt du, was so verdammt komisch ist, Hanna?“
„Ehrlich gesagt … ich kann es mir nicht vorstellen“, antwortete Hanna vorsichtig. Wer konnte schon wissen, ob das, was in Ezechiels Hof geschehen war, nicht so sehr an Cassias Verstand gerüttelt hatte, dass … nun ja, eine gewisse Vorsicht eben angebracht war.
„Ich sage es dir“, krächzte Cassia, „Weißt du, wer mit mir da drin war?“
„Ezechiel?“
„Daron. Der gute alte Daron. Daron, Hochmagier der Heiligen Flamme Innos‘, Meister des Ewigen Feuers, unter anderem auch ehemaliger Vormund der kleinen Cassia …“ Wieder stieg ein glucksendes Lachen in Cassia auf, was Hanna nicht besonders gefiel.
„Das klingt … wirklich sehr komisch“, erwiderte sie.
„Das eigentlich Komische ist aber,“ japste Cassia, „dass unser aller Liebling Daron von einem Dämon besessen ist, der die Welt der Menschen unterwerfen will.“
Hanna starrte sie an. Cassia hatte den Verstand verloren, das lag nun auf der Hand.
„Du hältst mich natürlich für verrückt, und vielleicht bin ich da drin auch verrückt geworden, …“ – sie deutete auf den dunklen Hof hinter ihnen – „…aber wenn das so ist, dann durch das, was er mir gezeigt hat“ Sie schwieg einen Moment, dann fuhr sie fort: „Innendrin hat er Hörner.“
Hanna erstarrte. Das war natürlich völlig verrückt. Kein Mensch könnte so etwas Verrücktes glauben. Trotzdem fragte sie: „Was hat er dir gezeigt?“
Cassia seufzte. Das Lachen war verschwunden, ganz und gar. „Ich wollte heute Nacht mit Ezechiel reden. Ihn ein paar Dinge fragen. Und als ich dort ankam, war Ezechiel gar nicht da, sondern mein alter Freund Daron, Priester der Selbstherrlichkeit. Nun, da Ezechiel nicht zur Verfügung stand, wollte ich eben Daron ein paar Dinge fragen, und er hat sich überhaupt nicht gewehrt, als ich… es sah fast so aus, als wollte er leiden… oder mehr… aber irgendwann… vielleicht bin ich etwas über das Ziel hinausgeschossen, aber ich war so verdammt wütend…“ Cassia sah Hanna flehend an, und Hanna streichelte beruhigend ihre Hand, bis diese fortfuhr: „Er hat mir sein wahres Gesicht gezeigt. Nicht Daron, sondern das, was in Daron lebt. Es hatte Angst, dass ich Daron zerstören würde.“ Sie brach ab, blickte einen Moment ins Leere und fuhr dann so leise fort, dass Hanna sich anstrengen musste, ihre Worte zu verstehen: „Er hatte Hörner!“
Hanna Mund fühlte sich plötzlich sehr trocken an, so trocken, dass sie die Worte ausspucken musste wie einen Mundvoll Sägespäne: „Ich weiß. Er hat immer Hörner.“
Cassia nickte. „Du kennst ihn also auch.“
„Ich träume von ihm“, antwortete Hanna.
Sie schwiegen eine Weile, während im Osten langsam ein dünner Rand von fahlem Licht aufglomm. Ein erster, verirrter Sonnenstrahl tastete über die Wiese.
Etwas funkelte dort im Gras, keine Armeslänge von Hanna entfernt.
Sie runzelte die Stirn und streckte ihre Hand nach dem funkelnden Gegenstand aus.
Es war ein kleiner Klumpen glänzenden Metalls, vielleicht Gold. Sie hielt das kleine Ding näher an ihre Augen. Ein Goldzahn. Spuren von geronnenem Blut klebten daran. Sie schrie auf und schleuderte den Zahn voller Abscheu von sich.
Cassia war sofort auf den Beinen, und mit einer katzenhaft schnellen Bewegung fing sie den Goldzahn noch im Flug auf, bevor er im Gras verschwinden konnte.
„Das ist Ezechiels Goldzahn. Sie haben ihn mitgenommen, aber er ist wohl nicht freiwillig mitgegangen.“
„Wohin haben sie ihn gebracht? Und warum?“ Hannas Gedanken drehten sich in wilden Spiralen. Nichts schien einen Sinn zu ergeben.
„Die Magier. Daron sagte, Ezechiel sei krank – krank im Kopf -, und alles, was er mir vielleicht gesagt habe, sei Auswuchs seiner Krankheit. Natürlich hat er mir nichts gesagt – ich habe ihn ja nicht einmal zu Gesicht bekommen -, aber langsam frage ich mich, ob er nicht noch viel mehr Dinge weiß als die, die ich aus ihm herausholen wollte. Schlimme Dinge. Sie haben Ezechiel gerade zu dem Zeitpunkt geholt, als er mit mir reden wollte. Merkwürdig, nicht wahr?“
Hanna war sich nicht sicher, ob es da irgendeinen Zusammenhang gab, und zuckte mit den Schultern.
„Ich muss wissen, was er mir sagen wollte – wovon der Dämon nicht wollte, dass ich es erfahre.“ Cassia sah ihre Freundin mit einer glühenden Hoffnung an, die Hanna auf der Grenze zum Wahnsinn zu tanzen schien. „Wir können es vielleicht aufhalten.“
Hanna erstarrte. Sie dachte an die Gestalten ihres Traums. „Davon will ich nichts wissen.“
„Hast du den Verstand verloren? Ein Dämon hat sich Darons bemächtigt und will Khorinis zu seinem Schlachthof machen, und du willst nichts davon wissen?“
„So ist es“, sagte Hanna kühl. „Das geht mich nichts an, und ich will nichts damit zu tun haben. Außerdem sind das aller Wahrscheinlichkeit nach Hirngespinste. “
Cassia starrte sie an. „Jetzt hör gut zu, Hanna: Wir beide gehen noch heute zum Kloster und holen uns Ezechiel. Was er weiß entscheidet vielleicht über Leben und Tod!“ Sie schloss ihre Hand fest um Ezechiels Goldzahn.
„Das kannst du nicht wissen!“, rief Hanna. „Wenn aber wirklich ein Dämon in Daron steckt, dann sollten wir zusehen, dass wir Land gewinnen und so viele Meilen wie möglich zwischen uns und Khorinis bringen!“ Sie dachte an die kalten, rauchenden Ruinen aus ihrem Traum, an die zuckenden Gestalten zwischen den Trümmern. Die Angst legte ihr kalte Hand um Hannas Eingeweide und drückte sanft zu.
„Hanna, wenn das alles nur Hirngespinste sind, dann sieh es als gute Tat an einem armen, alten Mann, der jetzt in den Fängen skrupelloser Feuermagier – oder noch schlimmer, der Barmherzigen Schwestern Innos‘ – ist, die ihm vielleicht schreckliche Dinge antun, weil sie von derselben Wahnvorstellung befallen sind. Wenn es aber wahr ist…“ – sie schwieg eine Weile, so als müsste sie die Bedeutung dieser Worte erst selbst erfassen – „wenn es aber wahr ist, dann müssen wir herausfinden, warum sie ihn zum Schweigen bringen wollen.“
Cassia setzte sich Bewegung.
„Nein!“ Panik stieg in Hanna auf. „Wir werden das nicht tun!“, sagte sie, aber ihre Worte klangen sogar in ihren eigenen Ohren lahm. Sie versuchte, und die dünnen Fäden, die in einem wirren Knäuel vor ihrem geistigen Auge lagen, zu einem klaren Bild zu verweben.
Halte dich an die Tatsachen!
Nun, die Tatsachen lagen auf der Hand: Sie selbst träumte seit einigen Wochen schlecht. Nun, das kam vor. Cassia hatte versucht, ihren Onkel zu besuchen, der ihr irgendwelche Altmännerweisheiten anvertrauen oder – falls Daron Recht hatte – Spinnereien ins Ohr setzen wollte. Onkel Ezechiel war jedoch offenbar zur Behandlung seiner wie auch immer gearteten Krankheit ins Kloster gebracht worden, wobei sein ausgeschlagener Zahn bewies, dass dies nicht mit seinem Einverständnis geschehen war. So weit, so gut. Dass ein Wahnsinniger seinen Wahnsinn nicht einsehen wollte, kam wohl nicht zum ersten Mal vor. Dann war Cassia etwas zugestoßen, was ihren sonst so scharfen Verstand durcheinandergebracht hatte. Entweder - und das war bei Weitem das Wahrscheinlichste – hatte der Feuermagier einen seinen schmutzigen Zaubertricks angewandt und Cassia Dinge glauben gemacht, die ihr Angst einjagen sollten. Dabei hatte er sie natürlich völlig falsch eingeschätzt: Einen aufsässigen Geist wie den Cassias reizten Drohungen nur umso stärker. Ging man aber davon aus, dass … - Hanna musste sich zwingen, diesen Gedanken weiter zu verfolgen - … ging man aber davon aus, dass die Erscheinung, die Cassia in der Wohnstube des Hofes gehabt hatte, in irgendeiner Weise mit ihren, Hannas, Träumen zusammenhing, dann waren sie in allerhöchster Gefahr. Aber das war so gut wie ausgeschlossen, oder? Oder? Hanna hoffte auf eine Art innerer Stimme, die ihr das bestätigen würde, eine Stimme wie die einer sanften Mutter, aber in ihrem Inneren war nur tiefste Stille.
Während Hanna mit aller Kraft versuchte, ihre unerklärliche und vernunftwidrige Aufwallung von Furcht niederzukämpfen, hatte sich Cassia bereits auf den Weg gemacht. Mit den ihr eigenen anmutigen Bewegungen eilte sie durch das graue Dämmerlicht, das die Hochebene einhüllte. Hanna sah ein, dass es sinnlos war, Widerstand zu leisten. Es war das Beste, ihrer Freundin klarzumachen, dass Daron einen hinterhältigen Trick eingesetzt hatte und dass das einzig Richtige, was sie in dieser Lage tun konnten, war, nach Hause zu gehen und Onkel Ezechiel die Suppe alleine auslöffeln zu lassen, die er sich offenbar selbst eingebrockt hatte.
„Warte!“, rief sie Cassia nach und setzte sich ihrerseits in Bewegung. Als sie ihre Freundin eingeholt hatte, war Hanna bereits außer Atem und ihre Haare waren feucht von Dunst und Schweiß. Es würde wieder ein heißer Tag werden, so viel stand fest.
Hanna wusste, dass sie klug vorgehen musste, wenn sie Cassia wieder zur Vernunft bringen wollte. Einen aufsässigen Geist wie den Cassias reizte man durch Widerstand nur noch mehr, nicht wahr? Deshalb sagte sie, als sie einen kleinen Hain erreichten, in dem eine kleine, silbrige Quelle sprudelte: „Lass uns eine kurze Rast machen. Ich habe Durst, und ein paar Tropfen kaltes Wasser auf meiner Stirn würden mir auch nicht schaden.“
Cassia nickte und schöpfte sich ebenfalls etwas von dem kühlen, klaren Wasser. Sie trank in gierigen Schlucken, so dass der Ausschnitt ihres Kleides ganz durchnässt war, als sie sich wieder erhob.
Hanna ließ sich ins weiche Gras sinken. „Cassia, wir sollten einen Plan fassen, wenn wir Ezechiel finden und befreien wollen. Wir können wohl kaum durch die Klosterpforte marschieren und ihn abholen, oder?“
Dieser Gedanke war Cassia offenbar noch gar nicht gekommen, wenn Hanna den verblüfften Ausdruck auf dem Gesicht ihrer Freundin richtig deutete. Sie schien angestrengt nachzudenken. Dabei drehte sie einen kleinen Gegenstand zwischen den Fingern ihren rechten Hand hin und her. Als Hanna genauer hinsah, erkannte sie, dass es sich um Ezechiels Goldzahn handelte. Abscheu und zugleich Faszination erfüllten sie. Ohne es zu wollen, streckte sie ihre Hand danach aus: „Gib ihn mir auch mal!“
Cassia ließ das gruselige Ding in Hannas Hand gleiten. Der Zahn funkelte boshaft in der Morgensonne.
„Er kommt mir so leicht vor“, murmelte Hanna. „Dafür, dass er aus Gold sein soll.“
Cassia sah sie überrascht an, dann lachte sie. „Das würde zu Onkelchen passen! Ein falscher Goldzahn!“ Ein hartes. sonniges Lächeln dabei auf ihren Lippen.
Hanna hob den Goldzahn hoch, von dem immer noch eine schaurige Anziehungskraft ausging, und ließ einen Sonnenstrahl darauf tanzen. Sie betrachtete ihn nachdenklich. Später konnte sie nicht mehr sagen, wie es passierte – oder was überhaupt passierte -, aber von einem Augenblick zum anderen schien das Metall in ihrer Hand nicht mehr glatt und glänzend zu sein, sondern trocken, fast körnig zu werden, wie ein Stück Sandstein, als würde die Kraft der Sonne es zum Welken bringen. Sie kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können, was vor sich ging, aber es ging zu schnell. Bevor ihr Verstand erfassen konnte, was geschah, zerfiel der Zahn zwischen ihren Fingern zu feinem, glitzerndem Staub, der wie ein Hauch von magischem Licht durch die Luft tanzte.
„Cassia, hast du das gesehen?“, stieß Hanna hervor.
„Wie… wie hast du das gemacht?“, stammelte Cassia.
„Ich habe gar nichts gemacht, das musst du mir glauben! Er ist einfach zerfallen.“ Hanna versuchte, auf die tanzenden Staubkörnchen zu zeigen, doch sie waren nicht mehr zu sehen. „Ich weiß nicht, was…“
Cassia schnitt ihre Worte mit einer Handbewegung ab. Auf ihrem Gesicht lag ein seltsamer Ausdruck, als sie sich erhob und sagte: „Steh auf, wir müssen weiter.“
Hanna zog es vor, nicht zu antworten. Sie stand ebenfalls auf und folgte Cassia, ohne sich noch einmal umzublicken.
-
Kapitel 4: Familienbande
Die Myrtanische See lag als gewaltiger, dunkler Spiegel unter dem unendlichen Himmel, an dem sich gleich das Schauspiel vollziehen würde, auf das ganz Khorinis seit Wochen hinfieberte. Keiner, der sich nicht für den heutigen Tag – den die Magier der Heiligen Flamme zum allgemeinen Feiertag zu Ehren des Herrn Innos erklärt hatten – einige Glasstücke über einem Feuer geschwärzt hätte, um zu betrachten, wie die Sonne ihr feuriges Antlitz für einige Augenblicke verdunkeln würde. Es war ein herrlicher Sommertag, noch stand die Sonne in ihrer vollen, kreisrunden Pracht über Khorinis. Der Himmel war von einem Blau, das mit dem Azur der klaren See um die Wette strahlte, und keine Wolke hatte es gewagt, das himmlische Spektakel stören zu wollen. Den ganzen Vormittag über summten die Straßen der Hafenstadt von geschäftiger Betriebsamkeit. Jeder Händler, jeder Dieb und jeder Schankwirt arbeitete Doppelschichten. Kuchen, Brot, Käse, Würste und Früchte aller Art gingen über die Ladentheken, ebenso Wein, dunkles Khoriner Bier und Reisschnaps. Daron, ein junger und aufstrebender Magier der Heiligen Flamme, hatte zu frommen Gebeten unter freiem Himmel aufgerufen, so dass sich jeder Bürger von Khorinis, der Beine hatte zu gehen, einen Platz im Schoße der Natur suchte, die meisten mit einem Korb voller Leckereien und Wein, auch wenn Daron das so nicht ausdrücklich gefordert hatte. Auf den Hochebenen um Khorinis, auf den heiteren Lichtungen der Laubhaine, im hellen, weichen Sand des Gestades der Hafenstadt, überall wimmelte es von fröhlich tollenden Kindern und Erwachsenen, allesamt fromme Männer und Frauen des Herrn – zumindest für diesen Nachmittag -, die Innos die Ehre erweisen wollten. Niemand von ihnen hatte ein solches Schauspiel je erlebt, nicht einmal die ältesten unter ihnen, so dass eine freudige Erregung und Spannung über sämtliche bevölkerten Plätze um die Stadt herum schwappte. Wer nicht zu beschäftigt damit war, sein Picknick zu verzehren, konnte bereits durch seine Glasscheiben beobachten, wie eine schmale schwarze Sichel am Rund der Sonne nagte und sich weiter und weiter dort hineinfraß.
Er saß auf seinem kleinen Floß am Strand und wartete. Wie alle Menschen um ihn herum wartete er auf die Sonnenfinsternis, und er wartete auf seine Nichte Jenna, die sie mit ihm zusammen vom Meer aus betrachten wollte, und er wartete auf etwas Drittes, das er nicht in Worte fassen konnte, etwas, das so unaussprechlich und verheißungsvoll und verlockend war, dass sein Geist zu klein dafür zu sein schien, um es ganz zu erfassen. Etwas, das er in seinen schwärzesten Träumen immer wieder erlebte, aus denen er schweißgebadet und voll von schockierter Lust erwachte. Etwas, das die irdischen Gesetze ebenso wie das göttliche Recht mit schwersten Strafen und ewiger Verdammnis bedrohten. Doch heute wandte der Herr sein Gesicht von der Erde ab, und je länger er darüber nachdachte, desto überzeugender wurde die flüsternde Stimme in seinem Bewusstsein, die darauf hinwies, dass auch ein strenger Gott wie Innos seinen geliebten Geschöpfen ab und an einen Augenblick gönnen wollte, einen Augenblick des Unbeobachtetseins, in dem sie, wenn auch nur für einen Moment, ihren dunkelsten Leidenschaften nachgeben durften. Die Stimme hatte in den letzten Wochen oft zu ihm gesprochen. Er hatte sich immer für einen vernünftigen Mann gehalten, der körperlose Stimmen als ein sicheres Zeichen beginnenden Schwachsinns deuten würde, aber in seinem Fall lag die Sache ein wenig anders. Die Stimme war keine Einbildung, kein Auswuchs einer Geisteskrankheit. Sie war real, so real wie seine eigene Stimme, wie die seiner Schwester oder die seiner Nichten. Zugegebenermaßen hatte sie keinen Körper, aber sie war vernünftig, und sie wusste Dinge. Nicht nur Dinge über ihn selbst, nein, Dinge über jeden in der Stadt, die sie mit ihm teilte. Es waren reizvolle, schmutzige Dinge, und für ihn war es eine nachtschwarze Lust, sich an diesen Wahrheiten zu erfreuen. Die Stimme hatte ihm einiges über seine süße Nichte Jenna erzählt. Als er daran dachte, was genau ihm die Stimme zugeflüstert hatte, legte sich ein wölfisches Grinsen auf sein Gesicht.
Jenna war kein Kind mehr, sie war auf dem Weg zur Frau, zu einer wunderschönen, verführerischen Frau, und es war nur natürlich, dass sie ihn anzog. In den letzten Monaten hatte es immer wieder Zeichen gegeben. Wie sie ihn ins Vertrauen zog, wenn sie wieder einmal Streit mit ihrer Mutter hatte. Wie sie sich an ihn schmiegte, wenn sie ihn zur Begrüßung umarmte – immer einen Augenblick länger und ein bisschen ungestümer, als es sich für ein anständiges Mädchen gehörte. Wie sie ihn mit ihren zu roten, weichen Lippen anlächelte. Die Blicke, immer ein wenig zu verwegen unter ihren dichten Wimpern. Sie war kein Mädchen mehr, sie war eindeutig eine junge Frau, eine Frau, die wusste, was sie wollte. Eine Sehnsucht und ein Verlangen erfüllten ihn, wie er es noch nie erlebt hatte, ein süßer, ziehender Schmerz, der bis in jede Faser seines Körpers reichte.
Oh Jenna!
Er seufzte und wartete.
Ezechiels Erwachen glich einem Schnitt mit einer Rasierklinge, schnell, schmerzhaft und glasklar. Eben war er noch von der gnädigen Umarmung einer herrlichen Erinnerung umfangen gewesen, und nun traf ihn die Wirklichkeit wie ein Schlag. In der irrsinnigen Hoffnung, etwas könnte sich an seiner Lage geändert haben, während er geschlafen hatte, wandte er seinen Kopf so weit wie möglich nach links. Ein glasklarer Schmerz dort, wo die Schulter in den Nacken überging, machte den winzigen Funken Hoffnung zunichte. Er war immer noch hier. Immer noch in der Zelle. Erstes Morgenlicht schien durch das winzige, vergitterte Fenster. Ezechiel berührte vorsichtig seinen Mund, der ebenfalls schmerzte. Die Lippen waren aufgeplatzt, und dort, wo der Goldzahn, sein langjähriger Begleiter seit den Tagen der Sonnenfinsternis, in seinem Fleisch gesteckt hatte, klaffte nun ein pulsierendes Loch. So merkwürdig es ihm angesichts der schmerzenden Wunde vorkam: Er spürte eine gewisse Erleichterung darüber, das Ding los zu sein. Als wäre er von einer harmlosen, aber lästigen Krankheit genesen. Als er seine Finger, mit denen der sein Gesicht berührt hatte, betrachtete, sah er rostbraune Spuren halb getrockneten Blutes daran.
Ezechiel lag auf dem schmalen Bett einer Novizenkammer. Über dem Bett war eine Darstellung des Gütigen Herrn Innos in den Putz der Wand gemalt worden, mit sonnenumkränzten Haupt und ausgebreiteten Armen. Eine Truhe stand an der Wand unter dem Fenster. Er setzte sich vorsichtig und geräuschlos in seinem Bett auf und versuchte, über seine Lage nachzudenken. Sie war
ausweglos
schwierig, denn er befand sich in einer Zelle des Klosters, und dazu noch in der Gefangenschaft des Mannes, der ihm ein unangenehmes Erlebnis in seinem eigenen Wohnzimmer beschert hatte. Mit Drohungen und Schlägen hatte ihn eine Rotte Novizen aus seinem Haus geschleift, und Daron, der hakenhändige Obermotz der Heiligen Flamme, hatte dabeigestanden und mit salbungsvoller Stimme auf ihn eingeredet, dass dies alles nur zu seinem, Ezechiels, Bestem geschehe. Er, Daron, würde ihm helfen, die Stimme loszuwerden, aber Ezechiel konnte er nicht täuschen. Vielleicht war es wirklich Daron. Aber ganz sicher war es nicht nur Daron, der da sprach. Hinter den flatternden Vorhängen im Hinterzimmer von Ezechiels Verstandes war etwas verborgen, von dem er nur die knochigen Skelettfüße unter dem Saum sehen konnte. Ezechiel kannte die Stimme schon viel zu lange, auch wenn sie sich verstellte.
Ezechiel stand auf, wobei sein ganzer Körper zu ächzen schien, und ging in der kleinen Zelle umher. Er untersuchte die Tür – aus dickem Eichenholz und verschlossen – und öffnete die Truhe, doch darin fand er nur ein paar fleckige Wäschestücke und die Holzkohlezeichnung eines Mädchens. Das Mädchen auf dem Bild war nackt und erinnerte ihn an jemanden. Er starrte auf den nackten, langen Schenkel des Holzkohlemädchens. Vor seinem geistigen Auge sah er eine Männerhand, die sich einen weißen Mädchenschenkel entlangschob, langsam, aber stetig, immer höher, bis sie den Saum eines zu kurzen Sommerkleides erreichte.
Der Nachmittag hatte sich verändert. Die Farben, die eben noch leuchtend gewesen waren, erschienen jetzt blass und pastellgetönt. Sogar das Licht war matt geworden.
Jenna saß auf seinem Schoß. Ihr ganzer Körper schien vor Anspannung zu vibrieren, was eine merkwürdige Empfindung bei ihm auslöste. „Es passiert“, flüsterte sie. „Die Sonne verlischt.“
„Ja“, erwiderte Ezechiel. Er erkannte seine eigene Stimme kaum wieder.
Um sie zu beruhigen – jedenfalls war er später davon überzeugt, dass er das nervöse Mädchen nur durch eine Berührung hatte beruhigen wollen -, legte er seine Hand auf ihr Bein. Er spürte, wie eine leichte Gänsehaut ihren nackten Schenkel überzog.
„Kann ich jetzt schon durch das Glas in die Sonne sehen?“
„Noch nicht. Warte noch“, sagte er, während seine Hand weiter an ihrem Schenkel hinauf wanderte. Sie legte ihre eigene Hand auf seine, drehte sich zu ihm um und lächelte. Lächelte auffordernd.
„Aufregend, nicht?“
Wenn du wüsstest…
„Ja, das ist es,“ brachte er mit seiner merkwürdigen neuen Stimme hervor.
Jenna schwieg und starrte weiter auf das Spiegelbild der Sonne im Meer, aber dann begann sie, sich auf seinem Schoß zu bewegen. Aufreizend zu bewegen. Ezechiel zog rasch und keuchend Luft ein.
„Ezechiel? Bin ich zu schwer? Habe ich dir wehgetan?“
Im Gegenteil.
„Nein, alles in Ordnung.“
Ezechiel wusste, dass nun der Moment gekommen war, in dem er es aufhalten musste. Er würde jetzt unter einem Vorwand aufstehen, sie dabei sanft von seinem Schoß schieben und vom Floß in das kühle Wasser der Myrtanischen See springen. Sein Verstand sagte ihm klar und deutlich, dass genau jetzt der richtige Moment für eine kleine Abkühlung gekommen war. Aber der andere Teil – ein ziemlich großer Teil übrigens – und die Stimme hielten ihn zurück. War es nicht offensichtlich, dass sie die Unschuld nur spielte? Innos würde sein Antlitz gleich von seinen Geschöpfen abwenden, und es lag auf der Hand, dass er es nur dafür tat. Für ihn und für sie, denn sie wünschte es sich doch ebenso. Wieso sonst hätte sie den Nachmittag allein mit ihm verbringen wollen, statt mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester Cassia? Warum war sie auf seinen Vorschlag eingegangen, das viel zu kurze Kleid anzuziehen? Weil sie es ebenso wollte wie er.
Ezechiel blickte zum Himmel. Ein schwarzer Ball hing dort, nach links begrenzt von einer lodernden Sichel aus Sonnenlicht, so grell, dass sie auf der Meeresoberfläche zu schweben schien.
Die Pastelltöne des Nachmittags waren zu Wasserfarben verblasst, Dunkelheit senkte sich mit einem Mal über die Erde. Als ob sie der Stimme Recht geben wollte, schmiegte sich Jenna eng an Ezechiels Brust.
„Darf ich jetzt durch das Glas zum Himmel schauen?“
„Ja. Jetzt ist es gut. Aber wenn ich es dir sage, musst du aufhören. Hast du das verstanden?“
Sie nickte heftig, legte den Kopf in den Nacken und sah durch das dunkle Glas. Ezechiel blickte über ihre Schulter ebenfalls hinauf.
Der Himmel war in dunkles Indigoblau getaucht. Um den tiefschwarzen Ball, der dort schwebte, loderte ein schmaler Kreis hellen Lichts. Sterne schienen in den Tiefen der Myrtanischen See zu brennen. Jennas Körper erzitterte.
Der Moment, es aufzuhalten, war verstrichen.
Die Stimme befahl:
Tu es jetzt!
Ein kratzendes Geräusch riss Ezechiel aus seinen Erinnerungen. Es klang wie eine Feile, die an Metall schabte, und es kam vom Fenster. Ezechiel blinzelte in das Morgenlicht, das durch die Gitter fiel. Eine Hand hatte sich in die kleine Öffnung gelegt, eine Hand, die mit Wasserpflanzen bewachsen war. Ezechiel stockte der Atem. Irgendeine schreckliche Kreatur aus der Myrtanischen See war gekommen, um ihn zu holen, um Rache zu nehmen für den Frevel, den er auf dem stillen, dunklen Spiegel des Meeres…
Das Gitter, das seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, in der uralten Kalksteinmauer steckte, fiel mit leisem Poltern in die offene Truhe, die unter dem Fenster stand.
Ezechiel stieß ein tonloses Gurgeln aus.
Ein Kopf erschien in der Öffnung. Es war nicht das grässliche Haupt eines Seeungeheuers, aber nahe daran. Wirres, nasses, mit Pflanzenteilen durchsetztes Haar umrahmte ein kalkweißes Gesicht mit hektischen roten Flecken auf den Wangen. Der Mund war vor Anstrengung verzerrt, aber die Augen blickten voll kaltem, tödlichem Zorn in seine Zelle.
„Bist du da drin, alter Mann?“
Ezechiel nickte und gab einen unbestimmten Laut von sich.
Das Geschöpf, das sich bei näherer Betrachtung als junge Frau erwies, schob sich mit katzenhafter Geschicklichkeit durch die schmale Öffnung und landete ebenfalls auf den grauen Wäschestücken in der Truhe.
Es war Cassia.
Seine Nichte Cassia.
„Wie kommst du hierher?“, fragte Ezechiel fassungslos. „Wie hast du mich gefunden?“
Er zerknüllte das Blatt Papier mit dem nackten Holzkohlemädchen in seiner Faust.
Cassia richtete sich auf, strich ihr tropfnasses Gewand glatt, so gut es ging und erwiderte kühl: „Mein lieber Onkel, vielleicht hast du vergessen, dass ich jahrelang in der Obhut der Barmherzigen Schwestern Innos‘ in diesem Kloster eingesperrt war, weil weder Mutter noch du in der Lage waren, euch um mich zu kümmern. Ich hingegen habe nichts vergessen.“ Cassia lächelte hart und sonnig. „In dieser Arrestzelle habe ich auch manche Nacht verbracht – zumindest gingen die Barmherzigen Schwestern davon aus, dass ich sie hier verbrachte -, und ich kenne alle möglichen Wege durch den See und den Felsen hinauf oder hinab. Aber kommen wir zum Punkt…“ - sie musterte sein geschwollenes Gesicht mit einem Ausdruck, der eher Befriedigung zu sein schien als Mitgefühl – „… jetzt steckst [i]du[/] hier fest, was?“ Sie lachte auf, dann wurde ihr Gesicht wieder ernst. „Ich bin letzte Nacht zu deinem Haus gekommen, einerseits, weil du mich darum gebeten hattest, andererseits – und das war der wichtigere Grund – um dir die Fresse zu polieren. Das werde ich vielleicht auch noch tun, aber…“
Cassia zögerte. Ezechiel nutzte den Augenblick des Zauderns und öffnete den schmerzenden Mund, um etwas zu sagen. Cassia kam ihm zuvor: „Hat das, was du mir sagen wolltest, irgendetwas mit einem Dämon zu tun?“ Sie lachte wieder auf, diesmal schrill und misstönend, so als hielte sie das, was sie gerade ausgesprochen hatte, für die lächerlichste Vorstellung überhaupt. Was es streng genommen auch war, oder?
Ezechiel brauchte einen Moment, um seine Verblüffung zu überwinden. Dann sagte er: „Es ist schlimmer, als du dir vorstellen kannst. Jenna…“
Sie schnitt ihm das Wort mit einer herrischen Geste ab. „Lass Jenna aus dem Spiel! Wir reden jetzt über den Dämon.“
„Was weißt du darüber, Kleines?“
Sie schnaubte verächtlich: „Ich weiß nichts, außer dass ein gehörnter Dämon mit goldenen Augen in unserem lieben Daron haust. Er hat mir in dem kurzen Augenblick unserer Begegnung letzte Nacht Dinge gezeigt, die unmittelbar bevorstehen. Entsetzliche Dinge. Hanna, die Wirtin, mit der du gesprochen hast, träumt davon, seit Wochen, immer wieder.“
Cassia kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen: „Was hast du damit zu tun, alter Mann? Und warum wolltest du mich sprechen?“
Ezechiel griff nach ihrer Hand, aber Cassia zog sie so schnell fort, als wäre seine Hand ein großes, abscheuliches und gefährliches Insekt.
„Ich kann es dir nicht genau erklären. Ich verstehe es selbst nicht genau. Dieser Dämon … er nennt sich Krushak. Er hat schon einmal zu mir gesprochen, damals, um die Zeit der Sonnenfinsternis herum. Irgendwann war seine Stimme wieder fort, und ich dachte … ich weiß nicht, was ich dachte, aber ich hatte gehofft, er sei einfach verschwunden. Aber er war eingeschlafen, und ich glaube, er hat die ganzen Jahre über in Daron geschlafen. Es war ein unruhiger Schlaf, aus dem er immer wieder für kurze Augenblicke hochfuhr. Jedes Mal, wenn das geschah, habe ich es gespürt; es war wie ein dumpfer Schmerz in meinem Kopf, pochend und irgendwie eitrig, wie ein faulender Zahn. Und nun ist er wieder wach, richtig wach. Er hatte die Verbindung zu mir nie ganz aufgegeben, vielleicht, weil sie aufzuheben ihm nicht den Aufwand wert schien oder vielleicht ist er einfach nur zu dumm, seine Spuren zu verwischen.“ Nun war es Ezechiel, der lachte, aber zugleich liefen Tränen über seine zerfurchten Wangen. Er senkte die Stimme und fuhr fort: „Ich konnte hören, was er vorhat. Ich hörte es Tag und Nacht, worum seine Gedanken kreisten, und ich verliere darüber den Verstand!“
Cassias Miene wurde ein wenig weicher – aber nicht so sehr, wie er gehofft hatte. „Was hat er vor? Und was hat das mit mir zu tun? Wenn es um einen Dämon geht, dann wende dich doch an irgendwelche Magier, die etwas davon verstehen!“
Ezechiel sah sie kopfschüttelnd an. „Die Magier sind doch Teil des Ganzen. Ich glaube, sie haben diesen Dämon erst gerufen. Mag es ein missglücktes Ritual gewesen sein, ein Unfall, was auch immer. Krushak steckt in Daron, aber dort kann er nicht mehr lange bleiben. Er braucht eine neue Hülle. Und er braucht…“ Ezechiel wagte nicht, Cassia ins Gesicht zu sehen. Er war sicher, dass sie nicht wusste von dem, was damals, als sich die Sonne verdunkelte, geschehen war, aber er hielt es für möglich, dass sie ihm direkt in die schwärzesten Tiefen seiner Seele blicken konnte.
„Er braucht was?“
Ezechiel blickte unter großer Anstrengung zu ihr auf, doch die Worte blieben ihm wie trockene Ballen Sägespäne im Halse stecken.
Auf einmal wurden Cassias Augen sehr groß, und ihr Gesicht noch bleicher als zuvor.
„Er braucht Jenna. Ist es das, was du sagen willst?“
Ezechiel nickte stumm.
„Ist Jenna deshalb verschwunden? Weil sie wusste, dass Krushak hinter ihr her ist?“
Das war sicher nicht der Fall, aber Ezechiel hielt es für besser – in jeder Hinsicht und für alle Beteiligten besser -, an dieser Stelle zu nicken.
„Ich wollte dich sprechen, weil du vielleicht weißt, wo Jenna ist. Vielleicht kannst du ihr schreiben, dass sie auf gar keinen Fall zurückkommen darf.“
„Ich weiß nichts von ihr. Ich denke nicht einmal mehr an sie“, sagte Cassia, aber Ezechiel hatte da so seine Zweifel, was die letzte Behauptung betraf.
Er ließ sich auf seinem schmalen Bett zurücksinken und sagte:
„Dann musst du sie suchen. Als Krushak letzte Nacht in Darons Gestalt zu mir kam, konnte ich sehen, was er vorhat. Bald wird es Khorinis nicht mehr geben, und alle Menschen hier werden...“, er brach ab. Nach einer Weile fuhr er fort: „Aber er kann es nicht alleine vollbringen. Er braucht Jenna dazu, und er hat sie bereits gerufen. Ich fürchte, dass sie dem Ruf folgen könnte, ohne zu wissen, was sie da tut.“
„Aber wozu braucht er sie? Und warum ausgerechnet Jenna?“
Ezechiel dachte an eine Männerhand auf einem weißen Mädchenschenkel, an eine Hand auf einer noch kaum vorhandenen Brust. Er antwortete: „Ich weiß es nicht. Das hat er mir nicht gezeigt.“
Cassia sah Ezechiel misstrauisch an. Dann sagte sie leise: „Wenn du mich hier zum Narren halten willst, oder wenn auch nur ein Wort von dem, was du mir gesagt hast, erfunden ist, dann bist du dran. Hast du das verstanden?“
Ezechiel nickte. Cassia schien ihm die Art Frau zu sein, mit der man sich lieber keine Spielchen erlaubte - oder sie es zumindest nicht merken ließ.
„Wo soll ich sie suchen? Und wie soll ich sie finden? Sie hat mir zum Abschied nichts als eine blutende Lippe hinterlassen.“
„Ich glaube, dass sie Krushaks Ruf bereits gefolgt ist. Sie muss sich auf dem Weg hierher befinden.“
Cassia schnaubte. „Das hilft mir nicht weiter.“ Wieder warf sie ihm einen feindseligen Blick aus zusammengekniffenen Augen zu. „Du weißt etwas, oder? Jedenfalls weißt du mehr, als du zugibst. Hat sie dir etwas gesagt, bevor sie verschwunden ist?“
Ezechiel schluckte. Jetzt war Vorsicht geboten. Cassia war schlauer, als er vermutet hatte.
„Ich weiß nichts Genaues“, sagte er ausweichend. „Sie hat mir allerdings tatsächlich etwas hinterlassen… einen Hinweis, eine Art Brief.“
„Was für einen Hinweis? Warum hast du mir nie davon erzählt? Zeig ihn mir!“
„Ich habe ihn nicht bei mir. Ich hielt es für besser, ihn zu verstecken… zu Jennas Schutz natürlich.“ Ezechiel zögerte.
„Spuck es endlich aus!“ Cassias Augen funkelten wild.
Nun, was hatte er noch zu verlieren?
„Sie hat mir eine kleine Innosfigur hinterlassen, aus Bergkristall. Und darin hat sie etwas eingeritzt; Zeichen, auf die ich mir keinen Reim machen konnte. Vielleicht kannst du etwas damit anfangen.“
Cassia starrte ihn an. Fassungslose Wut stand in ihrem Gesicht. „Sie hat eine Nachricht hinterlassen, und du hast es vor mir verheimlicht? Du mieser…“
Ezechiel wollte sich lieber nicht mit Erklärungen aufhalten… dass die Innosfigur in ein dunkles Tuch gewickelt war – dunkel wie der Himmel, als sich die Sonne verfinsterte -, dass die merkwürdigen Zeichen, die darauf eingeritzt waren, durchaus etwas bedeuten konnten wie…
Ezechiel legte seine Hand auf ihre linke Brust, während er sie mit der anderen Hand auf seinem Schoß festhielt und begann, sich an ihr zu reiben. Er atmete nun schnell und keuchend.
„Onkel Ezechiel? Geht… geht es dir gut?“
„Ja“, sagte er mit einer Stimme, die einem Fremden zu gehören schien. „Ja, aber dreh dich nicht um. Sieh dir die Sonne an.“
Er bewegte sich. Die Hand, die auf ihrer Brust gelegen hatte, wanderte weiter; die andere, die auf ihrem Schenkel glitt weiter nach oben und schob den Saum ihres Kleides vor sich her.
„Was machst du da?“, flüsterte sie mit dünner Stimme. Dunkelheit hatte sich über das Floß gesenkt, und es schien, als würde diese Dunkelheit alle Farben und alle Geräusche aufsaugen.
„Liebst du mich, Jenna?“
„Cassia, wir haben keine Zeit, jetzt über die Umstände von Jennas Verschwinden zu reden. Diese Nachricht ist die einzige Hoffnung, die ich habe. Ich habe sie in einer kleinen Metallkiste eingeschlossen und vergraben. Zu Füßen des Innosschreins am Strand, nördlich des Leuchtturms, wo ich früher mein Floß hatte, weißt du noch?“
„Dann sollten wir sie jetzt holen gehen, alter Mann. Ich hoffe, du hast nicht vergessen, wie man schwimmt.“
Cassia blickte prüfend auf die Wäschestücke, die auf dem Boden um die Truhe herum lagen. Sie nahm ein fleckiges Leinenhemd mit kurzen Ärmeln und eine zerschlissene knielange Hose. Dann sagte sie, während sie ihr nasses, mit Wasserpflanzen überzogenes Kleid abstreifte: „Das Ding behindert mich nur beim Schwimmen. Dreh dich um, alter Mann, ich werde mir jetzt praktischere Kleidung anziehen.“ Sie musterte Ezechiel, der ebenfalls in der Leinenwäsche vor ihr saß, in der ihn die Novizen abgeholt hatten. Das Hemd war mit rostbrauen Schlieren besudelt. Ezechiel erhaschte einen kurzen Blick auf den Ansatz von Cassias Brüsten, dann wandte er sich ab und blickte zur Tür – keine weiteren schmerzhaften Erinnerungen, bitte.
Er hörte, wie Cassias Kleid mit einem nassen, satten Geräusch zu Boden fiel, und dann hörte er noch etwas Anderes.
Schritte
Stimmen
Jemand kam.
Ezechiel stockte der Atem.
Während er sich zu seiner Nichte umwandte, flüsterte er:
„Sie kommen, wir müssen uns be…“
Cassia war verschwunden. Auf dem Boden lagen noch ihr Kleid und die Wäschestücke, die sie einfach hatte fallen lassen. Durch das kleine Fenster über der Truhe fiel
Während Ezechiel noch auf die Stelle starrte, an der eben noch seine mutmaßlich nackte Nichte gestanden hatte und geneigt war, ihr plötzliches Erscheinen für den bösen Streich eines hinterhältigen und verschlagenen Gottes zu halten – mit der Schlusspointe ihres ebenso plötzlichen Verschwindens -, hörte er, wie sich jemand von außen an der Tür zu schaffen machte. Das Schloss war alt und klemmte, von draußen drang ein ärgerliches Grunzen herein. Ezechiel schloss die Augen. Er musste sich entscheiden.
-
Kapitel 5: Der innere Kreis
Wenn einer der Novizen in diesem Augenblick Darons Studierzimmer betreten hätte, hätte er den großen Meister der Heiligen Flamme reglos an seinem Schreibtisch sitzen sehen, ein geöffnetes Tintenfass darauf, eine Schreibfeder in die Vorrichtung geklemmt, die an dem Haken befestigt war, wo sich vor vielen Jahren noch seine rechte Hand befunden hatte. Die Novizen hatten die wildesten Gerüchte über den Verlust von Darons Händen gehört: er habe sie beim Experimentieren mit Sprengtränken eingebüßt; sie seien ihm abgefallen, weil er gegen eines der Gebote des Herrn verstoßen hatte; er habe sie verloren, als er heldenhaft mit bloßen Händen die vergiftete Klinge eines Attentäters abwehrte. Daron selbst hielt sich in dieser Sache immer sehr bedeckt, so dass man davon ausgehen konnte, dass zumindest das zuletzt genannte Gerücht in das Reich der Phantasie gehörte. Die haarsträubendste aller Geschichten allerdings war die, dass er sie selbst so lange ins Feuer gehalten hatte, bis sie zu rauchenden, schwarzen Stümpfen verkohlt waren, um einen Dämon zu bezwinge, der bei einem geheimnisvollen Ritual in der Kathedrale von ihnen Besitz ergriffen hatte. Mit dieser Erzählung pflegten die älteren Novizen den Neuankömmlingen die nötige Ehrfurcht vor der Macht und Heiligkeit des ehrwürdigen Klosters einzuflößen – natürlich glaubte spätestens im zweiten Novizenjahr niemand mehr daran.
Hätte also einer dieser Novizen in diesem Augenblick Darons Studierzimmer betreten, wäre ihm zunächst die absolute Stille aufgefallen: Darons Feder kratzte nicht, wie sonst, wenn er an seinem Schreibtisch saß, über das Papier; man hörte nicht kein Murmeln, ja nicht einmal einen Atemzug. Daron saß völlig still, wie versteinert, und wenn der Novize an Daron herangetreten und ihn leicht mit einer Hand berührt hätte, hätte er die unheimliche Hitze gespürt, die von dem Hochmagier ausging, so als ob er unter hohem Fieber litte. Hätte er Darons Gesicht betrachtet, wäre er vor Schreck zurückgeprallt: weiße Augäpfel starrten aus den schlaffen, leeren Zügen Darons ins Nichts hinein, während ihm eiskalte Schweißtropfen über das Gesicht liefen. Der Mund stand leicht offen, und ein dünner, silbriger Speichelfaden hing von Unterlippe herab. Alles an Daron verharrte in absoluter Reglosigkeit – nun ja, fast alles. Unter dem Gewand, das seine Brust umspannte, schien sich etwas zu bewegen. Nicht, wie sich die Brust eines atmenden Mannes hob und senkte, sondern als würde sich darunter eine Schlange winden – oder eine fette, träge Ratte. Eine leichte, grauenhafte Bewegung, die jeden der Novizen in die Flucht geschlagen hätte.
Doch es betrat kein Novize das Arbeitszimmer, und so musste Daron, ob er wollte er nicht, mitansehen, was Krushak ihm zu sehen gab. Hätte Daron in diesem Augenblick aus freien Stücken handeln können, hätte er seinen Blick vielleicht gar nicht abgewandt.
Krushak war wütend gewesen, dass die Frau, die in sein Kloster, seinen inneren Kreis, eingedrungen war, von dem Alten etwas erfahren hatte, dass er selbst nicht sehen konnte. Oh, er hatte natürlich gewusst, dass die Frau kommen würde, er hatte vorhergesehen, dass das alte Schwein, das er in diese Zelle hatte sperren lassen, der Frau etwas sagen wollte, das für ihn, Krushak, von irgendeinem – zwar unbestimmten, aber dennoch bedeutsamen – Gewicht war, und er hatte damit gerechnet, dass sich ihm dies offenbare würde, wenn der dumme Alte es ausplauderte, aber er hatte zwar gesehen, wie sich die Münder in den albernen Gesichtern der Menschenwesen bewegten, er hatte ihre dummen, nichtigen Laute vernommen, aber er konnte ihre Bedeutung nicht erfassen, so als ob sie in einer fremden Sprache miteinander gesprochen hätten, die er nicht verstand. So etwas durfte nicht sein, Krushak hatte bisher jedes der niederen Worte verstehen können, dass die kurzlebigen Menschen von Anbeginn der Schöpfung gesprochen hatten! Krushak war so wütend, dass er den unwiderstehlichen Drang verspürte, etwas zu zerstören. Am liebsten hätte er das schäbige Gefäß, in dem er steckte und das ihn noch notdürftig tragen konnte, in Abermillionen kleiner, blutiger Fetzen gerissen, aber das hätte seine Pläne zunichte gemacht. Er brauchte Darons Körper noch eine Weile, zumindest noch für ein paar Tage, bis er endlich alle Fäden zusammengeführt hatte. Er brauchte das neue Gefäß, das ihn eine ganze Zeit lang würde beherbergen können – einen dummen Jungen, den er für diese ehrenhafte Aufgabe ausersehen hatte, als sich damals die Sonne verdunkelt hatte. Er hatte schon von vielen Lebewesen Besitz ergriffen, seit er auf Erden wandelte – und das war selbst für einen Dämon eine einigermaßen lange Zeitspanne: von niederem Getier, das sofort zerfiel, wenn sein Geist es nur streifte, von den Menschen des Alten Volkes, die ein wenig haltbarer waren, von den gewaltigen Orks, die ihn immerhin eine Weile tragen konnten, weil sie aus zäherem Fleisch gefertigt schienen und eine größere Leere in ihrem Inneren hatten; er hatte in Sklaven und Königen gesteckt, in Huren und in Magiern, von denen sich Daron zwar als die widerspenstigste, aber immerhin robusteste Hülle erwiesen hatte, die zudem über Kräfte verfügte, die Krushak nützlich und angenehm waren… aber das Gefäß, auf das er wartete, war bei Weitem das Beste. Dieser junge Mensch hatte, als Krushak ihn berührt hatte, eine so große und heulende Leere in seinem Inneren mit sich herumgetragen, dass er wie dafür geschaffen schien, einen mächtigen Dämon als Herrn in sich aufzunehmen. Er würde lange durchhalten, lange genug auf jeden Fall. Und er war leicht zu führen. Als Krushak für den kurzen Moment der Sonnenfinsternis in ihn hineingefahren war, hatte ein winziger Funken gereicht, den Jungen in lodernde, tödliche Wut zu versetzen. Er erinnerte sich mit Genuss an die Leichtigkeit, mit der er die Hände des Jungen an die Kehle des dummen, bleichen Menschenwesens hatte führen können, das den Jungen begleitet hatte. Der Junge hatte keinerlei Widerstand geleistet, und obwohl Krushak nicht auf die Empfindungen seiner Gefäße zu achten pflegte, hatte er wahrgenommen, wie eine Welle nachtschwarzer Erregung den Jungen durchflutet hatte, als er seinen Freund erwürgte – vielleicht waren sie wirklich füreinander geschaffen.
Der Junge war danach aus den Augen der empörten und entsetzen Bürger der Hafenstadt verschwunden, aber niemals aus Krushaks Augen. Er hatte ihn all die Jahre beobachtet und nun, da seine Zeit bevorstand, zu sich zurückgerufen. Selbstverständlich war der Junge, nun ein Mann, dem Ruf gefolgt – die Erinnerung war wohl süß genug für ihn. Zumindest was sein neues Gefäß betraf, musste sich Krushak keine Sorgen machen.
Worauf der dumme Alte jedoch einen gewissen Einfluss haben konnte, war der zweite Mensch, den Krushak für seine Verschmelzung mit seiner Hülle benötigte – es konnte kein gelungenes Ritual ohne Blutopfer geben! Dieses Opfer hatte er sich, mit Hilfe des Alten, ebenfalls sorgsam ausgewählt und gezeichnet. Es war alles so leicht gewesen! Dem Alten, damals noch ein Mann in den mittleren Jahren, hatte es sogar gefallen, und nun… nun schien er Krushaks sorgsam zurechtgelegten Plan durchkreuzen zu wollen. Dafür würde er büßen müssen… zu gegebener Zeit. Er spielte keine Rolle mehr in Krushaks Plänen – sein qualvoller Tod würde nicht Pflicht, sondern nur noch Kür sein -, aber die Frau könnte wichtig sein. In ihren Adern floss dasselbe Blut wie das seines Opferlamms, und nun wusste sie irgendetwas, das Krushak nicht wusste. Diese Erkenntnis machte ihn rasend, so rasend, dass er am liebsten…
Krushak zwang sich zur Ruhe. Nur wenn er ruhig war, konnte er sehen.
Was er sah, schien für menschliche Augen von gewissem Interesse zu sein, das konnte er im Bewusstsein seines Wirtes spüren. Eine nackte junge Frau schwamm in einem klaren Gewässer, zwischen den Seerosen und kleinen Insekten, die auf der sonnenbeschienenen Oberfläche des Wassers ihre Kreise zogen, ohne zu wissen, dass sie bald, sehr bald, tot sein würden. So tot wie ganz Khorinis.
Krushak würde sich in seine Meditation versenken und der Frau folgen. Sie würde ihn, ohne es zu wissen, zu dem kleinen, schmutzigen Geheimnis führen, das der Alte ihr verraten hatte. Er musste nichts tun als abwarten – und beobachten.
Zwischenspiel: Das sichere Ende
Hanna saß an ihrem Schreibtisch. Ihre Finger trommelte auf die glänzend polierte Platte. Sie stand auf, ging zum Fenster und sah hinaus. Draußen waren die letzten Vorbereitungen für das Feuerblütenfest im Gange. In der drückend heißen Windstille hing die prächtige Festbeflaggung schlaff von den Hauswänden und Fahnenmasten hinab. Unzählige Blumengirlanden welkten an den Toren der Stadt süßlich duftend ihrer Verwesung entgegen. Die silbernen Glöckchen am Adanostempel schlugen nur wenige, verträumte Töne an, dafür sangen die Zikaden in den Blumenranken umso lauter.
Hannas Blick fiel auf den kleinen Strauß Blumen auf ihrem Schreibtisch. Cassia hatte ihn ihr geschenkt. Es schien bereits eine Ewigkeit her zu sein, dass sie beide in diesem Zimmer gesessen hatten, obwohl das nicht sein konnte – die Frische der Blumen strafte dieses Gefühl Lügen. Vor Hannas Fenster zogen einige voll beladene Wagen vorbei, und ihr Haus summte vor Betriebsamkeit: Zu keiner anderen Zeit im Jahr beherbergte sie so viele Gäste. Nur gut, dass sie so viele Helfer zur Hand hatte, denn sie war kaum fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Voller Sorge sah sie nach draußen, als würde Cassia jeden Moment vor ihrem Fenster auftauchen und ihr fröhlich zuwinken, um sie endlich aus diesem Alptraum zu erlösen.
Cassia hatte sich Zutritt zum Kloster verschafft, und sie, da sie ihrer Freundin eher hinderlich als nützlich gewesen wäre, war nach Khorinis zurückgekehrt, um die letzten, dringlichen Vorbereitungen für das Fest zu treffen – so als wäre das Fest noch von irgendeiner Bedeutung, wenn auch nur ein Körnchen Wahrheit in ihren Befürchtungen lag. Aber es beruhigte sie, etwas zu tun. War es nicht erstaunlich, dass die Menschen sogar dann noch ihr sicheres Ende zu verleugnen versuchten, wenn sie ihm bereits in Auge geblickt hatten?
Hanna setzte sich wieder an ihren Schreibtisch, und ihre Finger begannen wieder dieselbe Melodie zu trommeln. Ihr blieb nichts als warten.
Sie dachte an die kleine Insel vor Khorinis, die die Diebesbande seit einigen Jahren als Unterschlupf in unruhigen Zeiten nutzte. Konnte man sich vor dem sicheren Ende verstecken wie eine Maus in ihrem Loch? War es möglich, dem Untergang zu entgehen, wenn man nur einfach fest genug die Augen zusammenkniff? Wenn man den Kopf nur tief genug in den feinen, weichen Sand des Nichtwissens hineinbohrte und ihn erst wieder herauszog, wenn alles vorbei war? Konnte der Tod – oder ein Dämon - einen sehen, wenn man ihn nicht sah?
Hanna schloss die Augen und dachte nach.
Kapitel 6: Die Geister des Strandes
Cassia blickte über den Strand und den schmalen, gewundenen Strang aus Seetang und Treibholz, der den feinen, weißen Sand gegen die endlose Flut begrenzte. Das Meer lag ruhig da wie ein gewaltiges schlafendes Tier. Winzige schmutziggraue Schaumkronen trieben träge wie Daunenfedern auf seinem Rücken. Cassia konnte das Salz in der Luft riechen, scharf und klar. Der Strand schwieg und verriet nichts. Kein Mensch war zu sehen. Auf der steilen Klippe über ihr ragte stumm der Leuchtturm von Khorinis in den weißen Himmel.
Obwohl es immer noch drückend heiß war, zog Cassia den schmutzigen Lumpen, den sie im Gebüsch nahe des Klosters gefunden und übergestreift hatte, fester um ihren Körper. Sie musste an die Sonnenfinsternis vor vielen Jahren denken und an ihre Schwester Jenna, die hier, an diesem Strand, gewesen war, bevor sie ohne eine Erklärung verschwunden war. Konnte es sein, dass Jennas Füße denselben Boden berührt hatten, auf dem nun Cassia stand, oder hatte das Meer über die Jahre all die unzähligen Sandkörner fortgetragen und neue herangespült, die aus den fernen Küsten und fremden Gestaden mit sich gebracht hatte? Vielleicht gab es an diesem Strand kein einziges Körnchen mehr, das Zeuge der Sonnenfinsternis gewesen war.
Cassias Blick fiel auf den von Salz und Wind verwitterten Schrein, der in einer Felsennische am Strand erreicht worden war. Die Miene des Großen Gottes blieb unergründlich. Seine Augen unter dem goldenen Helm blickten starr durch Cassia hindurch, als existiere sie gar nicht, als stünde sie nicht vor ihm, mit wirrem Haar und geröteten Augen, nur in diesen erbärmlich schmutzigen Fetzen gehüllt, als benötigten sie und ganz Khorinis nicht dringend seine Hilfe. Ein Strauß verwelkender Blumen lag vor der Statue aus rauem Granit, zusammengehalten von einem gelben Seidenband, auf das ein Gläubiger Mein Gott ist stark geschrieben hatte, außerdem noch ein harter Laib Brot und zwei in der Hitze weich und braun gewordene Äpfel.
Hier irgendwo musste es sein – wenn Ezechiel ihr die Wahrheit gesagt hatte. Cassia kam die Begegnung mit ihrem alten Onkel unwirklich vor, als befände sie sich in einem wirren, verstörenden Tagtraum von der Sorte, in dem man rannte, ohne von der Stelle zu kommen oder schrie, ohne dass ein Laut aus dem Munde drang. Dennoch folgte alles einer glasklaren, unbestreitbaren Logik – wenn man sich auf den Gedanken einließ, dass Cassia in der Nacht zuvor tatsächlich einem Dämon begegnet war, der ganz Khorinis vernichten wollte. Sie dachte an Jenna, an Attila, an Hanna.
Dann begann sie im Sand zu graben. Nichts.
Sie grub tiefer. Wieder nichts.
Cassia erhob sich, ging ein paar Schritte weiter und grub an einer anderen Stelle. Nichts.
Wut stieg in ihr auf. Natürlich fand sie nichts. Sie kannte die Fürsorge Innos‘ für seine Geschöpfe ja nur zu gut.
Cassia schlug mit der Faust gegen den Stein und schürfte sich dabei die Haut an den Fingerknöcheln auf.
Ein schöner Gott bist du! Wahrscheinlich bist du an dem Tag gestorben, als sich die Sonne verd
Weiter kam sie nicht. Ein Bild stieg in ihr auf, so klar und deutlich und grandios, dass es ihr den Atem verschlug. Sie fiel rücklings in den Sand vor dem Schrein, aber sie nahm es gar nicht wahr, denn das einzige, was es auf dieser Welt für Cassia noch gab, war dieses Bild, das Bild eines Nachmittags, der gelb und orange und fiebrig von Flammen war. Feuer tanzte am östlichen Bogen des Horizonts, und dann erhob sich dort, langsam und majestätisch, ein brennender Ball, so gewaltig, dass er den ganzen Horizont erfüllte, eine schreckliche, tödliche Sonne, deren Feuer Gerechte und Ungerechte gleichermaßen verzehrte. Dann erlosch das Bild.
Cassia schnappte nach Luft. Sie zitterte, und vor ihren Augen waberten blassrote Schemen. Als sie wieder klar sehen konnte, fiel ihr Blick auf ihre Hände. Sand überzog sie wie ein rauer Mantel, und einige Tropfen Blut sickerten aus ihren aufgeschürften Fingerknöcheln und zeichneten schmutzigrote Rinnsale auf ihre Handrücken. Ihre linke Hand hielt etwas umfasst, einen ebenso mit Sand und Schmutz bedeckten kleinen Gegenstand, der für seine geringe Größe erstaunlich schwer war. Sie versuchte, den Sand von dem Ding abzureiben. Ein kleines Gesicht kam zu Vorschein, ein ruhiges, besonnenes kristallenes Gesicht unter einem Kristallhelm, das voll stiller Heiterkeit zu ihr hinaufblickte. Cassia lief über den Strand zum Meer und spülte die kleine Figur in dem klaren Wasser ab. Das Salz brannte in den Schürfwunden, aber sie nahm es kaum wahr.
Als sie die Statue aus dem Wasser hob, funkelte sie wie ein Diamant. Unerklärliche Freude und Hoffnung überfluteten Cassia, und für einen winzigen Moment gestattete sie sich, diesen Empfindungen nachzugeben, bevor sie sie ärgerlich wegwischte.
Das Feuer!
Nun, sie hatte die Figur gefunden, von der Ezechiel ihr erzählt hatte, aber die Jahre, die Feuchtigkeit des Sandes oder das Salz hatten die Statue so glatt geschliffen, dass nur noch das kleine Gesicht zu erkennen war. Keine Botschaft, keine geheimen Zeichen waren zu erkennen. Die Oberfläche des Gottes strahlte in makelloser Glätte.
Es war alles umsonst gewesen.
Aber das Feuer!
Es ist alles eitel, dachte sie wieder. Sie würde Jenna niemals finden, sie würde ihr keine Nachricht zukommen lassen können, sie würde nicht das Geringste unternehmen können, um zu verhindern, dass…
Ein Geräusch riss sie aus ihren Gedanken.
Cassia fuhr herum.
Eine Gestalt hatte sich hinter ihr wie aus dem Nichts erhoben, eine Gestalt in der roten Robe eines Feuermagiers. Erst auf den zweiten Blick erkannte Cassia, dass es Daron war, der vor ihr stand. Im ersten Moment musste sie an einen Handschuh denken, in den eine viel zu große Hand hineingefahren war – eine Hand, oder eine Klaue. Daron sah schrecklich missgebildet aus, mit einem grotesk geschwollenen Brustkorb. Sein Kopf hing schief auf seinem Hals, und als er einen Schritt auf sie zuging, bewegte er sich steif und ungelenk wie eine Marionette, die ein grober und ungeschickter Puppenspieler führte. Seine weit aufgerissenen Augen ließen Cassia die Qualen erahnen, die der Hochmagier litt. Hinter ihm stand eine weitere Gestalt, halb verborgen im Schatten der Klippen, doch Cassia nahm sie kaum wahr.
„Cassia“, sagte Daron, und obwohl sich seine Lippen dabei bewegten, kam seine Stimme nicht aus seinem Mund.
Tiefer
„Cassia“, wiederholte die Stimme aus Darons Brust, und ein dünnes Rinnsal Blut tropfte aus seiner Nase. „Wir haben uns schnell wiedergefunden. Und jetzt gib mir, was du da in der Hand hast.“
„Wieso? Was nützt es dir noch?
Das Wesen in der Feuerrobe zögerte einen Moment, als hätte Cassia es mit dieser Frage überrascht. „Das spielt für dich keine Rolle mehr, Cassia. Gib es mir, und ich lasse dich gehen.“ Daron machte eine Bewegung in der Luft, die den Flügelschlag eines Vogels andeuten sollten, und sicher bezaubernd ausgesehen hätte, wenn Darons noch Hände anstelle von Haken gehabt hätte.
„Und wenn ich nicht will?“, hörte Cassia ihre eigene dünne Stimme sagen.
Das Daron-Ding lachte, aber Cassia spürte die Wut in seinem Lachen.
Er weiß selbst nicht, was er tun soll, dachte sie erstaunt, und dann dachte sie wieder an das Feuer.
„Dann werde ich mich darum kümmern, dass du endlich Benimm lernst“, sagte eine Stimme hinter Daron.
Aus dem Schatten der Felsen trat die zweite Gestalt ans Licht.
Cassias Herz schien einen Moment lang auszusetzen. Entsetzen griff mit kalter Hand nach ihren Eingeweiden. Ihr wurde übel.
Die Gestalt verzog den Mund zu etwas, das man für ein Lächeln halten konnte, wenn man nicht allzu genau hinsah. „Freust du dich nicht, mich wiederzusehen?“
Daron wies mit seinem rechten Haken auf die Gestalt im Ornat einer Barmherzigen Schwester Innos‘ und sagte förmlich: „Hochwürdige Mutter Äbtissin, erinnert Ihr Euch an die kleine Cassia? Ist es nicht erstaunlich, wie schnell die kleinen Dinger groß werden?“
Mutter Ignatia nickte und ließ ihren Blick auf Cassia ruhen. Cassia bemerkte, dass Ignatia ihren Rohrstock in der Hand hielt. Die Augen der Äbtissin bohrten sich in Cassias Seele und schienen Löcher hineinzubrennen.
„Sie ist immer noch das gleiche ungezogene Ding wie vor zehn Jahren. Die Menschen ändern sich nicht so leicht, auch wenn so viel Liebe in sie hineinsteckt!“
Sie ließ den Rohrstock in ihren Händen tanzen.
Cassia war wie gelähmt. Sie brachte keinen Laut hervor, obwohl sie schreien wollte, und obwohl ihre Beine rennen wollten, kam sie nicht von der Stelle.
Das Feuer!, war der einzige Gedanke, den sie fassen konnte. Das Feuer!
Der Rohrstock traf Cassia an der Schläfe, ohne dass sie ihn überhaupt kommen sah. Sie spürte, wie sich der Griff ihrer Hand um die kleine Figur aus Bergkristall löste, wie sie ihr entglitt und in den weichen, feinen Sand fiel, und dann spürte sie nur noch gnädige Dunkelheit.
-
Kapitel 7: Schwester Ratte
Die Ratte saß auf den groben Steinfließen der Zelle und sah ihn aufmerksam an. Sie war ein großes, schlankes Tier mit kohleschwarzen Augen. Ihr rosa Schwanz war fein säuberlich um ihren grauen Leib geringelt. Hin und wieder erzitterten ihre Barthaare leicht, als hätte sie eine verführerische Witterung aufgenommen.
Ezechiel starrte zurück.
Er hatte weder Cassias Behändigkeit noch ihre Geistesgegenwart besessen, als sein Wärter mit einem kärglichen Frühstück – eine Hand voll getrockneter Datteln, ein Becher saurer Ziegenmilch – seine Zelle betrat. Während sie geräuschlos und vermutlich unbemerkt aus seinem Gefängnis verschwunden war, hatte er nicht einmal versucht, sich durch die enge Öffnung des Fensters zu schieben. Die Zeit hatte gerade gereicht, dem widerspenstigen Türschloss sei Dank, das Fenstergitter, das Cassia herausgestemmt hatte, lose in die Luke zu schieben – man konnte ja nie wissen! - und zu hoffen, dass dem Novizen, der zu seiner Bewachung und Bewirtung abgestellt war, die Risse im Putz nicht auffielen. Offenbar war das auch nicht der Fall gewesen – Ezechiel kamen Novizen im Allgemeinen, und dieser hier im Besonderen, nicht gerade schlau vor. Er hatte die Schüssel mit den Datteln und den hölzernen Becher wortlos auf den Boden seiner Zelle gestellt, die Tür wieder von außen verriegelt, und Ezechiel war wieder alleine zurückgeblieben. Ob Cassia sich tatschlich auf die Suche nach der Innosfigur machen würde? War sie überhaupt hier gewesen oder war ihr Besuch nur seiner Vorstellungskraft entsprungen, war es ein Spuk gewesen, oder, noch schlimmer, ein Trick der Stimme? Ihm war heiß, ängstlich und zum Weinen zumute.
Irgendwann, während er auf seiner Liege saß und aß, war aus der schattigen Nische der gegenüberliegenden Wand die Ratte aufgetaucht. Sie hatte sich einfach hingesetzt und angefangen, ihn zu betrachten. Ezechiel hatte einen Dattelkern nach ihr geworfen, aber sie knapp verfehlt. Die Ratte hatte das jämmerliche Geschoss nicht einmal beachtet, sondern ihn weiter angesehen. Du plötzlich schien es Ezechiel, als würden sich ihre Lefzen zu einem Lächeln verziehen.
In diesem Moment hörte er wieder, dass sich jemand von außen an der Tür zu schaffen machte, und wenige Augenblicke später trat der Novize wieder ein. Diesmal hatte er kein Frühstück bei sich, sondern ein langes Messer.
Ezechiel verspürte den Drang, eine Sturzflut stammelnder, flehender Worte hervorzustoßen, aber er wusste, dass das nichts nützen würde. Plötzlich erschien ihm alles sehr klar, sehr farbig, sehr langsam. Er konnte hören, wie sich seine Augen in den feuchten Höhlen hin und her bewegten – vom ausdruckslosen Gesicht des Novizen hin zu seinem Messer und wieder zurück.
„Die hochehrwürdige Mutter Ignatia erkundigt sich, wie es dir geht“, sagte der Novize.
„Wie immer“, sagte Ezechiel und war erstaunt darüber, wie gelassen seine Stimme klang. „Sagt sie auch, wann ich hier wieder rauskomme?“
„Bald“, antwortete der Novize. Er hielt sein Messer auf halber Höhe, nicht direkt auf Ezechiel gerichtet, aber auch nicht ganz weg von ihm.
„Ich habe gerade meine Anweisungen von der ehrwürdigen Mutter erhalten. Keine großartigen Anweisungen, aber ich denke, du wirst es durchstehen, alter Mann.“
Ezechiel hörte die Stimme des Novizen wie durch Watte. Er sah nach rechts, wo im Schatten der Nische immer noch die Ratte saß, ihn ansah und lächelte – nein, jetzt grinste sie von einem Rattenohr zum anderen.
„Was für Anweisungen?“, hörte er sich selbst fragen.
Der Novize hob das Messer etwas höher. „Nun, sie hat mir befohlen, dass…“
„Bei Innos!“. Ezechiels Blick zuckte wieder zu der Ratte. „Eine Ratte! Was ist denn das für ein Scheißladen, wenn ihr hier Ratten habt?“
Es war kaum zu glauben, aber der Novize war tatsächlich so dumm, wie Ezechiel Novizen der Heiligen Flamme stets eingeschätzt hatte. Er drehte sich zu der Ratte um, und Ezechiel war so überrascht vom Erfolg seiner List, dass er beinahe nicht weitergemacht hätte. Zum Glück machte die Ratte weiter. In einer so schnellen Bewegung, dass man sie kaum mit den Augen verfolgen konnte, sprang sie dem Novizen mit einem gewaltigen Satz ins Gesicht und verbiss sich darin. Der Novize schrie auf und schlug blindlings nach der Ratte, und das holte Ezechiel aus seiner Verblüffung. Er riss das eiserne Fenstergitter aus der Öffnung und schlug es mit aller Kraft seitlich gegen den Kopf des Novizen. Ein feuchtes Knacken war zu hören, dann sank der Novize zu Boden.
Ezechiel ließ das Fenstergitter sinken. Einen Augenblick später kam ihm ein alptraumhafter Gedanke: Wenn die Anweisungen der vertrockneten Betschwester Ignatia nun gelautet hatten, ihn freizulassen? Aber das wäre unsinnig, oder? Wozu hatte der Novize dann ein Messer bei sich? Und warum hätte er von „keinen großartigen Anweisungen“ sprechen sollen? Nein – der Novize war geschickt worden, um ihm an Ort und Stelle die Kehle durchzuschneiden. Ezechiel betrachtete zitternd die am Boden liegende Gestalt. Wenn der Novize jetzt noch einmal aufstand, würde Ezechiel nicht die Kraft haben, das Gitter noch einmal zu erheben. Aber der Novize würde nicht mehr aufstehen. Jetzt nicht; überhaupt nicht mehr. Sein Schädel war schrecklich verformt, und seine Gesichtszüge dadurch aus den Fugen geraten, aber Ezechiel konnte das Entsetzen im Gesicht des Novizen immer noch deutlich erkennen. Die Ratte hatte von ihrem Opfer abgelassen und sich wieder auf den Boden gesetzt. Winzige Blutströpfchen schimmerten in ihren Barthaaren.
Plötzlich wurde der Wunsch, hier wegzukommen, weit, weit weg von Daron und der Stimme, so übermächtig, dass Ezechiel beinahe blind aus der Zelle gestolpert wäre. Aber er musste vorsichtig sein. Bisher hatte er gedacht, Daron würde ihn über kurz oder lang beseitigen lassen – kein loses Fädchen mehr in seinem Gewebe -, aber was hatte Mutter Ignatia mit der Sache zu tun? Soweit Ezechiel wusste, leitete sie die Anstalt für Mädchen im Nordflügel des Klosters. Was um Innos‘ Willen hatte sie mit ihm, Ezechiel, zu schaffen? Er war ihr überhaupt nur ein einziges Mal begegnet, und dieses eine Mal war höchst unerfreulich gewesen, aber welchen Grund konnte sie haben, einen Novizen mit einem Messer auszustatten und zu ihm zu schicken?
Schwer atmend setzte er sich auf die Kante seines Bettes.
Die Ratte sah ihn an, ihr Blick war nun nicht mehr ruhig und gelassen, sondern auffordernd. Sie erhob sich in einer fließenden Bewegung und wandte sich der Tür zu, die nur angelehnt – unverschlossen! war.
„Wohin, Schwester Ratte?“, fragte Ezechiel leise, und wieder schien die Ratte zu grinsen. Sie huschte durch den Türspalt.
Ezechiel hörte das leise Geräusch seiner eigenen nackten Füße auf dem Steinboden, noch bevor er sich überhaupt bewusste wurde, dass er sich in Bewegung gesetzt hatte. Hinter der Tür befand sich ein weitläufiger, menschenleerer Korridor. Der kalte Finger des Grauens strich ihm über den Ansatz der Wirbelsäule, trommelte eine schnelle, hektische Melodie und riet ihm, von hier zu verschwinden, und zwar schnell, bevor jemand dazwischenkam, zum Beispiel die hochehrwürdige Mutter Ignatia. Der Korridor kam ihm plötzlich kleiner vor und schien sich immer enger zusammenzuziehen, bis er auf die Größe seiner Gefängniszelle geschrumpft war. Am anderen Ende des Korridors befand sich eine weitere Tür. Die Ratte schlüpfte hindurch, und Ezechiel folgte ihr. Hinter der Tür lag ein weiterer, vom gedämpften Licht zweier Öllampen erhellter Gang, der auf eine Treppe zulief. Auf halbem Weg zur Treppe stand ein leerer Servierwagen. Als Ezechiel den Wagen erreicht hatte, drehte er sich um und sah zurück, weil die Stille ihn misstrauisch machte. Sie rechnete damit, in das verunstaltete Gesicht des Novizen zu sehen, der hinter ihm herschlich, um seine letzten Anweisungen auszuführen, doch der Gang war leer und verlassen. Das Echo seiner Schritte im halbdunklen Korridor weckte Gedanken an unangenehme Gesellschaft.
Er kam an einem Bild vorüber, das einen geringschätzig auf den Betrachter blickenden Hochmagier zeigte. Das Porträt hing ein wenig schief. Ezechiel verspürte den übermächtigen Drang, es gerade zu rücken. Das Bild so nach rechts geneigt zu sehen weckte in ihm leichte Übelkeit. Auf der schützenden Verglasung des Gemäldes lag Staub. Er fuhr mit den Fingern über das Glas und hinterließ zwei schmale, parallel verlaufende Spuren. Der Staub fühlte sich glatt und ölig an. Würde er das Bild von der Wand nehmen, könnte er auf der Wand dahinter einen hellen Fleck sehen. Oder Würmer, die sich darunter hervorwinden, als hätte ich einen Felsbrocken weggewälzt, dachte er.
Die Ratte gab ein leises pfeifendes Geräusch von sich, das in Ezechiels Ohren ungeduldig klang. Er folgte ihr so schnell er konnte zur Treppe am Ende des Gangs, begleitet von der lebhaften Vorstellung, wie blindes, weißes Gewürm aus der Tapete hervorquoll und sich auf den Steinboden ergoss.
Über die Treppe gelangten Ezechiel und die Ratte in einen weiteren Korridor. Schwere Türen mit Ornamentglasscheiben säumten den Weg und erzählten ihre eigene Geschichte. ABSCHRIFTEN. RUNENKAMMER. BIBLIOTHEK.
Linker Hand teilte sich ein weiterer Gang vom Hauptkorridor ab. Ezechiel verlor langsam die Übersicht. Das Kloster war viel größer, als er sich vorgestellt hatte. Er sah sich nach seiner Führerin um, doch die Ratte war nicht mehr da. Er bekam es mit der Angst zu tun. Es war nicht das betäubende Entsetzen, das er angesichts des Novizen mit dem tödlichen Messer empfunden hatte, sondern eine wilde, lebendige Angst, sich in den weitläufigen Gängen des Klosters zu verirren, wo seine Schritte hallten und ein dumpfes Echo erzeugten. Vielleicht hatte er sich bereits verirrt. Und die Ratte schien auch verschwunden zu sein. Das war schlimm.
„Ich habe mich nicht verirrt“, sagte er, und seine Worte hallten fremd und tonlos wider. Ezechiel wünschte sich, sie nicht laut ausgesprochen zu haben, denn das machte alles noch schlimmer. Er sah sich noch einmal nach seiner neuen Freundin, der Ratte um, aber sie war wie vom Erdboden verschluckt. Also ging er weiter geradeaus, ließ den Gang zur Linken hinter sich und ging an weiteren Türen vorbei. Immer öfter sah er sich um und vergewisserte sich, dass ihm niemand folgte. Schließlich bog der Korridor nach rechts ab und endete an einer Tür mit der Aufschrift SCHRIFTGUTKATALOGE. Sie war verschlossen. Ezechiel ging zurück und spähte um die Ecke in die Richtung, aus der er gekommen war. Dann betrat er den Gang, der vom Hauptkorridor abzweigte. Das Echo seiner Schritte verfolgte ihn, und in ihm wurde die entsetzliche Gewissheit übermächtig, dass es überhaupt keinen Ausgang gab, jedenfalls nicht auf dieser Ebene des Klosters. Er begann zu laufen und spürte, dass sein Haar im Nacken schweißnass war. Keuchend bog er um eine Ecke und sah, dass auch dieser Gang eine Sackgasse war. Er endete an einer Tür, die einen Spalt weit offenstand. Vor dieser Tür saß die Ratte und sah ihn erwartungsvoll an.
Er näherte sich der Tür und stieß mit der flachen Hand dagegen. Die Tür schwang geräuschlos auf und gab den Blick auf ein großes Zimmer frei, das von einem gewaltigen Schreibtisch beherrscht wurde. Auf dem Tisch lagen Dokumente und Schriftrollen wild durcheinander, eine Schreibfeder steckte noch in einem Tintenfass. Sie war an einer merkwürdigen Vorrichtung befestigt, so als ob sie an die Hand des Schreibenden festgeklemmt werden sollte – an seine Hand, oder an seinen Haken.
Es war Darons Schreibzimmer.
Die Ratte war auf den mit rotem Samt bespannten Hocker gesprungen, der vor dem riesigen Schreibtisch stand, und von dort aus auf dem Tisch selbst.
„Was soll ich hier?“, fragte Ezechiel, während er ratlos auf das Durcheinander der Unterlagen blickte. Die Ratte wandte ihren glänzenden grauen Kopf zu dem Eichenholzschrank, der in einer Ecke des Zimmers stand. Darin befanden sich mehrere tiefrote und violette Prachtroben des Hochmagiers. Ezechiel berührte den schweren Stoff zögernd. Wenn die Ratte das von ihm erwartete, würde er es tun. Sie schien zu wissen, was richtig war. Dann nahm er eines der Gewänder vom Haken und streifte es über. Er sah die Ratte fragend an und erwartete ihre Befehle.
Kapitel 8: Erlösung
Der Innenraum der Kathedrale war gewaltig und fast leer. Das Licht, das durch die farbigen Bleiglasfenster fiel, tauchte das Mittelschiff in mildes Zwielicht. Daron hatte es immer geliebt, still unter dem mächtigen Kreuzgradgewölbe zu sitzen und die kunstvoll gestalteten Szenen zu betrachten, die von der Erschaffung der Welt erzählten. Sie zeigten, wie Innos das Licht erschuf und wie der vom grellen Antlitz der Sonne gequälte Beliar sich gegen seinen Bruder stellte. Man konnte Adanos erkennen, der ihren Streit zu schlichten versuchte, indem er einen Ort entstehen ließ, an dem Ordnung und Chaos zugleich existierten und keiner der streitbaren Brüder Macht über den anderen hatte: das Meer. Das Meer gab das Land frei und die Welt entstand zusammen mit all ihren Wesen und Pflanzen, und zuletzt entstand der Mensch.
Heute aber war sich Daron sicher, dass der Künstler, der diese Bilder geschaffen hatte, ein bedeutsames Ereignis vergessen hatte; ein Ereignis in dieser noch jungen Welt, das nun alles Leben bedrohte, das Adanos geschaffen hatte.
Der Dämon, der sich in seinem Körper eingenistet hatte und nun von ihm zehrte, hatte ihm ein ähnlich wundersames Bild offenbart, das keine der unzähligen Kathedralen Innos‘ auf der ganzen Welt zeigte: Es war eine sternenklare Nacht, eine der ersten, die die junge Welt gesehen hatte. Tausende von kleinen Lichtpunkten überzogen den dunklen Himmel, wie achtlos auf schwarzen Samt gestreute Brillanten, und zeigten die Bilder künftiger Helden und Schlachten. Von Norden blies ein kühler Wind über das Gebirge und im fahlen Silberschein des Mondlichtes wogten die Äste wie die Wellen eines Meeres, das Rauschen der Blätter erfüllte die Luft wie Flügelschläge unzähliger, unsichtbarer Geschöpfe.
Es war das einzige Geräusch, denn eine gespannte Stille lag über dem Wald. Unterhalb der mächtigen Baumkronen waren noch immer die nächtlichen Jäger auf der Pirsch. Raubechsen strichen durch die Dunkelheit, um dem Wild aufzulauern, das unvorsichtig in das Revier der mächtigen Jäger eingedrungen war.
Der Morgen war nicht mehr fern und im Osten verblassten die ersten Sterne. In die Geräusche der Nacht mischte sich das Zwitschern der ersten Vögel. Mit sanften Fingern berührte das junge rosige Licht den Himmel. Das Samtschwarz verblasste zu dunkelblauer Wasserfarbe. Ein neuer Tag brach an, und das tiefe Dunkelviolett des Himmels über dem Wald verwandelte sich in Blau. Das milde Licht des Morgens ließ die Luft wie aus Seide erscheinen. Der Wind trug unzählige Düfte mit sich, Orchideen, Jasmin, Flammenbeeren.
Es wurde heiß, und ein rauchiger Bodennebel lag in den Tälern der neu geborenen Insel. Eine gelbe Raupe kroch über ein großes grünes Blatt und warf einen Schatten hinter sich. Ein Geschöpf mit zähen, häutigen Flügeln stieß aus den Baumkronen hinab, packte die Raupe mit seinem hornigen Schnabel und schoss über dem Wasser dahin, das sich in einem schmalen Bett schäumend und strudelnd durch die Wildnis dieser neuen Welt wälzte. Der Strom donnerte und brauste unter ihm dahin, als ein riesiger, rosasilbriger Fisch in unglaublich hohem Bogen aus dem Wasser schnellte, nach dem geflügelten Jäger schnappte und ihn in das glitzernde Wasser riss.
Vögel kreisten am Himmel und kreischten heiser, erst nur ein oder zwei Dutzend, dann immer mehr, schließlich so viele, dass dichte Vogelscharen die Sonne verdunkelten. Ein zartgliedriges Tier mit braunem kurzem Fell brach durch das Dickicht und floh nach Südosten.
Etwas würde geschehen.
Wieder raschelte es im Gebüsch, und weitere Tiere rannten und sprangen davon. Die Vogelschwärme flogen kreischend gen Süden. Dann trat Stille ein wie vor einem bösartigen Gewittersturm, wenn sich der Wind völlig legt und die Luft eine unheimliche, widernatürliche Farbe annimmt.
Die Sonne hing am Himmel wie eine geschmolzene Münze, ein brennender Kreis, umgeben von märchenhaft schillernden Ringen.
Etwas verdrängte die Stille.
Der Himmel wurde dunkler und nahm einen seltsamen Grünton an, und vom westlichen Horizont näherte sich rasch ein dunkles Gebilde, das ständig größer wurde.
Es war eine stetige, leichte Vibration, die eher zu fühlen als zu hören war und allmählich stärker wurde. Sie hatte keinen Klang. Es war nur ein seelenloses, tonloses Geräusch.
Auf den zartgrünen Blättern der üppigen Pflanzen erschienen helle und dunkle Streifen, dann wurde es noch dunkler und merklich kühler, Blüten schlossen sich, die Sonne verdunkelte sich und ihr Rand leuchtete zwischen den Mondbergen und -tälern hindurch wie Perlen auf einer Schnur.
Die Vibration wurde stärker und stärker und bekam eine Stimme – ein tiefes, rollendes Dröhnen, das zu einem zerschmetternden Crescendo anschwoll.
Dann flammte die Sonnenkorona auf, die den schwarzen Mond umhüllte, und gleichzeitig schienen die Wolken in rotem Feuer zu leuchten, das von oben auf sie hereinbrach. Etwas schoss mit unglaublicher Geschwindigkeit vom Himmel herab, der jungen Erde entgegen, etwas Glänzendes, Tiefschwarzes. Es kam Wind auf, ein heißer, sengender Wind. Als der schwarze Brocken den Boden berührte, folgte eine alles zermalmende Erschütterung, ein blendendes Feuer, und eine gewaltige Rauchwolke stieg aus dem gigantischen Krater hervor, der sich tief in den Felsen gegraben hatte. Der Wind trieb den Geruch des brennenden Waldes vor sich her und der Rauch verhüllte alles Grün und Rot und Grau des Tages.
Als der Mond weitergezogen war auf seiner ewigen Reise, schimmerte die Sonne durch den Rauch auf die Insel herab. Später würde es regnen, und der Krater würde sich mit dem Regenwasser füllen. Seerosen würden dort wachsen und was nun dort unten lag, würde eine Zeit lang schlafen. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: Der siebte Tag.
Auf dem Altar lag nun der entsetzlich schwarze Findling, den Daron vom Himmel hatte hinabstürzen sehen. Sogar im sanften Licht schimmerte er in einem tiefen Schwarz. Dunkelrote Spiralen tanzten auf seiner gläsernen Oberfläche. Der Felsbrocken war nicht groß, er reichte einem Mann vermutlich gerade bis zum Knie, aber er war so abscheulich anzusehen, dass Daron seinen Blick abwenden musste.
Die Sitzbänke waren achtlos an den Wänden der Kirche aufgetürmt worden, und die Prachtstatue Innos’ hatte man auf sein Geheiß hin mit zerlumpten Tüchern verhüllt.
[/i]Innos möge meiner Seele gnädig sein[/i], dachte Daron.
Auf dem Boden neben dem Altar lag die bewusstlose junge Frau, die die hochehrwürdige Mutter Ignatia, die Äbtissin der klostereigenen Erziehungsanstalt für Mädchen, mit ihrem Rohrstock niedergeschlagen hatte. Die kleine Innosfigur, die die bedauernswerte Frau mit bloßen Händen aus dem Sand gegraben hatte, lag in ein Tuch gehüllt auf den Stufen des Altars. In Darons Brust tobte ein triumphierendes Geheul. Der Dämon hatte, was er wollte.
Was willst du überhaupt damit? Was nützt dir dieses dumme Ding? dachte Daron, so laut er konnte, aber er drang nicht durch Krushaks Freudengeheul hindurch. Hätte er noch Macht über seine eigenen Haken gehabt, so hätte er, obwohl es eine schwere Sünde wäre, die kleine Kristallstatue auf dem Boden der Kathedrale zerschmettert. Aber er konnte nichts tun als zusehen.
Gerne hätte er auch die hochehrwürdige Mutter gefragt, wieso in Dreigötternamen sie dem Dämon zu Diensten war. Hatte er auch von ihr Besitz ergriffen? Daron konnte nicht glauben, dass irgendein Dämon – oder gar Beliar selbst - ein eisenhartes Weib wie Ignatia auch nur im Geringsten würde beeinflussen können. An Mutter Ignatia würde jede Art von schwarzer Magie abperlen wie Tautropfen von einer Lotusblüte. Und dennoch war sie bereitwillig mitgekommen, als Krushak Daron gezwungen hatte, sie um Hilfe in einer delikaten, den guten Ruf des Klosters betreffenden Angelegenheit zu bitten. Die hochehrwürdige Mutter schien, ebenso wie die anderen Mitglieder des Ordens, nichts von der Existenz des Dämons in Daron bemerkt zu haben, obwohl Daron das unglaublich erschien.
Aber nun standen sie da, der Hochmagier der Heiligen Flamme und die hochehrwürdige Mutter, und starrten auf die junge Frau, die zwischen ihnen am Boden lag. Sie hatten auf dem Weg zum Kloster kaum ein Wort miteinander gewechselt; Ignatia hatte keine Fragen gestellt, sondern war, den schlaffen Körper Cassias über der Schulter, verbissen schweigend den Weg hinaufgestapft. Zu gerne hätte Daron gewusst, was sie dachte, doch die Macht Krushaks war immer stärker geworden, und er hätte auch keine Fragen diesbezüglich stellen können, wenn er es versucht hätte.
Nun stand Daron vor dem Altar seines Herrn, seines früheren Herrn, und stand dort in dumpfem, tierischem Schmerz. Was er noch empfand, was aus dem toten Wasserarm seiner Seele hervorgeflattert kam, war groß und finster, wie ein schwarzes Segel oder ein gewaltiger, dunkel gefiederter Flügel. Es war nicht nur Angst. Nicht Entsetzen. Es war Grauen, alles Grauen der Welt, geronnen zu dieser schwarzen, flatternden Form. Es war, als stünde er am Rand einer Grube voller hastig verscharrter Leichen. Er war stummer Betrachter, Leiche und Mörder zugleich. Das Gefühl stieg in ihm auf und aus ihm heraus, es wuchs und verschlang alles, grauenvoller, als er es je ausdrücken könnte. Es verdunkelte das Licht, und Daron dachte, dass sich nicht einmal der Tod so entsetzlich anfühlen könnte. Er war nur noch eine Puppe in den Händen des Dämons, und er hatte nicht die Kraft, sich von dem Würgergriff um seine Seele zu befreien.
Die junge Frau am Boden regte sich ein wenig.
„Sie wacht auf“, sagte Ignatia sanft. „Das arme, dumme Ding!“
Daron war sich nicht sicher, wieviel Liebe die hochehrwürdige Mutter ihrem ehemaligen Schützling tatsächlich entgegenbrachte. Er wusste nicht einmal, warum sie Cassia überhaupt unter so großer Anstrengung zum Kloster gebracht hatte, aber er hatte da eine Idee: keine losen Fädchen.
Krushak gestattete Daron eine Frage, denn er schien mit seinem albernen Triumphgeheul vollständig ausgelastet zu sein: „Was machen wir jetzt mit ihr?“
„Darüber werden wir uns später Gedanken machen, Meister Daron. Aber verratet mir doch, was für einen beeindruckenden Stein Ihr da auf den Altar habt legen lassen!“, gab Mutter Ignatia zurück.
Daron blickte zu dem schwarzen Brocken hinüber.
Cassia bewegte sich wieder und öffnete leicht die Augen.
„Nun, Meister Daron? Oder seid Ihr der Meinung, dass dieses Geheimnis nicht für weibliche Ohren geeignet ist?“, fragte die hochehrwürdige Mutter spitz.
Daron sah wieder zu dem Findling, dessen ölige Schwärze sich in das weiße Altartuch zu brennen schien.
„Es ist ein uraltes Artefakt…“, begann er. Er suchte nach den richtigen Worten. „Erinnert Ihr euch an die Sonnenfinsternis über Khorinis, Mutter Äbtissin?“
„Natürlich, Meister Daron, natürlich. Besser, als Ihr denkt.“
Daron sah sie verwirrt an. „Wie… meint Ihr das, hochehrwürdige Mutter?“
„War sie nicht der Grund meines Kommens?“
„Der Grund… Eures Kommens? Ich verstehe nicht, wovon Ihr sprecht.“
Mutter Ignatia lächelte. Ihre Zähne waren weiß und klein und viel zu viele für einen einzigen Mund.
„Das müsst Ihr auch nicht, Meister Daron. Es würde nichts mehr nützen.“
Daron starrte sie an.
„Seht Euren Stein an, Meister Daron! Seht Ihr die Farben?“
Daron sah den entsetzlichen schwarzen Brocken auf dem Altar an. Unter seiner gläsern schimmernden Oberfläche tanzten Spiralen in matten Farben, sumpfgrün, aschgrau, dunkelrot wie sterbende Glut.
Der Anblick ließ Übelkeit in ihm aufsteigen, doch er konnte den Blick nicht abwenden.
Hinter ihm säuselte Ignatia: „Blickt in die Farben, Meister Daron. Dann tut es nicht weh. Ihr werdet nun erlöst.“
Daron versuchte sich umzuwenden, doch er konnte nicht. Am Rande seines Blickfeldes nahm er wahr, dass sich die Frau, Cassia, wieder regte. Ihre Augen waren geöffnet und sie versuchte sich aufzusetzen.
Erlöst, dachte er. Was könnte mich jetzt noch erlösen?
Er spürte, wie der Dämon in seinem Inneren mit einem Ruck die Kontrolle übernahm. Irgendetwas
Erlösung
hatte Krushak aus seinem Siegestaumel gerissen. Er war unaufmerksam gewesen, und Daron spürte die glutrote Wut des Dämons, die sich in seinem Geist ausbreitete. Krushak war einen Moment lang unaufmerksam gewesen, und Daron hoffte mit aller Kraft, dass es nun zu spät war.
Du magst uralt und mächtig sein, aber du bist so unendlich dumm…, dachte er noch, als er spürte, wie Krushak versuchte, Darons Haken hoch- und den Körper des Magiers herumzureißen.
Dann fühlte er einen Schmerz in seinem Hinterkopf, hell und gleißend wie geschmolzenes Silber, als etwas mit einer stählernen Spitze dort eindrang und sich in sein Gehirn bohrte. Dann nichts mehr.
Kapitel 9: Ein loses Fädchen
Cassia lag in der Dunkelheit und lauschte den Stimmen, bis sie merkte, dass die Dunkelheit gar nicht dunkel war. Sie war rötlich, bewegt und friedlich. Ein Morgen in ihrer Hütte im Hafen von Khorinis, an dem man nach eigenem Belieben erwachen durfte. Man lag mit geschlossenen Augen da und sah nichts als die rote Dunkelheit, die entstand, wenn die Sonne durch die dünne Haut der Augenlider drang. Man konnte der Brandung der myrtanischen See lauschen, dem Krächzen der Möwen, und vielleicht roch man salzige Meeresluft. Man konnte mit der Hand nach dem geliebten Menschen tasten, der neben einem im Bett lag, und dessen warme Haut spüren…
Aber das war nicht ihre Hütte in Khorinis, es war…
Cassia öffnete ihre Augen. Sonnenlicht fiel durch bunte Bleiglasfenster und wärmte ihr Gesicht. Der Boden unter ihr war glatter, kühler Stein.
Das Kloster, dachte sie, ich bin im Kloster!
Eine Welle eisiger Angst schlug über ihr zusammen und drohte sie wegzuspülen. Als sie versuchte, ihren Kopf zu heben, begannen Schmerzen in ihrem Rücken wie ein Baum zu wachsen. Cassias Wirbelsäule war ein glühender Stamm, der seine brennenden Äste bis in ihre Schultern ausstreckte und von dort seine feinen, weißglühenden Triebe ihre Arme entlang sandte. Weitaus schlimmere Schmerzen pochten in ihrer Schläfe.
Mutter Ignatias Rohrstock, dachte sie voller Entsetzen.
Und dann sah sie ihn.
Der Rohrstock, der sie am Strand niedergestreckt hatte, schien über ihrem Kopf zu schweben. Alles geschah sehr langsam, sehr klar und sehr farbig. Der Stock bestand aus geschmeidigem, biegsamem Weidenholz - jedoch nur bis zu den letzten fünf Fingerbreit seines Endes. Dieses bestand aus kalt und tödlich schimmerndem Metall.
Der Rohrstock schwebte über ihr und bewegte sich auf etwas zu, etwas, das eine menschliche Gestalt zu sein schien, eine Gestalt in einer roten Robe, die ihr den Rücken zudrehte und auf etwas zu starren schien, was außerhalb von Cassias Blickfeld lag.
Dann traf die metallische Spitze den Hinterkopf der Gestalt und bohrte sich mit einem feuchten, satten Knirschen hinein. Ein Zittern ging durch die Gestalt, und Cassia hörte ein Geräusch wie von einem kräftigen Regenguss. Im selben Moment schlug ein Schwall heißer roter Flüssigkeit auf dem Boden vor ihr auf und benetzte alles um sie herum mit feinen Tropfen und Schlieren. Die Gestalt, in deren Kopf der Rohrstock steckte, drehte sich um und hob in einer hilflosen Geste die Hände – nein, die Haken – hinauf zu seinem Mund, aus dem die Spitze herausragte. Nun glänzte sie nicht mehr in kühlem Silber, sondern glühte scharlachrot. Aus dem Mund des Magiers kam ein tiefes Gurgeln und noch mehr Blut, dann sank Daron in sich zusammen und fiel direkt vor ihr auf den blutbesudelten Boden.
Cassia versuchte, trotz der grellen Schmerzen in ihrem Kopf und Rücken, so schnell sie konnte davonzukriechen, weg von diesem gurgelnden, Blut hustendem Ding, das sich da am Boden wand.
Eine Hand griff unter ihre Achsel und zog sie hoch, eine warme, weiche Hand, mit stählerner Härte darunter.
Cassia zappelte in dem unerbittlichen Griff. Sie nahm einen unangenehm alten und wohlbekannten Geruch wahr.
„Sieh genau zu, was dort passiert!“, flüsterte eine Stimme dicht hinter ihr. „Siehst du den Stein da?“
Cassia sah nach vorne. Aus dem Meer von Blut, das sich über seine Stufen ergoss, ragte der Altar der Heiligen Flamme empor, das strahlend weiße Tuch besprenkelt mit scharlachroten Tropfen. Der sterbende Feuermagier auf dem Boden davor zuckte nur noch ein wenig. Doch Cassias Aufmerksamkeit galt dem Felsbrocken, der auf dem Altar lag, und im tiefsten, abscheulichsten Schwarz leuchtete, das sie je gesehen hatte. Nein, er leuchtete nicht, er schien, im Gegenteil, alles Licht um ihn herum aufzusaugen.
Dann geschah etwas so schnell, dass Cassias Augen es kaum wahrnehmen konnten. Etwas strömte aus dem sterbenden Daron hinaus und fuhr in den scheußlichen Stein hinein. Es geschah im Bruchteil eines Augenblicks, doch Cassia glaubte, ein unmenschliches Wutgebrüll zu hören. Dann war es vorbei. Der Felsbrocken lag stumm und ekelerregend schwarz auf dem Altar, und ebenso stumm und reglos lag Daron auf dessen Stufen.
Cassia fuhr herum, wobei der Schmerz in ihrem Kopf grell aufloderte, und sah in das unbewegte Gesicht der hochehrwürdigen Mutter Ignatia.
„War das der Dämon?“, fragte Cassia mit tauben Lippen. „Ist Daron tot?“
Ignatia lockerte ihren Griff und sah Cassia betrübt an, so, wie sie Cassia immer angesehen hatte, wenn sie sie irgendeines Vergehens überführt hatte.
„Ja“, antwortete Mutter Ignatia. „Er ist tot, und der Dämon ist in seinen Stein gebannt. Armer, dummer Daron!“
Cassias Augen wurden groß. „Hast du ihn getötet?“
„Natürlich. Das war der schnellste Weg. Und glaub mir, der Tod ist nicht so schlimm wie das, was der Dämon mit Daron gemacht hat. Er ist erlöst.“
„Um den alten Mistkerl tut es mir nicht leid“, erwiderte Cassia. „Ich würde auf seine Leiche spucken, wenn mein Mund nicht so ausgetrocknet wäre. Ich hoffe sogar, dass der Tod noch schlimmer ist als das, was der Dämon mit ihm gemacht hat. Aber wie war das möglich? Seit wann wusstest du, dass Daron…?“
Cassias Kopf summte wie ein Schwarm wütender Hornissen.
Mutter Ignatia wies auf eine der Bänke, die an den Rand des Mittelschiffs geschoben worden waren. Cassia ließ sich dankbar darauf sinken.
„Mein Kind“, hob Mutter Ignatia an, doch ein tödlicher Blick Cassias ließ sie einen anderen Anfang wählen. „Cassia, ich wusste es von Anfang an. Deswegen war ich hier.“
„Ich verstehe nicht, wovon du sprichst.“
„Die Barmherzigen Schwestern Innos‘… unsere Anstalt für schwer erziehbare Mädchen… das alles existierte nur, um ihn im Auge zu behalten.“
„Ihn? Du meinst Daron?“, fragte Cassia verwirrt.
„Auch. Aber vor allem ihn.“ Ignatia wies auf den Stein auf dem Altar. „Wir wussten seit Jahren, dass die Magier der Heiligen Flamme einen Dämon beschworen hatten. Es war ein dummes Missgeschick, könnte man sagen, ein Versagen an vielen verschiedenen Stellen. Der Dämon war bereits hier, als weder die Stadt noch das Kloster existierten. Er kam irgendwann von außen, oder vielleicht war er auch schon immer hier, vielleicht hat Innos selbst ihn geschaffen, das wissen wir nicht. Aber diese dummen, kleingläubigen Narren hier, allen voran Pyrokar, Ulthar und Serpentes, haben ihn beschworen, während der Sonnenfinsternis, an die du dich sicher erinnerst.“
Cassia dachte an Serpentes, einen ehemaligen Hochmagier der Heiligen Flamme, von dem man sagte, dass er in einer Anstalt für geistig Umnachtete Rüben jätete.
Ignatia fuhr fort: „Wir halten ihnen zugute, dass sie von trügerischen Visionen fehlgeleitet worden waren. Sie glaubten bis zuletzt, Innos selbst habe zu ihnen gesprochen. Sie trifft keine größere Schuld als alle anderen, die dem Ritual beiwohnten. Sie taten es für Innos, ihren Herrn.“ Ignatia lachte auf. „Die Heilige Flamme hat versagt. Sie haben versucht, es zu vertuschen, der arme Daron hat sich sogar seine Hände im Feuer versengt, um dem Dämon Einhalt zu gebieten. Aber der Gestank eines so schmutzigen Geheimnisses konnte nicht unentdeckt bleiben. Es kam gewissen Leuten zu Ohren…“ Ignatia machte eine kurze Pause, als erwarte sie eine Frage, aber Cassia schwieg. Sie hatte kein Interesse an großen Namen.
Ignatia zuckte die Schultern und fuhr fort: „So wurden wir in dieses Kloster entsandt, um die Ereignisse im Auge zu behalten. Ein solches Geschehen durfte sich keinesfalls wiederholen. Um keinen Verdacht bei Daron, dem neuen Herrn des Klosters, zu erregen, kamen wir mit dem Auftrag, eine Erziehungsanstalt zu eröffnen. Hier sollten alle die gesammelt werden, die wir verdächtigten, dem schädlichen Einfluss des Dämons ausgesetzt gewesen zu sein. Eigentlich wollten wir deine Schwester, wie hieß sie doch?“ Ignatia sah Cassia auffordernd an.
„Jenna“, sagte Cassia tonlos. Ihr Magen krampfte sich zusammen. „Ihr Name ist Jenna.“
„Eigentlich wollten wir Jenna aufnehmen und untersuchen, aber da sie verschwunden war, haben wir eben dich genommen.“ Ignatia lachte hell auf, als hätte sie einen besonders guten Scherz gemacht.
Als Cassia weiterhin schwieg, sagte sie: „Wir haben dich lange beobachtet, aber wir konnten nichts feststellen. Dich hat Krushak nicht berührt, das war mir schnell klar.“
„Warum habt ihr mich dann nicht einfach wieder nach Hause geschickt?“, stieß Cassia hervor. Ihre Augen funkelten.
„Wir hatten doch eine schöne Zeit hier, wir Mädchen, nicht wahr? Oder hast du irgendetwas in deiner Erziehung vermisst?“
„Meine Mutter“, flüsterte Cassia.
Ignatia lachte schallend. „Ach was, dein Miststück von Mutter war froh, als ich ihr sagte, die Stadtverwaltung von Khorinis und das Kloster der Heiligen Flamme hätte deine Inobhutnahme durch meine Einrichtung beschlossen. Sie hat sich nie dagegen gewehrt. So haben wir dich eben zu uns genommen, damit es, nun ja… echter wirkte. Dich und die anderen Mädchen. Und was soll ich sagen, es hat euch ganz bestimmt nicht geschadet.“
Cassia sah sie nur durchdringend an und antwortete nicht.
Das schien Mutter Ignatia zu verunsichern, jedenfalls versetzte sie knapp: „Wie dem auch sei, in den letzten Wochen haben wir gespürt, dass der Dämon – Krushak, wie er sich nennt -, wieder erwacht war. Er hatte begonnen, sich in Daron zu regen. Ich musste einen günstigen Moment abwarten, um ihn zu bannen…“ Sie erhob sich, ging zu Darons Leichnam hinüber und zog den Rohrstock an dem Rohrstock, der in seinem Schädel steckte. Er saß fest. „Daron war kein schlechter Mann, und es tut mir ein wenig Leid um ihn, aber es war noch eines der letzten losen Fädchen in dieser unangenehmen Geschichte.“ Sie zog fester an ihrem Stock. Darons Kopf hob sich ein wenig, dann glitt die Klinge aus der Wunde, und Darons Gesicht fiel mit einem weichen, fleischigen Geräusch in die Blutlache zurück. Cassia wurde übel. Sie vergrub den Kopf in ihren Händen und versuchte, nicht darüber nachzudenken, dass auch sie nun ein loses Fädchen in dieser unangenehmen Geschichte war.
Kapitel 10: Im Lot
Er war das mächtigste Wesen auf der Welt, dessen war er sich von Beginn seiner Existenz an bewusst gewesen. Die Drei mochten vielleicht mächtiger sein als er, aber sie waren nicht mehr hier, oder? Die Welt der Menschen gehörte ihm.
Es war lächerlich, was diese dummen Menschen gegen ihn auszurichten versuchten. Sie mochten trotzig sein, sich sträuben und versuchen, ihn auszutricksen, aber das würde Krushak nicht aufhalten. Für einen Moment hatte es so ausgesehen, als würden die Dinge beginnen, an den Rändern unscharf zu werden, und die wunderbare Gewissheit seiner Allmacht hatte sich langsam und kaum merklich verflüchtigt, so wie Sand durch den engen Hals des Stundenglases nach unten rinnt.
Aber nun war die Welt wieder im Lot. Die hässliche kleine Figur, die die Frau aus dem Sand gegraben hatte… Krushak glaubte nicht, dass ein Abbild eines der Drei ihm wirklich schaden konnte, aber dieses Ding war das Einzige, was entfernt in die Nähe dessen kam, was er überhaupt auf Erden fürchtete. Nun blickte er auf das nutzlose Ding, das fein säuberlich verpackt auf dem Altar lag, neben seiner Schlafstatt, in der er so viele Ewigkeiten verbracht hatte. Ihm war zum Jubeln zumute, denn er hatte erreicht, was er wollte. Die Statue war in seinen Händen – es spielte keine Rolle, ob sie tatsächlich zu etwas nütze war -, die eine Frau lag reglos am Boden, die andere Frau, die er misstrauisch durch Darons Augen beobachtet hatte, stand dumm und still daneben, als wäre sie eine Wachspuppe. Er würde sie am besten beide vernichten, sobald er Zeit dafür fand.
Aber Töten hatte seine Zeit, und Jubel hatte seine Zeit.
Der Magier, in dem er sich eingerichtet hatte, brabbelte irgendetwas in seinen Geist hinein und versuchte, sein Glücksgefühl zu stören, aber Krushak hörte einfach nicht hin. Nun musste er nur noch auf seine beiden Auserwählten warten – hoffentlich würde die Hülle Darons noch eine Weile halten, denn sie begann schon auseinanderzufallen wie eine schlampig gearbeitete Puppe. Und er musste noch etwas tun. Er spürte, wie sich die Menschen der ganzen Insel in der Hafenstadt versammelten, um dort ihren Göttern zu huldigen, die diese Welt schon längst verlassen hatten. Es würde ganz einfach sein, sie alle zu seinen Sklaven zu machen. Sie würden nicht lange Bestand haben, wenn ihnen widerfahren war, was er mit ihnen vorhatte, aber das mussten sie auch nicht. Sie mussten ihm eine kleine Weile dienen, und dann würde er sie sowieso verzehren. Und wenn er seinen Schlachthof Khorinis aufgezehrt hatte, würde er weitergehen, er würde über das Meer gehen, von Kontinent zu Kontinent, und über die Menschheit herfallen. Es würde herrlich werden, und nichts würde jemals wieder seine…
Ein plötzliches, durchdringendes Gefühl des Magiers riss Krushak aus seinen Gedanken, eine allumfassende und brennend heiße Empfindung, die Daron durchzuckte, ein tausendschichtiger Gedanke, der zu einem einzigen Wort gerann, das wie mit Flammenschrift an die Mauer seines Geistes geschrieben stand:
Erlösung
Krushak versuchte, Darons Körper herumzureißen, aber es war zu spät. Ein Schmerz, hell und heiß wie ein Sonnenstrahl, fuhr in Darons Schädel. Krushak spürte, wie das Leben aus dem Magier herausrann wie Wein aus einem lecken Krug, aber er konnte es nicht aufhalten. Er fuchtelte mit Darons Haken in der Luft herum, aber es war zu spät. Das Schlimmste war, dass er es nicht vorausgesehen hatte. Darons Blut sprudelte ohne Unterlass aus seinem Mund, und Krushak musste handeln. Zuerst einmal musste er sich in Sicherheit bringen, bis er die Lage überblickte. Er löste sich mit einem schmerzlosen Ruck aus dem Körper des Magiers, woraufhin dieser in sich zusammenfiel und in der Lache seines Blutes liegenblieb, und konzentrierte sich auf sein Haus, das er seit unendlicher Zeit bewohnte. Sofort spürte er den warmen, verlockenden Sog, der von seinem Felsen ausging und gab sich ihm hin, ließ sich umschmeicheln und darin einhüllen und der samtigen Schwärze in die Arme fallen. Hier konnte ihm nichts geschehen, oder? Er rollte sich zusammen, und ließ seinen Geist über dem Stein schweben; sah Darons Leiche, in deren Schädel ein Stock steckte, in seinem Blut liegen; sah, wie die alte Frau auf die junge einredete, ohne dass er ihre Worte verstehen konnte.
Was hatte die alte Hexe da getan? Wie war es möglich, dass sie ihn überrumpelt hatte? Wieso hatte er es nicht vorausgesehen? Es lag auf der Hand: Er war nicht aufmerksam gewesen. Die Dinge wurden an den Rändern unscharf, er [i]durfte[i] nicht unaufmerksam sein. Er war Khorinis, und er durfte nicht aufhören zu existieren.
Krushak wurde von nachtschwarzer, brüllender Wut erfasst, doch wenn er in seinem Stein war, konnte er nichts zerstören, egal, wie sehr er sich danach sehnte. Er tobte wie ein tollwütiges Wiesel in seinem Felsen, doch nichts davon drang in die Welt da draußen.
Krushak versuchte sich zu sammeln. Er ließ sein Auge höher schweben, immer höher, bis er das ganze Kloster überblicken konnte. Dann konzentrierte er sich auf das kleine, geschmeidige Tier, das in diesem Moment wie ein grauer Schatten durch die Gänge des Klosters huschte und durch eine Ritze in der gekalkten Backsteinmauer in eine gewisse Zelle schlüpfte. Hätte er gerade einen Körper zur Verfügung gehabt, ein Gesicht, einen Mund, dann hätte Krushak gelächelt.
Wie weise er doch gehandelt hatte, als er den alten Narren nicht getötet hatte! Er wusste, dass das alte Weib vorhatte, Ezechiel zu beseitigen, aber Krushak hatte bessere Pläne für den Alten. Viel bessere Pläne.
Die Ratte, durch deren Augen er den Alten betrachtete, begann zu grinsen.
Kapitel 11: Nach Hause
Die Ratte blickte ihm unverwandt ins Gesicht. Sie hatte sich auf seine Handfläche gesetzt, den Schwanz um den Leib geringelt und abgewartet. Auch sie schien auf Befehle zu warten, und Ezechiel empfand einen Moment tiefer Vertrautheit zwischen sich und dieser Ratte. Wenn er sie ansah, wenn er in ihre klugen, warmen, dunklen Augen sah, wurde alles viel leichter und heller. Alle Spannung fiel von ihm ab, als er mit seiner pelzigen neuen Freundin in Darons Studierzimmer saß, er wurde ganz ruhig. In seinem Inneren hörte er eine sanfte Melodie, wie sie vielleicht seine Mutter gesummt haben mochte, als er als Säugling an ihrer Brust gelegen hatte. Ezechiel summt leise mit.
Sie warteten gemeinsam.
Mit einem Mal fuhr der Kopf der Ratte hoch. Ihre Barthaare erzitterten. Sie sprang flink und geräuschlos von seiner Hand auf den Boden und sah ihn auffordernd an.
Komm mit!
Ezechiel erhob sich von Darons Sessel, raffte seine neuen, wallenden Gewänder und folgte ihr. Die Robe raschelte beim Gehen, leise und trocken wie Laub im Herbstwind. Die Ratte führte ihn durch einen engen, dunklen Korridor, aber Ezechiel empfand weder Angst noch Grauen. Es war gut und richtig, Schwester Ratte zu folgen; er stand unter ihrem Schutz. Was immer sie ihn tun ließ, es würde das Richtige sein.
Der Gang endete vor einer schlichten Holztür.
SAKRISTEI. BITTE RUHE!
Die Tür schwang wie von selbst auf, als sie sich ihr näherten. Dahinter lag warme, verlockende Dunkelheit. Ezechiel tastete sich voran. Er wusste nicht viel über Gotteshäuser, aber er vermutete, dass es sich bei dem Raum um die kleine Kammer hinter dem Altarraum handelte, in der die unsinnigen Gerätschaften aufbewahrt wurde, die zur Verrichtung der Messe aus Gründen, die sich ihm nie erschlossen hatten, so dringend notwendig waren. Hier standen klobige goldene Leuchter, hier hingen so üppig wallende Roben, dass sie ihm schon fast damenhaft vorkamen, hier staubten Bücher gemächlich in trägen Stapeln ein, hier lagerten allerlei Gefäße und Kerzen.
Er ertastete einen großen, schweren Leuchter aus Gold, und ein Kribbeln lief durch seine Finger, wanderte seinen Arm hinauf, floss in sein Herz und tanzte dort einen hektischen, vergnügten Tanz. Ezechiel musste dabei an die Beine der Männer denken, die am Galgen zappelten, bevor sie starben.
Er wog den Leuchter in der Hand und spürte sein beruhigendes Gewicht. Vor ihm öffnete sich eine weitere Tür einen Spalt breit, und weiches, weißes Licht malte einen hellen Streifen auf den Boden der Sakristei. Er sah, wie sich die Ratte geräuschlos hindurchschob. Er selbst blieb vor dem Türspalt stehen und spähte hinaus. Vor ihm eröffnete sich der Altarraum und dahinter das gewaltige Mittelschiff der Kathedrale. Licht fiel durch die bunten Bleiglasfenster auf die denkwürdige Szenerie, die sich ihm darbot. In einer Lache scharlachroten Blutes lag Daron, der Hohepriester des Sonnengottes. Sein Blut hatte sich in wilden, irgendwie hübschen Mustern auf dem Marmor verteilt, so dass es fast aussah wie die Rankenornamente, die die Säulen verzierten. Auf einer Bank am Rande des Mittelschiffes sah er Cassia sitzen, sehr blass und in sich zusammengesunken, und neben ihr, sehr aufrecht und in strahlendem Weiß gekleidet, die Äbtissin der Mädchenanstalt, die auf Cassia einzureden schien.
Doch all das wurde überstahlt von dem Wunder, das auf dem Altar thronte. Es zog ihn an wie das späte Licht einer Laterne eine einsam flatternde Motte. Ezechiel stockte der Atem. Ein Stein, so mattschwarz wie eine Neumondnacht und doch so schimmernd und verlockend, so köstlich in seiner völligen Schwärze! Die Ratte hüpfte auf das weiße, mit roten Sprenkeln besudelte Altartuch und blieb vor dem Stein sitzen. Ihre Barthaare zitterten wieder. Ezechiel stellte den Leuchter wieder ab. Er würde ihn nicht brauchen. Geduckt, wie eine Ratte, kroch er in den Altarraum. Er versuchte, sich möglichst hinter dem Altar aufzuhalten, so dass die beiden Frauen ihn nicht sehen konnten. Hätten sie ihn bemerkt und versucht, ihn zu hindern, er hätte sie einfach umgebracht. Nichts würde ihn davon abhalten können, dieses Wunderwerk zu berühren, nicht einmal Innos selbst.
Er kroch Schritt um Schritt näher, bis er hinter dem Altar kauerte. Behutsam streckte er die Hand aus. Die Oberfläche des Steins schimmerte gläsern, darunter wiegten sich Schemen in dunkelrot und tiefgrün, behäbig wie Wasserpflanzen in einem ruhig dahinströmenden Fluss.
Seine Oberfläche bot sich gefällig seiner Berührung dar. Ezechiel legte seine Handfläche auf den Stein.
So musste sich eine Motte fühlen, wenn sie im Feuer einer Laterne verging. Ezechiel stand in tödlichen Flammen, er wollte schreien, vor Schmerz und Entsetzen und Lust, aber kein Laut kam über seine Lippen. Er kauerte reglos und lautlos hinter dem Altar, während etwas Großes, Entsetzliches in ihn einzog, etwas Uraltes und Unbegreifliches.
Nun lerne ich die Stimme endlich persönlich kennen, dachte er noch mit hysterischer Heiterkeit, und dann war kein Raum mehr für Gedanken, denn alles war erfüllt von ihm. Ezechiel sah durch seine eigenen Augen zu, wie seine Hand nach einem Gegenstand griff, der in ein schlichtes Tuch gehüllt neben dem Felsen auf dem Altar lag. Er nahm ihn an sich und ließ ihn in der Tasche seiner Robe verschwinden.
Wohin gehst du, wenn du dich verstecken willst?, fragte ihn eine Stimme, die zwar leise war, aber so nahe, dass sie in einem Kopf dröhnte.
Ezechiel wimmerte leise vor Angst.
Das Wesen, das in ihm saß, ließ Ezechiels Hand vor seien Mund schlagen.
Wohin?, fragte es ungeduldig.
Nach Hause, dachte Ezechiel. Nach Hause.
Die Stimme schien mit dieser Antwort zufrieden zu sein. Sie ließ Ezechiels Körper lautlos und behände in die Sakristei zurückkriechen.
Ezechiel sah staunend zu, wie vor seinen Augen Bilder entstanden, die Khorinis zeigten, ein menschenleeres Khorinis, in dem nur das verträumte Läuten von Silberglöckchen und der Gesang der Zikaden in der Mittagshitze zu hören war. Er sah sich selbst, umgeben von einem unregelmäßigen Kreis dunkler Gestalten, starrten ihn mit dumpfer Gier anstarrten, während ihre seltsam verzerrten Schatten sich hinter ihnen auf dem Boden abzeichneten. Ihre Haut hing in schwarzen faulenden Fetzen von ihren Gliedern. Einer von ihnen hatte ein großes, ausgefranstes Loch in Wange und Ezechiel konnte seine Kiefermuskeln hirnlos mahlen sehen. Mit gebückter, zielstrebiger Langsamkeit schlichen sie dahin, wie Leichen, die böse Magie wiederbelebt hatte. Ihre Arme baumelten schlaff an ihren Schultern, aber die knotigen Hände umklammerten Keulen, die mit rostigen Nägeln gespickt waren, schwere Äste oder Tisch- und Stuhlbeine. Ezechiel stöhnte auf.
Hab keine Angst, flüsterte die Stimme. Wir gehen jetzt nach Hause, und dort werden wir die kleinen, dummen Menschen von Khorinis zu unseren Dienern machen. Jetzt kreuchen sie noch ziellos einher wie blinde Würmer und Maden, aber bald werden sie ihrer Bestimmung zugeführt. Du und ich, wir werden Herrscher sein.
Die Worte der Stimme ließen Ezechiel erschauern, vor Angst und vor Wonne. Es würde alles gut werden.
-
Kapitel 12: Stadt der Träume
An diesem herrlichen Morgen, der einer der letzten von Khorinis sein würde, saß Hanna auf einer Bank im Park vor der Statthalterresidenz. Der stolze Palast stand strahlend weiß im Morgenlicht, geschmückt mit Fahnen und Blumen in allen Farben, auf denen letzte Tautropfen der Nacht schimmerten; die von hohen Hecken und Bäumen umgebene, elegant angelegte Miniaturlandschaft und die steinernen Bänke rings herum waren noch menschenleer. Der Himmel spannte sich in strahlendem Blau über die Hafenstadt. Die Stadt lag still in freudiger Erwartung des Feuerblütenfestes, das an diesem Tag feierlich von Larius, dem Statthalter von Khorinis, eröffnet werden sollte.
Hanna saß ebenso still auf ihrer Bank, doch in ihr wütete ein Sturm. Sie dachte an den Traum der letzten Nacht, der so anders gewesen war als die Albträume, die sie in den letzten Wochen heimgesucht hatten. Hanna hätte nicht gedacht, dass die Träume noch schlimmer werden könnten. Hanna schloss die Augen, und Bilder stiegen in ihr Bewusstsein auf wie Luftblasen aus den tiefsten Tiefen des Meeres.
Cassia kam auf sie zu, und sie trug ein weißes, fast durchsichtiges Kleid. In ihrer Miene spiegelte sich wilder Triumph, so dass ihr Gesicht schön und gefährlich aussah wie das eines seltenen Raubtieres. Sie näherte sich Hanna in einem dunklen Raum mit Steinfußboden, und der Geruch von Ruß und Staub stieg ihr in die Nase. Sie breitete die Arme aus, und auch Cassia tat es, während sie auf sie zuging, um sie zu umarmen. Cassia deutete mit ihren Händen auf ihren Körper, und Hanna verstand. Sie verspürte eine beunruhigende Mischung aus Angst, Widerwillen und Sehnsucht: Angst und Widerwillen, weil sie wusste, wo sie sich befanden; Sehnsucht, weil sie sie liebte. Sie würde sie immer lieben, dachte Hanna. Ihre Angst wuchs, als sie einander in die Arme schlossen, aber es war ihr unmöglich, sich ihr zu entziehen. Hannas Hände drückten sich auf die glatte Fläche ihres Rückens, und sie spürte die Haut unter der dünnen Seide. Cassia lächelte mit diesen unergründlichen schwarzen Augen, ihr Kopf neigte sich zu ihr. Hanna stand im Dunkeln, und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fügten sich ineinander. Hanna wollte davonrennen, schreiend davonrennen, und alles ungeschehen machen, was passiert war. Aber sie wollte auch bei Cassia sein, hier und sofort. Hanna zog Cassia fest an sich, spürte ihren nackten Körper unter dem Stoff und begann, ihr Kleid mit einer Hand hochzuschieben. Bei Beliar, war sie warm! Hannas Finger krampften sich in Cassias Rücken und presste ihr Gesicht an Cassias, nahm ihren heißen Atem an ihrem Hals wahr…und genau in diesem Augenblick bemerkte sie es. Wie dunkles Moos auf einem Grabstein hatte sich drahtiges Fell auf den Cassias Wangen ausgebreitet, und das glänzende Schwarz ihres Haares war einem stumpfen Braun gewichen. Die großen, dunklen Augen wurden klein, winzig klein und rund, wie zwei glühende Kohlen, und als sie lächelte, belustigt und befriedigt über Hannas Entsetzen, zogen sich die Lippen über krummen, gelben Zähnen zurück. Speichelfäden troffen aus ihrem Maul. Hanna schrie nicht, so wie sie in ihren Träumen mit dem Dämon geschrien hatte. Sie hatte keine Schreie mehr übrig, und sie bezweifelte, dass sie jemals wieder würde schreien können.
Hanna öffnete die Augen. Obwohl sie in der warmen Morgensonne saß, fröstelte sie. Etwas war ganz und gar nicht in Ordnung. Cassia war nicht mehr aufgetaucht, seitdem sie zum Kloster gegangen war, um mit Ezechiel zu sprechen. Hanna hatte nichts mehr von ihr gehört oder gesehen, und niemand wusste, wo Cassia steckte, weder Attila noch Rodriguez oder sonst einer von Cassias Vertrauten.
Es blieb nur noch eine einzige Möglichkeit.
Nun, eigentlich gab es zwei Möglichkeiten. Die eine hatte sie bereits gründlich erwogen und – fürs erste – verworfen: Eine Flucht auf die Diebesinsel vor dem, was kommen würde, schien Hanna nach wie vor das Vernünftigste zu sein – doch sie würde nicht ohne Cassia dorthin gehen. Sie hatte allerdings Attila und sie anderen angewiesen, sich noch an diesem Morgen auf die Insel zurückzuziehen. Die Diebe hatten gemurrt ob der fetten Beute, die ihnen damit entging, aber Hanna hatte ihnen eingeredet, dass die Miliz noch vor der Eröffnung des Feuerblütenfestes ihr Versteck in der Kanalisation stürmen würde, es sei eine Frage von wenigen Stunden, bis sie alle – als besonderes Glanzlicht des Festprogramms – am Galgen baumeln würden. Die Diebe hatten widerstrebend gehorcht.
Die zweite Möglichkeit war, Ezechiel zu finden und aus ihm herauszuquetschen, was er über Cassias Verbleib wusste.
Ein Geräusch riss Hanna aus ihren Gedanken. Ein klappriger Wagen fuhr in den Hof der Stadthalterresidenz. Darauf standen Körbe und Holzkisten, auf die eine ungeschickte Hand die Umrisse von Lämmern, Hühnern und Scavengern gemalt hatte sowie die Aufschrift ICH KOMME VON AKILS HOF.
Hanna sprang auf, raffte ihr Kleid und eilte zum Stadttor.
Als sie den Weg das letzte Mal gegangen war, war es Nacht gewesen, und Hanna hatte sich vor den Geräuschen und den Tieren und der Dunkelheit gefürchtet. Nun war es strahlend heller Tag, und Hanna fürchtete sich unendlich viel mehr. Den Brieföffner aus Nordmarstahl hatte sie auch heute bei sich – sie hielt ihn im rechten Ärmel ihres Kleides versteckt -, doch sie bezweifelte, dass er sie würde retten können. Dennoch war es tröstlich, das kühle Metall an ihrem Unterarm zu spüren.
Hanna ging den Pfad zur Hochebene entlang nach Osten. Die Gegend war kaum besiedelt, und die Einsamkeit zerrte an ihren Nerven. Sie versuchte, das Gefühl, von fremden Augen beobachtet zu werden, abzuschütteln, aber es gelang ihr nicht. Ihr war, als hätten ihre Eingeweide angefangen, langsam und träge in ihrem Bauch herumzukriechen. Sie kam an einem kleinen, verlassenen Verkaufsstand am Straßenrand vorbei. Es war weit und breit keine Spur von einem Händler zu sehen, nur ein Stapel staubigbrauner, vertrockneter Kokosnüsse, die wie Schrumpfköpfe aussahen.
Hanna erreichte die Hochebene noch weit vor der Mittagsstunde, schwitzend und keuchend, aber ihr Inneres fühlte sich an wie ein Klumpen graues Eis. Sie beobachtete den alten Einsiedlerhof aus einigen hundert Schritten Entfernung, konnte aber nichts erkennen, was zwingend für oder gegen Cassias oder Ezechiels Anwesenheit dort sprach. Ein mit Ziegelplatten gepflasterter Weg zweigte von dem Pfad ab und führte direkt auf das Gehöft zu. Diesmal konnte sich Hanna nicht dem Schutz der Dunkelheit anvertrauen, also lief sie geradewegs auf den Hof zu, der so still im Sonnenlicht lag wie die Hafenstadt es an diesem Morgen getan hatte. Hanna ging langsam den Weg entlang, und das Unkraut, das zwischen den geborstenen Ziegelplatten des Weges wuchs, streifte ihre Knöchel. Dann stand sie vor der Tür mit dem eingelassenen Glasfenster. Ein hellgelber dünner Vorhang schützte das Innere vor neugierigen Blicken.
Sie klopfte. Stille. Keine Reaktion.
Niemand zu Hause, dachte Cassia und schämte sich der Erleichterung, die sie bei diesem Gedanken empfand. Jetzt kann ich einfach wieder gehen.
Stattdessen klopfte sie wieder. Jetzt hörte sie Schritte, und sie hörten sich genauso an, wie sie es sich vorgestellt hatte, langsam und schlurfend. Einen Moment lang war sie sehr nahe daran, wegzulaufen. Konnte sie es den Weg hinunter bis zur Grenze der Lichtung der Hochebene schaffen?
Sie blieb stehen und sah, wie eine schattenhafte Gestalt hinter den hellgelben Vorhängen näherkam, eine große Gestalt mit gebeugten Schultern; sie beobachtete mit hilfloser Faszination, wie sich der Türknauf drehte und sich die Tür öffnete.
Ezechiel stand vor ihr, und aus irgendeinem Grund trug er die Prachtrobe eines Hochmagiers der Heiligen Flamme. Er starrte sie mit schlaffen, leeren Gesichtszügen an.
„Ja?“, fragte er.
„Es tut mir Leid“, sagte Hanna. „Ich wollte…ich suche…“
Ezechiel runzelte leicht die Stirn und tastete unwillkürlich nach irgendetwas in den Tiefen seiner Robe. Er erschien ihr größer als noch vor einigen Tagen, als er sie in Khorinis aufgesucht hatte. Größer und dunkler. Es mochte an der Robe liegen, aber sein Brustkorb wirkte seltsam verformt.
„Cassia? Cassia, bist du das?“
Hanna gab ein leises, verwirrtes Lachen von sich, das sich fast wie ein Schluchzen anhörte.
„Ich bin Hanna. Ezechiel, wo ist Cassia? Hat sie dich im Kloster gefunden?“
Ezechiels Augen flackerten, als würde er sie gerade zum ersten Mal sehen.
„Hanna, natürlich. Ja, ich habe Cassia gesehen. Es geht ihr gut. Sie hat mir etwas für dich mitgegeben. Komm herein… komm doch, nicht so scheu! Ich hole es dir gleich.“ Ezechiel lächelte das gewinnende Lächeln, das Hanna als junges Mädchen sehr anziehend gefunden hatte. Dort, wo immer sein Goldzahn gefunkelt hatte, klaffte nun eine hässliche dunkle Lücke. Hanna schauderte.
Ezechiel verschwand wieder im Dunkel der Türöffnung. Hanna zögerte. Sie hatten irgendetwas mit ihm gemacht im Kloster, und es war zu befürchten, dass das nichts Gutes gewesen war. Aber sie hatte keine Wahl, wenn sie Cassia finden wollte.
Sie trat in die Kühle seines Hauses ein, blieb jedoch nur wenige Schritte von der Tür entfernt stehen und sah sich um. An einer Wand hingen zwei Bilder, eines von Innos und eines von Rhobar II, an der anderen Wand ein großer, vom Alter fleckig gewordener Spiegel. Hanna sah ihr eigenes, bleiches Gesicht und wandte rasch den Blick ab. Sie hörte Ezechiel im Nebenzimmer mit Geschirr klappern. Rasch suchte sie nach einer Spur von Cassia, doch sie konnte nichts entdecken. Ezechiel war offenbar aus dem Kloster entlassen und, wie es aussah, mit einer Robe ausgestattet worden – oder wie war sein seltsames Auftreten zu erklären?
Irgendetwas stimmte hier nicht.
Ezechiel kam aus der Küche und trat an einen runden Tisch, der mitten im Raum stand. Er stellte zwei Tassen mit Untertassen aus zartem, eierschalenfarbenem Porzellan darauf. Eine dampfende Teekanne verströmte aromatischen Duft. Daneben stand eine Platte mit kleinen Kuchen.
„Ich habe uns Tee gemacht. Du siehst erschöpft aus. Ruh dich ein wenig aus. Ich habe dir etwas zu sagen… von Cassia.“
„Geht es ihr wirklich gut?“, flüsterte Hanna.
„Natürlich“, erwiderte Ezechiel und goss Tee in die Tassen. Er sah dunkel und trüb aus. Hanna war sich nicht sicher, ob sie ihn trinken wollte … und auf einmal war sie sich nicht einmal mehr sicher, ob sie überhaupt hier sein wollte. Kälte kroch über ihr Rückgrat. Ezechiel reichte Hanna eine Teetasse und bedeutete ihr, Platz zu nehmen.
„Danke“, sagte Hanna. Der Tee duftete tröstlich nach Blumen und Kräutern. Sie nippte vorsichtig daran. Er schmeckte gut.
„Es geht nichts über einen guten Tee.“ Ezechiel lächelte zufrieden, und Hanna bemerkte, dass er mit dem Alter schlechte Zähne bekommen hatte. Sie sahen zwar noch kräftig aus, waren aber ganz gelb geworden, und die Schneidezähne standen über Kreuz. Die Lücke klaffte wie der Eingang zu einer anderen, dunklen Welt, der Welt der Dämonen vielleicht.
Ezechiel trank seinen Tee laut schlürfend mit einem gewaltigen Schluck aus. Er lächelte Hanna zu, nein, er grinste ihr zu mit seinen schrecklichen gelben Zähnen. Etwas bewegte sich in Ezechiels Schoß, etwas Kleines und Pelziges, und Hanna dachte im ersten Augenblick, eine kleine Katze wäre unbemerkt darauf gesprungen. Sie sah genauer hin, und mit Entsetzen entdeckte sie, dass es sich um eine Ratte handelte.
Etwas stimmte hier ganz entschieden nicht.
„Wo ist Cassia? Was ist im Kloster passiert? Hat Daron dir diese Robe…?“
„Iss doch was, meine Liebe!“, fiel ihr Ezechiel ins Wort und deutete auf die kleinen, mit Zuckerguss überzogenen Kuchen.
„Nein danke.“
„Nein?“, fragte Ezechiel und grinste wieder. Seine Finger kratzten über die Kuchenplatte, und er begann, sich die kleinen Kuchen mit beiden Händen in den Mund zu stopfen. Seine gelben Zähne zermamlten sie knirschend, Krümel fielen auf sein knochiges Kinn. Die Ratte hob ihren Kopf und knabberte an einem Stückchen Kuchen, das auf Ezechiels Schoß gefallen war.
„Gefangenschaft macht hungrig, musst du wissen“, kicherte Ezechiel. „Ich war so lange eingesperrt!“
„Du warst eine Nacht und einen Tag im Kloster, Ezechiel“, gab Hanna zurück. Ihre Stimme klang sehr fremd. „Warum hast du diese Robe an?“
„Oh, die Robe? Die habe ich mir als kleines Andenken mitgenommen. Ich mag dieses Rot, du etwa nicht?“
„Ich… ich weiß nicht.“ Hanna war verwirrt. „Aber was ist mit Cassia…?“
„Cassia war schon immer ein boshaftes und lügnerisches Ding, Hanna. Oh, und verdorben! Durch und durch verdorben.“ Ezechiel kicherte tonlos. „Ihre Mutter hat sie gehasst, weißt du das?“
„Was hast du mit ihr gemacht?“, hörte sich Hanna mit hoher, dünner Stimme fragen – der Stimme eines kleinen Mädchens.
„Sie hat mir etwas für dich mitgegeben, meine Liebe. Sieh mal hier…“ Ezechiel zog einen kleinen Gegenstand aus den Falten seines Gewandes. Es war eine Statuette aus Bergkristall, die den Gott Innos darstellte. Sie war sehr glatt und fast ohne Linien, so als hätten die Jahre die Konturen einfach weggewischt.
„Was soll das?“, fragte Hanna mit tauben Lippen.
Unter Ezechiels Robe bewegte sich etwas. Als er wieder seine Stimme erhob, bewegten sich seine Lippen nicht. Die Worte schienen direkt aus seiner Brust zu kommen.
„Sieh genau hin, Liebes.“ Ezechiel hob die kleine Figur und drehte sie in der Luft herum. Ein Sonnenstrahl fiel darauf und ließ den kleinen Gott aufleuchten. Unwillkürlich streckte Hanna die Hand nach der Statuette aus. Ihre Fingerspitzen berührten den kühlen Kristall, und im selben Augenblick schien die Figur glühend heiß zu werden. Hanna keuchte, aber nicht so sehr wegen des grellen Schmerzes, der ihren Arm durchzuckte. Sie spürte, wie die Haut ihrer Fingerspitzen verschmorte, aber sie konnte sie nicht von der Statue lösen, denn Bilder stiegen vor ihren Augen auf. Sie sah eine Stadt am Meer, die tot und still in der Dunkelheit lag. Es schien Khorinis zu sein, aber irgendwie auch nicht. Eine Schwere lastete auf der Stadt, es roch nach welken Blumen, Blut und Verwesung. Es war Khorinis, aber es war das Khorinis des Dämons aus ihren Träumen. Er hatte Einzug in seine Stadt gehalten und herrschte dort über die Toten.
Da geschah es. Hunderte von rotglühenden Feuerbällen erschienen aus dem Nichts am Himmel, sie zogen durch die Nacht wie Schiffe durch den Ozean, und sie schienen zu zerfallen und ließen ihr Feuer auf die Erde fallen, um die Dunkelheit für das zu erhellen, was auch immer als Nächstes kommen mochte. Hanna sah sich auf dem Marktplatz vor ihrem Hotel, ringsumher schwebte Feuer zur Erde, und Hanna wusste, dass etwas Unvorstellbares geschah. Sie dachte an Cassia. Dann hörte sie einen unvorstellbaren Lärm. Es war, als käme ein applaudierendes Publikum auf sie zugestürmt, und dann war es direkt über ihr. Hanna wurde auf den Boden geschleudert, der Marktplatz füllte sich mit Feuer und Rauch. In den Bäumen schrien Vögel, deren Gefieder in Flammen stand. Die Wände der Häuser um sie herum hoben sich für einen Augenblick, und bevor sie sich wieder senkten, ließen sie Licht hindurch. Blaues und orangefarbenes Licht, lila und weiß, albtraumhafte Bilder eines gewaltigen Feuers, das Gerechte und Ungerechte gleichermaßen.
Die Vision brach so plötzlich ab wie sie gekommen war. Hanna starrte auf ihre Fingerspitzen, die schwarz geworden waren.
Dann lächelte sie.
Ezechiel riss die Statue zurück und stopfte sie in die Tiefen seiner Robe zurück. Seine Augen waren schwarz wie Obsidian, die Hand, die auf dem Tisch lag, ballte sich zur Faust und öffnete sich wieder.
„Was hast du gesehen?“, brüllte die Stimme aus Ezechiels Brust. „Was hast du gesehen?“
Unendlich langsam kam Hanna auf die Beine und wich vor dem Ezechiel-Ding zurück. Die Ratte saß mit gesträubtem Fell auf dem Tisch und gab ein zischendes Fauchen von sich. Hanna erreichte die Tür und tastete nach dem Türknauf, während sie Ezechiel nicht aus den Augen ließ. Der Türknauf war verschwunden. Die Tür war eine glatte, ebene Fläche ohne irgendeine Klinke, einen Riegel oder ähnliches. Ezechiel grinste.
Nichts würde den Dämon noch aufhalten können, nicht sie, nicht Cassia, nicht der lächerliche Brieföffner in ihrem Ärmel.
Ezechiel trat auf Hanna zu, packte sie an den Schultern und schüttelte sie so heftig, dass sie ihr Schlüsselbein brechen hörte. „Was hast du gesehen?“, brüllte er und schleuderte sie in eine Ecke des Zimmers.
Nichts würde den Dämon aufhalten können, Khorinis in Besitz zu nehmen, aber Hanna glaubte verstanden zu haben, was Innos – oder eine andere göttliche Macht – von ihr verlangte. Es gab keine Rettung für Khorinis, aber vielleicht gab es Erlösung.
„Gib mir die Statue“, brachte sie hervor. „Du musst sie mir geben. Cassia hat sie für mich hinterlassen.“
„Wozu brauchst du sie?“, brüllte der Dämon, rasend vor Wut. „Wozu brauchst du das dumme Ding? Was hast du gesehen?“
Hanna hörte ihre eigene, dünne Stimme aus großer Entfernung sagen: „Sie darf auf keinen Fall zurück ins Kloster gelangen. Gib sie mir.“ Ihr Herz klopfte in ihrer Kehle.
„Du dummes, albernes Weibsstück“, antwortete Ezechiel und starrte sie mit seinen tiefschwarzen Augen an. Tiefschwarz, doch in ihrer Mitte schimmerte dunkles Gold. „Sag mir, was du gesehen hast!“
Hanna stöhnte. Innos mochte ihr gnädig sein. Sie sah Ezechiel an und dachte an den Brieföffner in ihrem Ärmel.
„Ich werde es dir erzählen. Komm näher, Ezechiel.“
Das Ezechiel-Ding grinste und trat einen Schritt auf sie zu.
„Noch näher“, flüsterte Hanna.
Er kam noch näher. Hanna spürte die glühende Hitze, die von ihm ausging, roch die nasse Fäulnis, die von ihm ausging, süßlich und erstickend, wie verrottendes Gemüse in einem dunklen, feuchten Keller. In ihren Ohren sirrte ein hohes, atonales Singen.
„Näher“, flüsterte sie heiser.
Er kam noch einen Schritt näher, und Hanna machte eine wütende Bewegung mit dem rechten Handgelenk. Das Gewicht des Brieföffners glitt in ihre Hand.
„Hier“, schrie Hanna hysterisch und riss den Arm mit einer heftigen, ausholenden Geste hoch, um Ezechiel den Leib aufzuschlitzen, damit er blind und mit dampfend herausquellenden Gedärmen im Raum umhertorkeln sollte. Stattdessen brüllte er vor Lachen und warf das vor Heiterkeit gerötete Gesicht zurück.
„Aber meine Liebe!“
Hanna starrte auf ihre Hand. Sie war kaum überrascht, als sie darin statt des Brieföffners einen schlaffen, toten Fisch sah. Angewidert ließ sie ihn auf den Boden fallen, wo er anfing zu zappeln, während seine Kiemen hirnlos pumpten.
„Gib mir die Statue, Ezechiel. Dann sage ich dir, was sie mir gezeigt hat.“
„Du wirst dieses Ding nie wieder anrühren“, zischte Ezechiel. Alle Heiterkeit war von ihm abgefallen. „Du wirst es nie wieder anrühren. Es gehört mir. Und nun wirst du mir sagen, was es dir gezeigt hat.“ Ezechiel kicherte gluckernd wie fauliges Sumpfwasser. „Oh ja, das wirst du, wenn ich mit dir fertig bin.“
Und Hanna wusste, dass er Recht hatte.
Sie wirbelte so schnell herum, dass selbst der Dämon in Ezechiels Haut überrascht war. Mit einer seiner schwarzen Hände versuchte er sie festzuhalten, doch er bekam nur einen Zipfel ihres Kleides zu fassen, aus dem er einen Fetzen Stoff herausriss. Hanna lief zum Fenster.
„Wag es nicht!“, brüllte der Dämon hinter ihr, „wag das ja nicht!“
Hanna stieß sich mit den Füßen ab und prallte mit dem Kopf gegen die Scheibe. Ein dumpfes Klirren war zu hören, und ein Regen von erstaunlich dicken Glasscherben ging klimpernd auf den Teppich nieder. Die Wucht des Aufpralls hatte Hanna halb durch die Scheibe getragen, und dort hing sie nun, zuckend und blutend. Sie spürte Ezechiels Hände auf ihren Schultern. Wie lange würde er brauchen, um sie zum Reden zu bringen? Sie wusste, dass sie schwer verletzt war, vielleicht sogar tödlich, aber es ging nicht schnell genug.
Ezechiel riss sie zurück, und das letzte, was Hanna für Khorinis tun konnte, war, ihren Kopf ruckartig nach links werfen, wo sich eine fingerlange Glasscherbe in ihre Kehle bohrte. Ihr Körper wurde für einen Moment lang steif und ihre Füße trommelten einen kurzen, finalen Wirbel auf den Boden.
Ezechiel riss das blutige Bündel, das einmal Hanna gewesen war, gänzlich zurück in das Zimmer, doch sie war bereits tot. Ihr Körper lag auf dem mit Glasscherben übersäten Boden, und Ezechiel brüllte vor Wut und trat nach ihr, und die schlaffen, nachgiebigen Bewegungen des Leichnams machten ihn noch wütender. Brüllend und knurrend trat er weiter auf Hannas Körper ein, doch es nützte nichts mehr.
Ezechiel erlahmte in seiner Bewegung. Er stand reglos mitten im Raum. Hannas Blut hatte den Teppich und die Wände besudelt. Ezechiel starrte durch das blutige Loch in der Fensterscheibe nach draußen. Seine Züge wurden schlaff und leer.
Die Ratte warf einen letzten Blick auf die blutige Schweinerei am Boden, dann huschte sie zur Tür, die sich einen Spalt breit öffnete, und schlüpfte hinaus ins Freie.
Zwischenspiel: Zum ewig währenden Ruhm unseres Herrn Innos und zu Ehren unseres weisen und gerechten Königs
Die Sonne schien warm auf die gepflasterten Straßen der Hafenstadt, die Gassen lachten. Die Blaskapelle von Khorinis spielte zu Ehren König Rhobars auf. Ein Losverkäufer gab sich redlich Mühe, den bei der Wintertombola liegengebliebenen Wanderstab aus varantinischem Palmgehölz als den begehrtesten Hauptgewinn des Jahres anzupreisen und die Leute glaubten ihm gern. Auf dem Marktplatz besang der Chor Frohsinn wie jedes Jahr die ersten Feuerblüten. Das harzige Aroma glimmender Holzkohle verschmolz mit dem Duft süßen Mosts und sauren Weins zu jenem Bouquet, das dem Feuerblütenfest eigen war. In den frühen Morgenstunden würde dem ernüchternden Hauch von verschüttetem Bier weichen müssen.
Kinder ließen Feuerblüten aus dünnem, rotem Papier mit einem kleinen, brennenden Talgplättchen darin in den Himmel steigen und störten das allgemeine fröhliche Johlen nur gelegentlich mit ein paar Tränen über eine heruntergefallene Waffel.
Zur Mittagsstunde begannen sie Silberglöckchen am Adanostempel zu läuten, erst leise und verträumt, dann immer lauter und drängender, bis sich das Volk auf dem Vorplatz sammelte. Als endlich gespannte Ruhe eingekehrt war, trat Larius, Statthalter von Khorinis von Rhobars Gnaden, auf eine kleine, aus Brettern zusammengezimmerte Bühne. Er hatte die schwere goldene Statthalterkette und den prächtigen Mantel aus schwerem Purpurstoff mit Pelzbesatz angelegt, den er nur an hohen Feiertagen trug, und sein gerötetes Gesicht verriet, dass er sich damit in der Mittagssonne nicht besonders wohl fühlte.
In den vorderen Reihen erhob sich ein leises Flüstern, vereinzelt war Kichern zu hören.
„Ihr guten Bürger von Khorinis, werte Gäste, meine lieben Frauen und Kinder, zum einhundertachtundzwanzigsten Male gibt sich die Hafenstadt die Ehre, das Feuerblütenfest…“
Das Tuscheln breitete sich in der Menge aus, einzelne Stimmen lachten auf, andere ließen Laute des Abscheus vernehmen.
„… das Feuerblütenfest zum ewig währenden Ruhm unseres Herrn Innos und zu Ehren unseres weisen und gerechten Königs…“ Schweiß rann in Strömen über Larius‘ Gesicht, das mittlerweile in einem ähnlichen Purpurton leuchtete wie sein Mantel. „…unseres weisen und gerechten Königs, die ihre schützende Hand für immerdar über diese unsere Stadt…“
Das Tuscheln hatte sich zu allgemeinem Raunen gesteigert, Johlen und missbilligende Rufe mischten sich unter die Stimmen. Einzelne Finger aus der Menge zeigten auf Larius, genauer auf seine linke Schulter.
Eine gellende Kinderstimme, scharf wie eine Glasscherbe, bohrte sich durch das Murmeln: „Mama, warum sitzt da eine Ratte auf Larius‘ Schulter?“
Kapitel 13: Silbernebel
Sein Geist schwebte über Khorinis. Er sah sie alle, seine Lämmer, seine Diener und, oh ja, auch seine Widersacher. Er hatte sie gerufen und versammelt, und, dumm wie sie waren, waren sie ihm gefolgt. Es war soweit. Die Frauen, die sich versucht hatten, ihm in den Weg zu stellen, die ärgerliche Innosstatue, die ihr lächerliches kleines Geheimnis nicht preisgeben wollte – das alles zählte nun nicht mehr. Seine Diener und seine Lämmer warteten auf den letzten Schritt. Er sah sie genau durch die Augen der Ratte, ihre Gesichter, ihre Herzen, ihre Seelen. Sie waren so zerbrechlich, ihr Leben erlosch so schnell und leicht, dass es ihn immer wieder aufs Neue verwunderte, dass etwas so Kurzlebiges überhaupt existieren konnte. Aber in erster Linie waren sie köstlich.
Krushak kicherte.
Dann hauchte er seinen tödlichen Atem aus dem zierlichen Maul der Ratte.
Eine feiner, silbrig glänzender Nebel legte sich über den Platz vor dem Adanostempel, über den Marktplatz, über die Straßen und Gassen des Händlerviertels, schwappte hinunter zum Hafen, kroch die Stufen hinauf zum oberen Viertel…
Die Menschen standen mit offenen Mündern da und starrten auf Larius, auf die Ratte und auf den Nebel, der zu ihnen hinüberwehte, fein und dünn wie Spinnenweben. Kinder versuchten, die glitzernden Staubkörnchen zu fangen, die um sie herumwirbelten. Einige lachten, einige schrien, einige versuchten zu fliehen, andere blieben wie erstarrt stehen. Es spielte keine Rolle, was sie taten, der Fluch hatte jeden einzelnen Menschen erfasst, der sich in der Hafenstadt aufhielt. Es war vollbracht. Und es war so einfach gewesen. Noch bevor es Nacht wurde, würden sie alle, alle seine Diener sein. Keiner der Drei hatte ihn aufhalten können oder es auch nur versucht. Krushak frohlockte.
Nun musste er sich nur noch um das Kloster kümmern.
Dort gab es noch eine Handvoll Magier und Novizen, die darauf warteten, seine Diener zu werden, und es gab noch die unangenehme Alte, die ihm seinen vorzüglichen Wirt Daron geraubt hatte. Mit ihr musste er noch abrechnen, und ebenso hatte er das Bedürfnis, sich der jungen Frau zu entledigen, die ihm das ganze Ärgernis mit der Statue eingebrockt hatte. Letztlich schien das Ding keine Gefahr darzustellen, aber Krushak würde es im Auge behalten. Die ebenso vermessene wie närrische Frau, die sie ihm hatte wegnehmen wollen, hatte Angst gehabt, die Statue könne wieder ins Kloster gelangen, also schien ihm das Kloster genau der richtige Aufbewahrungsort für das dumme Ding zu sein. Er würde sie in einer Zelle einschließen und, nun, im Auge behalten.
Er fuhr zurück in Ezechiels Körper und erfüllte dessen Geist. Der Alte stand immer noch in der Lache gerinnenden Blutes, das aus Hannas Kehle gesprudelt war. Seine Augen öffneten sich. Er trat noch einmal mit aller Kraft gegen den Leichnam, so dass er in die andere Ecke des Raumes flog und dort, blutig und zusammengekrümmt, liegenblieb.
Dann machte er sich auf den Weg.
Zwischenspiel: Der Fluch
Nachdem der Mann endlich gestorben war und der Geruch seines verbrannten Fleisches sich im auffrischenden Seewind verloren hatte, gingen Jake, Manoy, Sam und Miranda zur Hütte zurück. Manoy und Sam liefen voraus, Miranda und Jake gingen Hand in Hand hinter ihnen her. Miranda gab keinen Laut von sich, aber im Licht des Halbmonds sah Jake das schwache Schimmern stummer Tränen auf ihrem Gesicht. Außer dem Knirschen des Sandes unter ihren Füßen und dem Rauschen der Brandung war nichts zu hören.
Manoy und Sam hatten den Kamm der Sanddüne bereits überschritten und waren nicht mehr zu sehen. Jake blieb stehen und blickte noch einmal zum Meer... zum Meer und zum Strand. Obwohl er geglaubt hatte, den Anblick nicht ertragen zu können, verlor sich Jakes Blick in der donnernden nächtlichen Brandung, die graue Schaumwolken vor sich hertrieb. Im Mondlicht sahen die Wogen wie schwarzes, schaumiges Glas aus.
Miranda hatte sein Innehalten bemerkt und sah ihn fragend an. Der Wind hatte die Tränen auf ihren Wangen getrocknet. Jake war froh darüber.
„Willst du noch einmal zurückgehen?” fragte sie mit dünner Stimme.
Jake sah sie erschrocken an.
„Ich glaube, ich will es. Nein, ich muss“, fuhr sie fort, ohne ihn anzusehen. Ihr Blick war auf den schweigenden Strand geheftet.
Jack dachte daran, dass er sich vor wenigen Augenblicken noch sicher gewesen war, nicht einmal den Anblick des weißen Sandes im Mondlicht ertragen zu können. Und er dachte daran, was Manoy gesagt hatte.
Wir müssen dem Gott des Strandes ein Opfer darbringen, damit er uns vor diesem Fluch beschützt.
Jack war sich nicht sicher, ob es überhaupt etwas gab, das sie vor diesem Fluch beschützen konnte.
Trotzdem nickte er und setzte sich in Bewegung. Miranda folgte ihm. Beide schwiegen, als sie den sanften Hügel hinabliefen. Sie lauschten nur der Brandung, die den Strand hinaufrollte und wieder zurückfloss. Der Sand war warm unter ihren Füßen. Jake fragte sich, wie lange es noch so sein würde. In wenigen Wochen würde die erste Herbstkühle aufkommen. Ein Bild entstand plötzlich vor seinem inneren Auge, das ihm zusammenhangslos und trotzdem richtig vorkam. Ein Zimmer, verlassen und leer bis auf ein Bett und ein Regal voller staubiger Bücher. Über allem lag das fahle Licht der entkräfteten Wintersonne, die sinnlose Fensterrahmenmuster auf den Boden zeichnete.
Die Vorstellung war so eindringlich, dass er unwillkürlich erschauerte.
„Dort hinten. Kannst du es sehen?” Mirandas Stimme klang spröde wie splitterndes Glas. Jakes Blick folgte ihrer ausgestreckten Hand. Zuerst sah er nichts als ruhelose, rollende Wellenbuckel, die von zarten Schaumkränzen bedeckt waren. Das Donnern der Brecher hier unten war überwältigend, so als stünde man inmitten eines Gewitters. Dann sah er es. Ein großer, dunkler Fleck im reinen Weiß des Sandes. Jake hätte ihn für einen Schatten halten können. Bei Innos, Jake wünschte, es wäre ein Schatten. Doch er wusste es besser.
„Das war ein Feuer, was?“ Manoy trat aus dem Dunkel hinter ihnen. Er lachte, und seine Zähne blitzten im Mondlicht. Miranda sah ihn einen Augenblick lang unverwandt an, dann blickte sie wieder auf den schwarzen Flecken im Sand.
„Meint ihr, er ist den ganzen Weg von Khorinis hergekommen, wie er es erzählt hat?“, fuhr Manoy fort, als Jake und Miranda schwiegen.
„Weiß ich nicht“, antwortete Jake. Er wusste auch nicht, was das überhaupt für einen Unterschied gemacht hätte. Der Mann war halb bewusstlos und delirierend gewesen, als sie ihn gefunden hatten. Mit letzter Kraft war er durch den Sand gestolpert, gestürzt, hatte sich immer wieder aufgerappelt. Schließlich war er röchelnd liegen geblieben. Manoy hatte gelacht.
Der Mann war im Endstadium dessen gewesen, was Manoy den Fluch nannte. Sein Haar war in Büscheln ausgefallen, so dass man sehen konnte, wie sich die faulende Kopfhaut in Streifen von seinem Schädel löste. Seine Arme, die aus den Fetzen eines Leinenhemdes ragten, waren von offenen Schwären bedeckt. Um seinen Hals hing eine schwere Kette aus riesigen goldenen Gliedern. Aus der schwarzen Kraterlandschaft seines Gesichts hatte ein einzelnes Auge mit fürchterlicher, jämmerlicher Intelligenz hervorgestarrt. Er war am Ende gewesen, aber noch ein Mensch. Noch…
Es war Manoys Idee gewesen, ihn zu verbrennen. Er hatte Sam, Jake und Miranda durchdringend angestarrt und von den Geistern des Strandes geredet, die sie beschützen würden, wenn man ihnen ein Opfer darbrachte. Jake hatte das anfangs für ein Spiel gehalten, ein ekelhaftes und aus dem Wahnsinn geborenes, aber doch ein Spiel. Keiner von ihnen glaubte an den Gott des Strandes, doch während sie unschlüssig um den Mann herumstanden, der im schimmernden Sand lag, war ihr Reden plötzlich ernsthafter geworden. Es war etwas Neues gewesen, eine Abwechslung…ein Spiel. Nur ein Spiel. Am Ende hatten sie aufgehört zu reden.
Sie hatten den Mann, der leise vor sich hingemurmelt hatte, er käme aus Khorinis und suchte einen Mann namens Daron, mit Sams Gürtel gefesselt. Dann hatten sie Treibholz gesammelt. Jake war sich dabei vorgekommen wie ein Kind bei einer neuen Art von Versteckspiel. Das Blut hatte in seinen Ohren gerauscht und sogar das Donnern der Brandung übertönt.
Während Jake die unregelmäßigen, tintenschwarzen Ränder des Fleckes betrachtete, musste er daran denken, dass das Spiel Miranda gefallen hatte. Als sie die Senke jenseits der niedrigen Buschreihen nach abgestorbenen Ästen durchstöberten, hatte sie sich ihm entgegengedrängt und ihn geküsst.
Schließlich hatten sie das Treibholz und die Zweige um den Mann herum aufgeschichtet. Manoy hatte ein wirres Gebet zum Gott des Strandes gesprochen, den er mit dem albernen Namen Krushak benannte, und diesmal hatten sie alle gelacht. Sam hatte das Holz angezündet, und sofort waren Flammen hochgelodert. Erst ganz am Ende, als die erbärmlichen Reste seiner Haare bereits Feuer gefangen hatten, hatte der Mann zu schreien begonnen. Da hing der Geruch von verbranntem Fleisch bereits schwer und süß über dem Strand.
„Ich gehe da runter“, flüsterte Miranda und setzte sich in Bewegung. Sie strauchelte, fand aber das Gleichgewicht wieder, bevor sie in den Sand stürzen konnte.
Jake und Manoy sahen ihr nach. Ihre Gestalt hob sich deutlich vom bleich schimmernden Sand ab.
„Jetzt habe ich es“, sagte Manoy plötzlich. Es klang wie das Brechen eines trockenen Astes.
Jake starrte ihn entsetzt an.
„Du hast…es? Bist du sicher?“
Manoy sagte nichts, sondern knöpfte sein Hemd auf. Er drehte sich ein wenig, so dass das fahle Licht die Haut über seinem Jochbogen erhellte. Ein grässlicher, dunkler Fleck zeichnete sich auf Manoys blassem Brustkorb ab. Die Haut war an dieser Stelle von einem dunklen Purpur, beinahe schwarz und löste sich von dem darunterliegenden Fleisch. Ein schwacher Geruch von Verwesung stieg Jake in die Nase.
„Krushak hat mich nicht beschützen können”, sagte Manoy. "Oder wollen."
Jake starrte weiter auf die beginnende Fäulnis. Wenn Manoy es hatte, dann konnte das bedeuten, dass sie alle…
„Dabei fühle ich mich gar nicht so schlecht“, fuhr Manoy fort. Dann, zusammenhangslos: „Wahrscheinlich haben wir ihm einen Gefallen getan. Ich glaube, er wusste nicht einmal, was mit ihm geschah.“
„Er wusste es.”
Manoy zuckte die Achseln und sah zum Mond.
“Ist auch egal.” Er machte eine Pause. Dann sagte er: “Möglich, dass wir die letzten Menschen auf Khorinis sind.”
Im Mondlicht sah er beinahe wie tot aus, fand Jake. Wenn Manoy den Fluch hatte, dann konnte das bedeuten, dass sie alle…
Sie sahen hinab in die Brandung, die unaufhörlich rauschte. Bald würde sie den höchsten Punkt erreicht haben. Plötzlich war sich Jake sicher, dass sie alle bald nach Khorinis zurückkehren würden.
Kapitel 14: Totenwache
Cassia starrte auf Darons Leichnam, der immer noch vor dem Altar lag. Das Blut, das aus seinem durchbohrten Schädel ausgetreten war, war zu einer dicken, klebrigen Suppe geronnen, die seinen Kopf wie ein dunkler Heiligenschein umgab. Dem Stand der Sonne nach zu urteilen, die durch die Buntglasfenster der Kathedrale fiel, musste es mittlerweile Nachmittag sein. Cassia kam es vor, als würde sie bereits Jahre, Jahrhunderte, auf ihrer harten hölzernen Bank sitzen und Darons Leiche anstarren.
Es war niemand gekommen, sie bei ihrer Totenwache abzulösen, kein Magier, kein Novize. Sie schienen die Abwesenheit Darons noch gar nicht bemerkt zu haben.
Der schwarze Felsen auf dem Altar schimmerte düster vor sich hin, als wäre er selbst in einen Dämmerschlaf gefallen. Ein Sonnenstrahl brach sich auf seiner glatten Oberfläche, und Cassia schien es, als würde ihr der Stein boshaft zuzwinkern.
Mutter Ignatia hatte die vergangenen Stunden tief ins Gebet versunken verbracht, nun hatte sie sich erhoben und trat neben Cassia.
„Er kann hier nicht liegenbleiben“, sagte Ignatia und zeigte auf Daron. „Hilf mir, ihn wegzuschaffen.“
Cassia schüttelte nur stumm den Kopf. Es war ihr unmöglich, aufzustehen und den blutigen Körper dort auf dem Boden zu berühren.
Ignatia funkelte sie wütend an. „Wie kannst du es wagen, mir nicht zu gehorchen?“ Sie machte einen drohenden Schritt auf Cassia zu. Cassia wandte ihr nicht einmal ihren Blick zu. Sie wusste, dass Ignatia sie nicht am Leben lassen würde. Aber sie würde sie nicht zwingen, dieses Ding anzurühren. Ignatia hob ihren Rohrstock, ließ ihn aber wieder sinken. Sie schnaubte verächtlich. „Wenn das der Dank für all die Jahre ist…“
Sie schwieg kurz, dann fuhr sie fort: „Wir werden seinen Tod nicht lange verbergen können. Jetzt, da der Dämon wieder in seinem Stein gebannt ist, werden wir die übrigen Magier darüber unterrichten. Sie werden dafür sorgen, dass unser guter alter Daron hier eine würdige Bestattung erhält.“
Ich werde damit Vorlieb nehmen müssen, im Klostergarten verscharrt zu werden, wenn du mit mir fertig bist, dachte Cassia bitter.
„Glaubst du, die Feuermagier werden dir den Mord an Daron durchgehen lassen?“, fragte sie tonlos.
Mutter Ignatia durchbohrte sie mit ihrem Blick.
„Es war kein Mord. Hast du denn gar nichts verstanden? Er war besessen…“
„Und der einzige Beweis, den du dafür hast, ist dieser schmutzige Steinklumpen da drüben?“
Ignatias Gesicht verzerrte sich vor Wut.
Cassia sah Ignatia ins Gesicht. „Du hast mit einer versteckten Klinge in deinem Rohrstock den obersten Magier der Heiligen Flamme ermordet. Sein Blut klebt an deinem Stock, sein Blut ist auf deinem Gewand. In einem ordentlichen Prozess vor der Heiligen Flamme in Vengard wirst du sicherlich genügend schützende Hände über dir haben. Aber hier?“ Cassia musterte Ignatia von oben bis unten. „Die Bürger von Khorinis werden dich schlicht in Stücke reißen, bevor du die Insel verlassen kannst. Sie haben Daron geliebt. Die übrigen Magier… sie werden dich sicher nicht beschützen.“ Cassia beugte sich ein wenig vor und flüsterte: „Unter uns, du bist nicht gerade die beliebteste Frau der Insel.“
Ignatias Gesicht war dunkelrot angelaufen. „Wie kannst du es wagen, mir zu drohen? Wie kannst du es wagen, du kleines Miststück, du kleine…“
Cassia lächelte matt. „Du brauchst einen Zeugen, der gesehen hat, was mit Daron passiert ist; einen Zeugen, der bei den Dreien beschwört, dass du nicht nur die übrigen Magier und Novizen, sondern ganz Khorinis vor dem sicheren Ende gerettet hast.“
Ignatia verzog die Lippen zu einem grimmigen Lächeln. „Du bist ein Miststück, aber ein schlaues Miststück. Wenn du außerhalb dieser Mauern auch nur ein Wort über das verlierst, was vorgefallen ist, werde ich dich kriegen, noch bevor du ein letztes Gebet an unser aller Herrn Innos schicken kannst. Hast du das verstanden?“
Cassia nickte müde. Sie verspürte nicht das geringste Bedürfnis, über die Dinge zu sprechen, die seit jenem Besuch auf Ezechiels Hof geschehen waren, weder innerhalb noch außerhalb der Klostermauern.
„Wir werden die Magier sofort aufsuchen. Ich werde ihnen von dem schrecklichen Unglück unseres armen Daron berichten, und du wirst bezeugen, dass jedes meiner Worte wahr ist. Dann werden wir zuerst ihn bestatten…“ – sie wies mit ihrem Rohrstock auf den toten Daron – „…und dann ihn.“ Sie zeigte voller Abscheu auf den schwarzen Stein. „Wir werden ihn im See versenken, der das Kloster umgibt und ihn mit einem Zauber für immer dort unten in der Tiefe bannen. Er wird es nie wieder wagen, Innos‘ Herrschaft über diese Welt in Frage zu stellen.“ Ignatia fasste Cassia am Oberarm und zog sie auf die Füße.
Als sie aus der Kathedrale ins Freie traten, schien der Innenhof des Klosters ein Ort des Friedens und der Stille zu sein. Das gepflegte Gras wogte versonnen im leichten Wind, der von der ruhigen See heranwehte, und einige Zikaden sangen ihr schwermütiges Lied. Irgendeine Tür quietschte verträumt in den Angeln, von irgendwoher erklang das leise, heitere Plätschern eines Springbrunnens. Es war so still, dass man das Herabfallen der Blütenblätter des Blumenschmucks am Portal der Kathedrale hören konnte, eine Stille, so tief und weit wie der Frühherbst, der bald über die Insel kommen würde. Sie wog schwer wie ein großer, vom Meer glatt geschliffener Stein. Die Hitze des Tages senkte sich wie ein weißes Leintuch über den Platz und hüllte die steinerne Masse der gewaltigen Kirche mitsamt ihrer prächtigen Innosstatue ein.
Niemand war zu sehen. Leichte Übelkeit stieg in Cassia auf.
„Wo sind die anderen Magier?“, fragte sie.
„Zu dieser Stunden halten sich die Novizen bei Meister Gorax auf und gehen ihm zur Hand. Die übrigen Magier werden bei Karras in der Bibliothek sein“, erwiderte Ignatia kühl, doch Cassia bemerkte sehr wohl die Unsicherheit unter dieser Kühle.
Sie überquerten den menschenleeren Hof. Mit einer energischen Bewegung stieß die hochehrwürdige Mutter die Tür zur Bibliothek auf. Ihre Augen brauchten einen Moment, um sich an das dämmrige Licht zu gewöhnen. Dann war es, als würde ein Vorhang zu beiden Seiten aufgezogen und gäbe den Blick auf ein Schauspiel frei, das Cassias schlimmsten Alpträumen entsprungen sein könnte.
Ein Mann stand im gelben Rechteck des Lichts, das die durch das Oberlicht fallende Sonne auf den Steinboden der Bibliothek zeichnete. Er trug die Prachtrobe eines Feuermagiers, die in düsterem Purpur zu glühen schien, und wandte ihnen den Rücken zu. Um ihn herum knieten und krochen Gestalten in Feuer- und Novizenroben. Um sie herum wirbelte ein feiner, silberner Staub durch die Luft, der sie in einen dünnen Schleier einhüllte. Eine der Gestalten am Boden hob den Kopf und sah in ihre Richtung.
Cassia konnte seine leeren Augen sehen, die blicklos ins Dunkel der Bibliothek starrten, seine wächsernen, eingefallenen Wangen - in einer klaffte ein Loch, so groß und ausgefranst, dass es aussah wie der Eingang zu einem Rattennest -, und die hohe Stirn des Mannes. Den Rest eines Gesichts machte das Spiel der Schatten unkenntlich.
Dann begann sich das Gesicht der Gestalt zu verändern. Es grinste. Ein dunkles Grinsen, aber gleichzeitig hatte es etwas schrecklich Vertrautes an sich, und Cassia spürte, wie der Kern ihrer geistigen Gesundheit, der ihrer Lage bisher mit bemerkenswerter Kraft standgehalten hatte, ins Wanken geriet. Die Gestalt drehte ihren Kopf weiter in Cassias Richtung. Aus tiefen, von Runzeln gesäumten Höhlen funkelten tückische, goldene Augen. Durch das Loch in seiner Wange konnte Cassia einen Wimpernschlag lang die glänzende Muskulatur seines Kiefers sehen. Seine Unterlippe, violett wie ein Stück Leber, hing schlaff herab und entblößte unregelmäßige, schwarze Schneidezähne.
Wie eine eiskalte Welle schlug Entsetzen über ihr zusammen. Meister Gorax, dachte sie.
Dann wandte sich die Gestalt in der Prachtrobe unendlich langsam zu Cassia und der hochehrwürdigen Mutter Ignatia um.
Ignatia kreischte, und Cassia hätte ihr am liebsten mit der Faust ins Gesicht geschlagen, um den Schrei, der sich wie ein gläserner Dorn in ihr Ohr bohrte, zum Verstummen zu bringen. Doch als sie sah, wer dort inmitten der kriechenden Gestalten stand, hätte sie ebenfalls geschrien, wenn sie in der Lage gewesen wäre, auch nur einen Laut von sich zu geben.
„Hallo, meine Lieben“, sagte Ezechiel und lächelte. Seine Augen waren tiefschwarz geworden, und goldene Funken tanzten darin.
Wenn Mutter Ignatia geglaubt hatte, den Dämon in seinen Stein verbannt zu haben, dann wurde sie in diesem Augenblick eines Besseren belehrt. Während Cassia noch mit betäubendem Entsetzen auf das Panorama der Hölle in der Mitte der Bibliothek starrte, sprang Ignatia mit wildem Kreischen auf Ezechiel zu. Mit einer fließenden Bewegung zückte sie ihre Stock, an dessen Ende die mit Darons Blut befleckte Klinge matt schimmerte.
„Bei der macht der Heiligen Flamme, ich befehle dir…“
Weiter kam sie nicht.
Aus dem Schatten der gewaltigen Bücherwände löste sich eine hünenhafte Gestalt in purpurner Robe, dessen rotglänzende Sehnen unter der verwesten Haut zu sehen waren. Cassia dachte daran, dass dieser Mann vor wenigen Tagen noch innosgefällige Choräle angestimmt hatte, und schauderte. Der Hüne in der Purpurrobe riss eine rostige Axt hoch, mit der ein Novize vor kurzem noch Feuerholz gehackt haben mochte, und schwang sie gegen Ignatia. Mit einem feuchten Knirschen grub sich die Axt in ihren Körper, dann zog der Magier sie wieder heraus. Ignatia ließ den Rohrstock fallen und blickte auf die Eingeweide, die aus der klaffenden Wunde hervorquollen. Ein nachdenklicher Ausdruck lag auf ihrem Gesicht, als begriffe sie gar nicht, was mit ihr geschehen war. Sie versuchte, ihre Gedärme mit blutigen Händen festzuhalten, aber dann fiel sie vornüber und landete mit ihrem Gesicht in der größer werdenden Lache ihres eigenen Blutes.
Cassia riss ihren Blick von der Hölle los, die sich vor ihren Augen aufgetan hatte.
Ezechiel blickte zufrieden auf die Äbtissin, deren Körper sich verkrampfte, während das Blut aus ihr herausströmte, dann sah er Cassia an.
„Nun, was machen wir mit dir, meine Liebe?“
Cassia sagte nichts. Es gab keine Antwort auf diese Frage.
„Möchtest du Jenna sehen? Sie ist hier, in Khorinis… es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie zu mir kommt.“
Cassia schüttelte den Kopf. Sie glaubte nicht, das sie jemals wieder irgendetwas sehen wollte.
Er kam näher an sie heran, streckte seine Hand aus und berührte Cassias Wange mit seinen glühend heißen Fingern.
„Nein?“, fragte er mit grotesk übertriebener Verwunderung. „Wird es kein Wiedersehen unter Schwestern geben?“
Er wartete einen Moment, ob sie etwas antworten würde, aber als sie es nicht tat, fuhr er fort:
„Geh!“
Cassia starrte Ezechiel verblüfft an.
„Ich soll… gehen?“
„Natürlich.“ Er grinste so breit, dass Cassia alle seine Zähne sehen konnte, und auch die Lücke, wo einst der Goldzahn gesessen hatte. „Geh nach Khorinis. Geh zu deinen Freunden. Ich habe eine kleine Überraschung für dich vorbereitet.“
Bevor Cassia etwas erwidern konnte, packten zwei der Gestalten in Novizenroben sie bei den Oberarmen und schleiften sie aus der Bibliothek ins Freie.
Kapitel 15: Göttliches Feuer
Cassia trat aus der Höhle, die ihr hier, auf der Diebesinsel, als Lager für nicht allzu leicht verkäufliche Beutestücke und Versteck für Zeiten diente, in denen die Milizen gereizt waren wie wütende Wespen, um noch einmal die Aussicht auf die im blauen Mittag schwebende Hafenstadt zu betrachten. Sie war rastlos und unruhig. Seit einigen Tagen nun waren sie hier, und Hanna war nicht gekommen. Sie wusste, dass mit Hanna – und mit ganz Khorinis – etwas Schreckliches geschehen war, schrecklicher als alles, was man sich vorstellen konnte. Aber sie dachte an das göttliche Feuer, das ihr die Statue gezeigt hatte. Es lag nicht mehr in Cassias Hand, sondern in den Händen Innos‘ oder gar denen ihrer Schwester Jenna, die ebenfalls ihre Rolle zu spielen hatte.
Cassia wusste nicht, dass in diesem Moment ein Strahl sanften Sonnenlichts durch ein Loch in dem bunten Fenster über Empore der Kathedrale des Klosters fiel, in der der Dämon mit seinen beiden Auserwählten stand, um endlich zu voller Macht zu gelangen. Sie sah nicht, wie sich winzige Staubkörner in diesem Lichtstrahl wiegten, eine heitere, ruhige Bewegung, und wie das Licht auf die Bruchstücke jener kristallenen Innosfigur fiel, die sie mit ihren Händen aus dem Sand ausgegraben hatte und die nun dort auf dem Altartuch lag.
Sie wusste nicht, dass der Lichtstrahl aussah wie ein Finger und sie sah nicht, dass sich in diesem Augenblick das Licht in dem klaren Bergkristall bündelte. Sie sah nicht den winzigen Funken, der auf dem weißen Tuch glomm, kaum zu erkennen, aber doch da, und sie sah nicht, wie Flammen an dem schwarzen Felsen hochzüngelten, genährt vom spröden Leinen des Altartuchs.
Göttliches Feuer
Sie hatte gerade noch Zeit sich zu fragen, wie lange es noch dauern würde , als sich vor ihren Augen ein riesiger Funken entzündete, als hätte ein hinter den Kulissen verborgener Gott ein Streichholz entfacht. Cassia zuckte vor der Helligkeit zurück, die wie ein einzelner breiter Blitz in den Himmel schoss. Unmittelbar darauf loderte der gesamte nordöstliche Himmel in einem stummen, grellen Rot auf. Ein blutiges Gleißen löschte die Umrisse der Gebäude aus. Für einen Augenblick waren sie wieder da, doch nur geisterhaft, wie durch ein seltsam geschliffenes Glas betrachtet. Danach waren sie verschwunden, für immer, und das Rot wucherte zu einer kochenden, brodelnden Gestalt. Alles still, ganz still.
Attila trat aus der Höhle und stellte sich neben sie. Er hielt sich schützend die Hand über die Augen. Schulter an Schulter starrten sie nach Norden, auf die sich ausbreitende, grellrote Wolke, die das Blau des Himmels verschlang. An den Rändern der Wolke stieg Rauch auf, der im Sonnenlicht ein bedrohliches Dunkelviolett angenommen hatte. Das Licht war hell, zu hell,
Ich werde mein Augenlicht verlieren
doch Cassia konnte den Blick nicht abwenden. Tränen liefen ihr in warmen Bächen über das Gesicht, doch sie konnte den Blick nicht abwenden.
„Was soll das?“, fragte Attila, „Das ist unmöglich.“
„Es ist das Ende von Khorinis“, erwiderte Cassia. Ihre Stimme schien von sehr weit weg zu kommen.
Aus der purpurfarbenen Wolke brachen gewaltige schwarze Blasen und ließen grässliche Formen erscheinen, deren Fratzen über dem hohen Himmel von Khorinis hingen. Alles still, ganz still.
Inzwischen waren auch die anderen aus der Höhle getreten, aber sie waren kaum mehr als Schatten.
Entweder hatte das Licht des Feuerballs Cassia die Sehkraft geraubt, oder die Wolke hatte die Sonnen verdunkelt. Vielleicht beides.
„Wenn es das wirklich wäre, dann müssten wir doch etwas davon hören…“, begann Attila, und in diesem Moment erreichte sie das Dröhnen wie ein Felsbrocken, der einen steilen, endlosen Abhang hinabschoss. Die Palmen erbebten, und Vögel spritzten in wirbelnden Scharen aus ihren Kronen. Das mahlende Grollen füllte alles aus, Cassias Ohren, ihren Verstand, die ganze Welt.
Die leuchtende Wolke hatte nun ihre größte Ausdehnung erreicht und waberte triumphierend dort, wo vor wenigen Augenblicken noch Khorinis war, eine endlose dunkelrote Flamme, die ein Loch in diesen Nachmittag und in alle künftigen Nachmittage gebrannt hatte. Eine Brise erhob sich, eine heiße Brise, und ließ Cassias Haar flattern. Cassia dachte daran, wie sich damals, als sie noch ein Kind gewesen war, die Sonne verdunkelt hatte, und sie dachte an ihre Schwester Jenna, und sie hoffte, dass sie dem, was von ihren Augen noch übrig war, würde beibringen können, nicht hinzusehen.
Geändert von El Toro (17.05.2017 um 21:01 Uhr)
 Berechtigungen
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
|







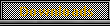



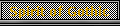










 World of Players
World of Players
 Wettbewerbsbeitrag von El Toro
Wettbewerbsbeitrag von El Toro









