-
 [Story]Glas
[Story]Glas
Glas
Diese Geschichte wurde im Rahmen des Wettbewerbs Schreim naoch Buchstohm 4 begonnen, aber leider nicht fertiggestellt.
Die Buchstabenzuordnungen finden sich hier:
Geändert von Laidoridas (23.09.2017 um 13:58 Uhr)
-
▨
Als die Erkaltung eingetreten war, hatte sie die Glasmacher fortgeschickt. Schweigend und mit gesenkten Köpfen waren sie gegangen, einer nach dem anderen, und der letzte von ihnen hatte die Tür hinter sich geschlossen. Miriam wartete, bis ihre Schritte verklungen waren, steckte den Schlüssel ins Schloss und drehte um. Sie wollte niemanden bei sich haben, nicht einmal Elias. Es gab niemanden auf der Insel, dem sie mehr vertraute, aber in diesen entscheidenden Augenblicken konnte er nur schaden. Sie wusste, dass sie die bessere Magierin war. Und sie wusste, was zu tun war.
Miriam ließ den Schlüssel stecken und kehrte zurück zu dem kreisrunden Tisch, den man aus dem schwarzen Fels der Insel gehauen hatte. Zurück zum Gestell aus schwarzem Draht, das die Glasmacher an der Tischplatte befestigt hatten. Und zurück zum Schwärzesten im Raum, zur Kugel. Wie eine zu groß geratene Perle kam sie ihr vor, wie sie gehalten von zwei dicken Drahtbügeln vor ihrem erhitzten Gesicht in der Luft schwebte. Ganz rein und ebenmäßig war die Oberfläche der Kugel, und ihr matter Sternenglanz schien aus einer weiten Ferne zu kommen. So betrachtet musste man den Eindruck gewinnen, es mit einem Material zu tun zu haben, das kein Blick durchdringen konnte. Miriam wusste es besser. Sie hatte jeden einzelnen Schritt der Herstellung überwacht. Alle Quarze hatte sie selbst gesiebt, obwohl sie bereits zuvor von den Glasmachern gesiebt und von Elias begutachtet worden waren. Sie hatte die Mischung eigenhändig vorgenommen und die Temperatur der Flamme geprüft. Und natürlich hatte sie den Kern geschaffen. Ganz allein und mitten in der Nacht hatte sie draußen auf der Klippe gesessen, wo sie besser denken und klarer schauen konnte als hier in der Werkstatt. Sie hatte das Messer genommen, gar nicht viel nachgedacht und auch kein Buch mehr zurate gezogen. Die Runen waren längst ein Teil von ihr geworden, und über das Messer waren sie aus ihr herausgeflossen.
Die Magierin hielt den Atem an, als sie glaubte, eine Unregelmäßigkeit in der Struktur des Glases ausgemacht zu haben, aber ihre nervösen Sinne hatten ihr einen Streich gespielt. Es war alles so perfekt, wie es sein musste. Sie streifte sich die dünnen, grauen Stoffhandschuhe über, ballte die Hände zweimal lockernd zu Fäusten und dann – kein Nachdenken mehr, kein Zaudern – griff sie nach der Kugel und hob sie aus dem Gestell. Schwer und wuchtig lag sie in Miriams Hand, und obwohl sie wusste, dass sich das Gewicht nur unwesentlich von dem der vorherigen Exemplare unterschied, fürchtete sie einen kurzen, lächerlichen Moment lang, dem Druck nicht standhalten zu können und die Kugel zu Boden fallen lassen zu müssen. Sie ließ dem Gedanken keinen Raum, hielt die Kugel umso fester und trat so nah an die Flamme heran, dass die Hitze den Schweiß von ihrer Stirn rinnen ließ. Vor dem Licht des Feuers verlor das Glas seine Undurchlässigkeit, und das Schwarz wurde zu einem nebligen, dunklen Grau. Aber der Blick durch diesen Nebel war ein trügerischer, denn was Miriam hinter ihm erkannte, war nichts als das Lodern der Flamme. Der Kern der Kugel verbarg sich vor dem Auge, und wer nicht bei der Fertigung dabei gewesen war, der hätte die Kugel für ein hohles, leeres Glasgefäß halten müssen.
Im Augenblick war sie genau das, dachte Miriam. Leer und hohl. So viele Kugeln waren leer und hohl geblieben, nicht bloß ein paar Sekunden lang, sondern dauerhaft. Alle waren sie so geblieben. Aber diese nicht.
Miriam fühlte, wie der Stoff ihrer Handschuhe feucht wurde vom Schweiß der dünnen Finger, aber sie zwang sich zur Konzentration. Die nächsten Sekunden waren die entscheidenden. Sie schloss die Augen und formte das erste Wort mit den Lippen, hielt es für eine Weile in der Starre, bevor sie es mit dem Atem in die Welt schickte. Ihre Stimme war klar und fest, und nachdem sie das zweite Wort gesprochen hatte, war auch das dritte nicht mehr weit. Eines folgte auf das andere, eines hitziger als das andere. Und mit dem letzten, kurzen Wort – ein Öffnen der Augen. Ein erster Blick.
▦
„Sie hat sicher schon angefangen, jetzt in diesem Augenblick versucht sie es wieder.“
Elias zog den Hocker unter dem Tisch hervor, ließ sich darauf nieder und fasste Klarissa bei der Hand. Sie war ganz kalt, und er musste seine andere Hand hinzunehmen, um sie aufzuwärmen.
„Sie ist sich wirklich sicher, dass es diesmal funktioniert. Wenn sie es schafft, dann bringe ich dir die Kugel, dann kannst du gleich als Zweite hineinschauen. Du kannst sie selber in der Hand halten und einen Blick hineinwerfen. Wir können auch zusammen hineinschauen, wenn du möchtest. Wenn du Angst hast.“
Jetzt sah er ihr zum ersten Mal ins Gesicht, seit er das Häuschen betreten hatte, und bemerkte die Strähne, die ihr vor das rechte Auge gefallen war. Vorsichtig löste er eine seiner Hände aus der Umklammerung und schob ihr die widerspenstigen Haare hinter das Ohr. Er erschauderte, als seine Finger die kühle Haut ihrer Wange streiften. Es war natürlich ein wohliger Schauder, und Elias wunderte sich jedes Mal darüber, dass er nicht schwächer wurde mit der Zeit.
„Aber ich glaube, du musst keine Angst haben“, sagte er leise, und Klarissa antwortete ihm mit einem Blinzeln. „Ich will noch nicht ganz glauben, dass wir es wirklich fertig bringen, aber wenn... wenn Miriam es wirklich schaffen sollte, jetzt in diesen Minuten... Ich weiß nicht, was es mit uns machen wird, Klarissa, aber ich glaube, es wird etwas Ungekanntes sein. Wir werden erfahren, was noch niemand vor uns erfahren hat. Vielleicht werden wir ein Verständnis entwickeln von den Dingen...“
Elias beendete den Satz in einem heiseren Murmeln, als er Klarissas trockene Lippen bemerkte. Es erschrak ihn, dass ihm diese Sprödigkeit erst jetzt ins Auge gesprungen war, und gleichzeitig machte es ihn zornig.
„Hast du gar nichts zu trinken bekommen? War Matilda denn nicht hier, hat sie dir nichts gebracht?“
Er sprang so heftig auf, dass er fürchtete, ihr einen Schrecken eingejagt zu haben, aber ihr Gesicht war so entspannt wie zuvor. Mit zittrigen Fingern öffnete er die Tür der Kommode und nahm eines der Gläser heraus, die darin standen: Allesamt schwarz, allesamt kunstvoll gefertigt, und allesamt beschädigt. Hier ein Sprung, dort ein Riss, alles Ausschussware. In diesem Moment ärgerte es ihn plötzlich wieder gewaltig, dass Klarissa aus solchen Gläsern trinken musste. Miriam mochte Recht damit haben, dass sie nichts zu verschenken hatten, dass sie alles verkaufen mussten, was sich verkaufen ließ. Aber es änderte nichts daran, dass Klarissa ein ordentliches Glas verdient gehabt hätte. Ein makelloses Glas, keine Ausschussware.
„Ich werde sofort mit Matilda reden, sobald sie alles aus dem Schiff geladen haben“, versprach Elias und füllte das Glas zur Hälfte mit lauwarmem Wasser aus der Karaffe. „Es ist ihre wichtigste Aufgabe, sich um dich zu sorgen. Und das weiß sie auch, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich ihr das sage. Es tut mir leid, Klarissa – Jetzt sitzt du hier stundenlang herum und wartest darauf, dass dir jemand etwas zu trinken gibt, und ich habe nichts Besseres zu tun, als auf dich einzureden! Du musst ja ganz ausgetrocknet sein... Hier, trink!“
Behutsam setzte er das Glas an ihre Lippen und zog den Unterkiefer mit der anderen Hand ein Stückchen herab, sodass sich ihr Mund öffnete. Leise gluckernd fand das Wasser seinen Weg in ihren Körper, und Elias’ Augen richteten sich unwillkürlich auf ihren Hals, auf ihren schluckenden Hals, der sich regte und so herrlich lebendig war, dass Elias sie am Liebsten mit einem ganzen Ozean gefüllt hätte. Aber das Glas war schon leer, und er löste es von ihren Lippen und stellte es auf der Kommode ab. Nachdem er Klarissas Mund geschlossen hatte, konnte er den Blick nicht gleich davon abwenden und tat etwas, das er schon seit einer Weile nicht mehr getan hatte. Er beugte sich vor und gab ihr einen Kuss.
Klarissa blinzelte. Er atmete aus und nahm wieder auf dem Hocker Platz, gleich gegenüber dem Sessel, in dem sie saß. Jeden Arm auf eine Armlehne gelehnt. Den Blick geradeaus gerichtet. Die schmalen Lippen nun wieder glänzend von der Feuchtigkeit des Wassers. Einen kleinen Tropfen im Mundwinkel, den Elias wegwischte, als er seiner gewahr wurde. Plötzlich fühlte er eine große Dankbarkeit dafür, dass sie noch immer bei ihm war.
„Vielleicht schafft Miriam es wirklich“, sagte er leise. „Vielleicht hältst du die Kugel gleich in deinen Händen und wir können hineinschauen, Klarissa. Hättest du gedacht, dass es einmal soweit kommen könnte? Dass wir tatsächlich an diesen Punkt gelangen?“
Draußen vor der Tür unterhielten sich ein paar Männer miteinander, Hauer vermutlich oder Matrosen. Elias konnte all diese Stimmen nicht gut auseinander halten, und es kümmerte ihn auch nicht.
„Weißt du, wir haben immer darüber nachgedacht, wie wir an diesen Punkt gelangen. Aber was, wenn wir erst einmal dort angelangt sind? Was, wenn es wirklich funktioniert, Klarissa? Wenn die Kugel funktioniert? Wir beide, wir beide und Miriam, wir könnten –“
Er hielt einen Moment inne.
„Nicht nur wir drei, wenn es nach Miriam geht“, sagte er zögerlich. „Wenn sie Erfolg hat, dann will sie Ruben Bescheid geben. Sie meint, Ruben hätte ein Recht – aber, ein dRecht? Wie lange hat er nichts von sich hören lassen, von den paar kurzen Briefen mal abgesehen? Was hat er schon dafür getan, dass wir so weit gekommen sind? Nichts hat er getan. Wenn er hier wäre, hier bei uns, dann hätte er ein Recht darauf, in die Kugel zu schauen. Aber er hat sich gegen uns entschieden. Versteh mich nicht falsch, ich mach ihm keinen Vorwurf. Er hat seinen eigenen Weg gefunden, und den kann er weitergehen. Soll Miriam ihre Briefe schicken, kommen wird er ja doch nicht.“
Seine Worte klangen bitterer, als er sie gemeint hatte, und es überkam ihn gleich ein schlechtes Gefühl, nachdem er sie ausgesprochen hatte. Ganz flüchtig blickte er hoch in Klarissas Gesicht und fragte sich, was sie von ihm denken mochte. Wünschte sie sich Ruben nicht genauso sehr zurück wie Miriam? Wünschte er selbst ihn sich nicht auch manchmal zurück? Ruben konnte ihnen zweifellos eine gewaltige Hilfe im Einsatz der Kugel sein, aber Elias glaubte nicht daran, dass Miriam ihn allein aus diesem Grund auf die Insel holen wollte. Vielleicht, musste auch Miriam hoffen, würde alles wieder so sein wie früher, wenn Ruben zu ihnen stieß. Aber gerade diese Hoffnung war es, die Elias Unbehagen bereitete. Denn auf der anderen Seite dieser Hoffnung stand eine viel wahrscheinlichere Gewissheit: dass es niemals mehr so sein konnte wie früher.
Es klopfte zweimal energisch an der Tür, und eine tiefe, kratzige Stimme vermeldete: „Alles umgeladen, Meister Elias!“ Und als nicht gleich eine Antwort kam, setzte die Stimme hinzu: „Kann ich Euch für ’ne Sekunde sprechen, Meister Elias?“
Seufzend erhob sich der Magier vom Hocker, schenkte Klarissa ein etwas unsicheres Lächeln und schloss dem Kapitän die Tür auf.
„Ah, dankeschön, Meister! Kann doch reinkommen, nicht wahr?“
Elias murmelte etwas Zustimmendes, was ihm reichlich überflüssig vorkam, da sein Gast ja längst eingetreten und die Tür hinter sich zugestoßen hatte.
„Eisiger Wind da draußen, schlimmer als auf’er See, sag ich Euch!“, krächzte Kapitän Hennes und lehnte sich schnaufend an die Kommode an. Elias hörte in Gedanken bereits das Glas klirren, aber glücklicherweise hatte es der Seefahrer um ein Haar mit dem rechten Arm verfehlt – ob aus Zufall oder geübter Präzision, das konnte Elias nicht sagen.
„Guten Tag auch, Fräulein Klarissa!“ Mit ernster Miene nickte Hennes der blassen Frau auf dem Sessel zu und zog schniefend die Nase hoch, bevor er sich wieder Elias zuwandte. „’Tschuldigt meine Manieren, Meister. Ist’n raues Klima hier auf Irdorath. Macht ein’n immer ’n bisschen barbarischer als man gern sein möchte, wisst’er?“
„Ach, wenn es weiter nichts ist als ein bisschen Husten und Schniefen“, sagte Elias mit einem Lächeln, zu dem er sich nur ein klein wenig zwingen musste. „Wir sind hier von den Quarzhauern ganz andere Sachen gewohnt, wie Ihr Euch denken könnt.“
„Tja, Ihr seid mir schon aus’m ordentlichen Stein geklöppelt, dass Ihr’s hier so lange aushaltet.“ Der Kapitän fuhr sich mit den vier Fingern seiner rechten Hand durch den struppigen grauen Bart und klopfte dann mit der Linken auf das knarzende Holz der Kommode. „Aber ich will Euch gar nich’ lange stören, Meister Elias. Wir haben Eure ganzen Glasgeschichten an Bord genommen, nix zu beanstanden. Die Kisten mit Gemüse und alles sind ausgeladen und gut verstaut, so gut’s eben geht in eurem kleinen Hüttchen, was Ihr so Lagerhaus nennt. Aber bei der Kälte könntet’er die Rüben eigentlich auch genauso gut draußen auf’m Boden lagern, ohne dass was schlecht würde. Wenn da nur nich’ der Regen wäre! Bin heilfroh wenn ich wieder weg bin von diesem fiesen Felsen hier, das sag ich Euch! Na, wir ha’m jedenfalls noch ’n paar Kisten mit den Gerätschaften rumstehen, die in die Werkstatt sollen. War zugeschlossen, also dachten wir –“
„Da wird gerade gearbeitet“, fiel ihm Elias in etwas zu scharfem Tonfall ins Wort. „Ihr könnt die Kisten einfach draußen abstellen, die Arbeiter holen sie später schon rein.“
„Ah.“ Hennes nickte ein bisschen vor sich hin. „Na klar, machen wir dann. Da wär noch was...“
„Ja?“ Elias runzelte die Stirn. Kam es ihm nur so vor, oder war der Seemann etwa verlegen?
„Ihr wisst ja, dass ich’s nur gut mit Euch meine, also nehmt’s bitte nicht persönlich. Aber’s war das letzte Mal, dass ich für Euch gefahren bin.“
„Wie bitte?“ Für einen Moment glaubte Elias tatsächlich, sich verhört zu haben, was ihm angesichts der nicht immer ganz deutlichen Aussprache des Kapitäns gar nicht so unwahrscheinlich vorkam. Der unbehagliche Blick in Hennes’ Augen sprach allerdings eine ganz andere Sprache.
„Wenn Ihr mit unserer derzeitigen Vereinbarung nicht zufrieden seid, dann können wir unsere Übereinkunft jederzeit neu verhandeln“, versicherte ihm der Magier rasch. „Ich verstehe natürlich, dass der Weg hierher mit einigen Strapazen verbunden ist und jede Fahrt ein Risiko darstellt, aber –“
„Ach, Risiko, papperlapapp“, brummte Hennes und winkte ab. „Bin schon ganz woanders hingefahren, da ist das hier gar nix gegen.“
„Aber was ist es dann?“, erwiderte Elias verständnislos. Er wusste ganz genau, dass Hennes an ihrer Zusammenarbeit prächtig verdiente, und zu keinem Zeitpunkt hatte er in den vergangenen Monaten das Gefühl gewonnen, dass der Kapitän die kleine Unannehmlichkeit einer Reise auf die Felseninsel nicht mit Freuden auf sich nahm, wenn er im Gegenzug das Handelsmonopol auf die Schwarzglaswaren besaß, die unter der Leitung der Magier auf Irdorath hergestellt wurden. Er würde lange suchen müssen, um noch einmal ein ähnlich gutes Geschäft zu machen, da war sich Elias sicher.
„Ihr wisst ja selber, dass es den hohen Tieren in Vengard nicht passt, was’er hier veranstaltet. Aber jetzt haben’se die Faxen wohl wirklich dicke. Vor nich’ ganz zwei Wochen hat einer der obersten Priester in der Kathedrale eine Predigt gehalten und die Leute vor allem gewarnt, was von Irdorath kommt. Und ganz besonders, nuja, vor Eurem schwarzen Glas. Alles verflucht und verhext und so’n Kappes, wegen dem Tempel hier oder was weiß ich. Ihr wisst ja selber, was die so erzählen. Ich geb’ da nix drauf, aber Ihr könnt Euch ja denken, dass sich das Zeug jetzt lange nicht mehr so gut verkauft wie vorher. Gibt eben genug, die dran glauben, oder die wenigstens denken: Könnte ja was dran sein, wer weiß? Kauf ich mal lieber das Glas aus Nordmar, auch wenn’s vielleicht nich’ so wirklich nach was aussieht! Besser’n hässliches Glas auf’m Tisch als’n Fluch an der Backe! Eher einmal zu viel auf Nummer Sicher –“
„Schon verstanden“, unterbrach ihn Elias ungehalten. „Wollt Ihr damit sagen, dass Ihr bloß wegen diesem lächerlichen Aberglauben unsere Waren nicht mehr an den Mann bringen könnt?“
Kapitän Hennes zog die Schultern hoch. „Wenigstens nicht mehr für’n ordentlichen Preis, nich’ in Myrtana. In Varant oder auf’n südlichen Inseln kümmert so’n Gerede die Leute bestimmt nicht, aber da fahr ich nicht hin. Sind nicht meine Gewässer, wisst’er? Und zu viele von meinen Männern wollen gar nich’ mehr hierher segeln. Hab’ sie nur dazu überredet gekriegt, weil ich ihnen versprochen habe, dass es das letzte Mal is’.“
Elias mahnte sich selbst zur Beherrschung und riss sich rechtzeitig zusammen, bevor ihm ein allzu gequältes Stöhnen entwich. Am meisten ärgerte er sich über seine eigene Dummheit. Es hatte sich schon vor Längerem angedeutet, dass die mächtige Händlergilde Araxos, die mit ihren Quarzbrüchen in Nordmar und den dortigen Glasschmelzen bislang die einzige Glasquelle im myrtanischen Raum gestellt hatte, die neu aufgekommene Konkurrenz nicht lange tolerieren würde. Aber nachdem es zuletzt still um die Gilde geworden war, hatte Elias auf ein friedliches Nebeneinander gehofft – wohl vergeblich, wie sich nun herausstellte. Es war weithin bekannt, dass sich der Einflussbereich der Händlergilde bis in das myrtanische Königshaus und die obersten Kreise der Innoskirche hinein erstreckte, und eben diesen Einfluss hatten die Händler nun offenbar geltend gemacht. Eine schwierige Aufgabe war diese Rufschädigung natürlich nicht gewesen, musste sich Elias zähneknirschend eingestehen. Wenn die feindliche Glasmanufaktur auf einer Insel stand, die vor nicht allzu langer Zeit als Hort des Bösen zu unrühmlicher Bekanntheit gelangt war, dann war keine besondere Kreativität vonnöten, um sich die passenden Sprüche dazu auszudenken. Aber es war ja nicht so, dass er und Miriam eine Wahl gehabt hätten – schwarzen Quarz gab es nun einmal nur auf Irdorath, soweit sie wussten, und eben jenes benötigten sie für die Herstellung der Kugeln, die Hauptgegenstände ihrer Forschung waren. Dass sich schwarzes Glas auch in Form von sehr ansehnlichen Krügen und Karaffen herstellen ließ, war dabei ihr großes Glück gewesen, das es überhaupt erst ermöglicht hatte, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Ohne die Umsätze aus dem Verkauf der Glaswaren war an einen weiteren Verbleib auf Irdorath jedenfalls nicht mehr lange zu denken. Und das ausgerechnet jetzt, da sie kurz davor standen, endlich das volle Potential ihrer Forschung zu erschließen!
„Also, hm“, druckste der Kapitän jetzt herum, nachdem Elias nichts mehr gesagt hatte. „Wenn Ihr wollt, kann ich Euch zurück mitnehmen nach Vengard, dann könnt’er selber schauen, ob Ihr’n neuen Händler findet. Liegen ja eigentlich immer’n paar aus’m Süden vor Anker, vielleicht ist da einer dabei. Ist’s beste Angebot, das ich Euch noch machen kann, so leid’s mir tut.“
Elias wusste Hennes’ Geste zwar zu schätzen, so recht darüber freuen konnte er sich jedoch nicht. So sehr ihm die feindliche Witterung auf Irdorath auch zu schaffen machte – das Letzte, worauf er jetzt Lust hatte, war eine Seereise und ein womöglich längerer Aufenthalt auf dem Festland. Er wollte nicht am anderen Ende des Ozeans auf die hoffnungslose Suche nach einem vertrauenswürdigen Südländer gehen, während Miriam womöglich Entdeckungen machte, die nicht bloß in die Geschichte eingehen, sondern sie gut und gerne auch auf das Einschneidendste verändern konnten. Und er wollte Klarissa nicht allein lassen. Er hatte ja selbst gesehen, wie sie schon nach wenigen Stunden unter Matildas Obhut verdorrte.
„Ich muss mich mit Meisterin Miriam darüber beraten“, antwortete Elias dem Kapitän, um sich der Entscheidung nicht sofort stellen zu müssen. „Wann legt Ihr ab?“
„Nich’ vor morgen früh.“ Hennes löste sich von der Kommode und warf Klarissa einen etwas bedrückten Blick zu, bevor er zur Tür herüberging. „Ihr könnt also noch ’ne Nacht drüber schlafen. Und das solltet Ihr auch machen. Also schlafen, mein ich. Seht ziemlich übermüdet aus, Meister. Zu viel über’n Büchern gebrütet, nehm ich an?“
„Möglich“, sagte Elias, der nun vollends jede Lust auf eine Fortsetzung des Gesprächs verloren hatte. „Wir sprechen uns, Kapitän.“
„So sieht’s aus. Gute Nacht, Meister.“ Er drückte dem Magier mit einem bedauernden Lächeln, das Elias nun wirklich nicht mehr ertragen konnte, den Arm, und drehte sich im Türrahmen noch einmal um. „Schlaft gut, Fräulein Klarissa. War nett, Euch mal wieder geseh’n zu haben.“
Noch eine ganze Weile, nachdem der Kapitän das Haus verlassen hatte, stand Elias wie verirrt im Raum herum und hörte dem Kaminfeuer beim Prasseln zu. Er war ohnehin schon seit dem frühen Morgen aufgewühlt gewesen, aber zu der Aufregung um das, was gerade in der Werkstatt geschehen mochte, hatte sich nun ein weiterer Quell der Unruhe gesellt, der ihm deutlich unangenehmer war. Plötzlich kam ihm Ruben wieder in den Sinn, und damit die Frage, wie er als Feuermagier wohl zu ihrer Unternehmung auf Irdorath stand. In seinen Briefen hatte er den Eindruck erwecken wollen, noch ganz der Alte zu sein, aber war das wirklich möglich nach all den Jahren, die er in der Gesellschaft der selbst ernannten Gottesdiener verbracht hatte? War er nicht längst einer von ihnen geworden? Die Veränderung war seinen Briefen durchaus anzumerken gewesen. Trotzdem stieß Elias den Gedanken, dass Ruben etwas mit den Hetzreden der Innospriester zu tun haben konnte, entschieden von sich. Er mochte ein Anderer geworden sein, ein Fremder vielleicht, aber mit Sicherheit kein Verräter.
Elias rieb sich die Schläfen und versuchte, den klaren Kopf zu gewinnen, der nun so dringend von Nöten war. Sein Blick wanderte zum Sessel hinüber. Klarissa konnte nichts aus der Ruhe bringen. Sie hatte die Kraft dazu, über alles in der vollständigsten Entspannung nachzusinnen. Als einzige besaß sie die Zeit zum ungetrübten Denken, das zur Weisheit führen musste. Zur Fähigkeit, stets die richtigen Entscheidungen zu treffen. Elias wünschte sich, die Antworten aus ihren Augen lesen zu können, aber das lag nicht in seiner Macht. Die Runen, auf die es ihm wirklich ankam, hatte noch kein Gott vom Himmel geschickt.
„Hab keine Angst.“ Er nahm wieder auf dem Hocker Platz und griff kurz nach Klarissas Hand, bevor er sie wieder losließ. Sie war schon wieder ganz kalt. „Ich lasse dich nicht allein. Es muss einen anderen Weg geben. Ich werde alles in Ruhe mit Miriam besprechen, und bestimmt werden wir –“
Er fuhr zusammen, als die Tür aufgerissen wurde. Sein Herz drückte in der Brust. In der ersten Sekunde glaubte er an eine Rückkehr des Kapitäns, aber der hätte geklopft. Es gab nur eine, die nicht klopfte.
Elias drehte den Kopf und erblickte Miriam. Ihr Blick, wie er ihn noch nicht gekannt hatte. Und in den Händen: die Kugel.
▥
Mit dem Gürtel fingen die Probleme immer an. Zunächst lag der schwere Stoff noch angenehm flauschig auf der Haut und der hohe Kragen umschmeichelte den Hals beinahe wie Samt. Aber das war bloß der erste Eindruck. Sobald der Gürtel um die Hüfte gelegt war und sich die Schnalle geschlossen hatte, zerrte es den Stoff am Rücken so stark nach unten, dass die breiten Schulterstreifen aus schwarzem Lurkerleder unangenehm gegen den Hals drückten und für ein ständiges Gefühl der Beklemmung sorgten. Zunächst hatte er den Gürtel ganz weglassen wollen, aber dann hatte er stets das Gefühl gehabt, einen zu groß geratenen Bademantel zu tragen, der bei jeder etwas zu impulsiven Bewegung abfallen wollte. Am liebsten natürlich hätte er überhaupt keine Robe getragen, aber es war ja unumgänglich. Als Feuermagier trug man eine Robe, daran ließ sich nichts ändern.
Was der alte Merdarion wohl denken würde, wenn er mich jetzt so sehen könnte, dachte Ruben, als er aus der selbst zu dieser späten Stunde noch überaus belebten Marktstraße in eine kleinere Gasse einbog, deren Name er nicht kannte und die vielleicht auch keinen hatte. Ja, Merdarion wäre mächtig stolz auf ihn gewesen, da war er sich sicher. Vielleicht hätte ihn das Rot ein bisschen gestört, aber wahrscheinlich nicht einmal das. Er hatte sich für ihn gewünscht, ein Magier zu werden, sein Potential auszunutzen, wie er immer gesagt hatte, und auf die Farbe war es ihm dabei sicher nicht angekommen. Erst recht nicht mehr in den späteren Jahren, als er ohnehin nicht mehr richtig sehen konnte und bloß noch Licht und Schatten voneinander zu trennen wusste.
Ein etwas wehmütiges Gefühl überkam ihn, als er an seinen alten Lehrmeister dachte, aber es wurde bald wieder vom Gefühl des Schmerzes verdrängt, das von seiner linken Schulter ausging. Die Umhängetasche war so schwer befüllt mit all den Büchern, die er aus der Bibliothek mitgenommen hatte, dass sich andere Leute bestimmt Sorgen gemacht hätten, sie könnte womöglich aus allen Nähten platzen – aber Ruben kannte ja seine Tasche, die hielt das schon aus. Bloß bei seiner Schulter war er sich da nicht so sicher. Aber er hatte es ja bald geschafft. Nur noch um die nächste Ecke, und...
Er sah den Mann erst, als er schon in ihn hineingerannt war. Es ratschte vernehmlich, und Ruben glaubte schon, dass der Riemen seiner Tasche nun doch noch nachgegeben hatte, aber es war der graue Mantel des anderen Mannes, der unter dem Zusammenstoß gelitten hatte. Leise klackernd kullerte ein abgerissener Knopf über den Boden, bis er zum Liegen kam.
„Tut mir leid“, versicherte Ruben hastig, während sich sein Gegenüber stöhnend wieder aufrichtete und sich dabei die Stirn rieb. „Ich habe Euch gar nicht kommen sehen –“
Er hielt mitten in der Entschuldigungsrede inne, als der Mann seinen Kopf hob und ihm ins Gesicht sah. Vor Verblüffung wusste Ruben für einen langen Moment überhaupt nichts zu sagen, was nicht besonders häufig vorkam – aber mit einem solchen Anblick hatte er als allerletztes gerechnet.
„Elias?“
„Na sowas, habe ich dich also doch noch getroffen“, murmelte Rubens alter Freund und klopfte sich den Staub von seinem Mantel, der allerdings allein durch seine Farbe schon so staubig wirkte, dass es kaum einen Unterschied machen konnte. „Ich habe ein paar Minuten vor deiner Tür gestanden, aber dann dachte ich mir, dass es wohl keinen Zweck hat.“
„Hatte es anscheinend doch“, erkannte Ruben. „Wenn du nicht ein bisschen gewartet hättest, dann wären wir uns jetzt vielleicht nicht begegnet.“
„Ihm hier wär’s lieber gewesen“, sagte Elias und hob den abgerissenen Knopf in die Höhe. Auch wenn er dabei lächelte – besonders herzlich wirkte dieses Lächeln nicht, dachte Ruben. Aber er konnte ihm doch unmöglich ernsthaft böse sein wegen des kleinen Zwischenfalls. Wegen eines abgerissenen Knopfs, nachdem sie sich so lange nicht gesehen hatten!
„Komm erstmal mit rein, dann schauen wir uns das mal an. Vielleicht kriegen wir den ja wieder dran geknotet, was meinst du?“
„Ja, schauen wir mal“, entgegnete Elias, und weil Ruben darauf nicht gleich etwas zu sagen wusste, setzte für ein paar Sekunden ein unangenehmes Schweigen ein, als sie sich in Bewegung setzten.
„Du hättest doch schreiben können, dass du vorbeikommst“, sagte Ruben dann. „Ich hätte vielleicht etwas Nettes zu essen vorbereitet oder so.“
„Ich wusste selbst nicht, dass ich komme, bis vor zwei Wochen.“ Elias räusperte sich ein bisschen, und Ruben kam nicht umhin, zu bemerken, dass er ganz schön alt aussah. Natürlich lange nicht so alt wie die meisten Magier, aber dennoch: die Wangen ausgemergelt, die Augen bleich, und das Haar längst nicht mehr so voll wie gewohnt. Irdorath hatte seine Spuren hinterlassen, zweifellos. Er fragte sich, wie Miriam sich wohl verändert haben mochte. Wie Klarissa jetzt aussah.
„Es gab Probleme mit dem Verkauf unserer Waren, aber das hat sich jetzt geklärt“, berichtete Elias in knappen Worten. „Jedenfalls musste ich deswegen eine Weile in Vengard bleiben. Aber morgen geht es wieder zurück.“
„Morgen schon?“ Offenbar hatte Elias erst bei der letzten Gelegenheit bei ihm aufgeschlagen. Ob ihm die Begegnung unangenehm war? Er wusste nicht ganz, welchen Reim er sich auf die merkwürdige Stimmung seines Freundes machen sollte.
„Ja“, erwiderte Elias, „es ist jetzt alles geregelt. Ich möchte die anderen nicht länger als nötig allein lassen.“
Sie hatten das Haus nun erreicht, und Ruben kramte den passenden Schlüssel aus einer der Robentaschen, um die Tür aufzuschließen. Das Zerren an seiner Schulter und das Drücken am Hals hatte er in den letzten Minuten kaum noch bemerkt, so sehr hatte das unerwartete Wiedersehen seine Gedanken beschäftigt, doch nun meldete sich beides noch einmal mit Nachdruck zurück.
„Komm rein“, sagte er, nachdem er die Tür aufgestoßen und die Tasche unter erleichtertem Ächzen auf dem Boden abgestellt hatte. „Warte, ich mache eben Licht.“
Er nahm eine der Kerzen, ging zum Kamin hinüber und entzündete sie an der Glut.
„So, das hätten wir. Du kannst deinen Mantel über einen Stuhl hängen, wenn du willst.“
Aber Elias wollte offenbar nicht. Er blieb neben der Tür stehen, durchwanderte mit den Augen den Raum und wendete den Knopf in der rechten Hand hin und her.
„Gemütliches Häuschen hast du hier“, kommentierte er. „Ich hätte ja gedacht, du wohnst inzwischen im Palast.“
„Da kannst du aber lange drauf warten.“ Ruben schloss die Tür und setzte sich auf die Tischkante. Er nestelte an der Gürtelschnalle herum, um sie etwas zu lockern, und hätte am liebsten gleich die ganze Robe ausgezogen – aber das kam ihm in Elias’ Anwesenheit nicht angebracht vor. „Mir reicht das voll und ganz, wenn ich die Priester und Prediger tagsüber ständig um mich habe, da will ich wenigstens abends meine Ruhe vor denen haben. Und der König mit seiner Sippschaft soll mich auch mal schön in Frieden lassen.“
„Das solltest du den Priestern und Predigern aber lieber nicht zu laut sagen, was?“ Elias musste schmunzeln, und zum ersten Mal fühlte sich Ruben ein bisschen an seinen alten Freund erinnert, wie er ihn kannte.
„Ach, und wenn schon. Die meisten von denen sind zu senil, um noch groß was mitzukriegen. Aber solange sie mir beibringen, was ich lernen will, soll’s mir egal sein.“
„Woran forschst du denn gerade?“, wollte Elias wissen. „Semi-elementare Wesenheiten?“
„Äh, was?“ Ruben fühlte sich ein bisschen von der Frage überrumpelt, aber dann wurde ihm bewusst, was Elias meinte. Das Band, das seine Tasche oben zuhielt, hatte sich ein wenig gelöst und den Blick auf das oberste Buch freigegeben. „Achso, ja, das ist bloß eines der Bücher, die ich mir für eine Arbeit ausgeliehen habe, die ich im Auftrag von Meister Talamon durchführen soll.“
„Talamon?“ Elias hob verblüfft eine Braue. „Meinst du den Talamon? Den von Khorinis?“
„Ja, natürlich. Mittlerweile ist er hier in Vengard“, erzählte Ruben, während er ein paar Bücher aus dem Beutel nahm und auf den Tisch legte. „Die Luft hier bekommt ihm besser als die auf Khorinis, hat er mal zu mir gemeint. Weißt du, er hat da so eine Theorie, nach der all diese Bücher hier einmal für ein paar Jahre in der Bibliothek des Klosters von Gamuth gestanden haben sollen. Vielleicht hast du schon davon gehört – das versunkene Kloster, von dem ein paar alte Legenden erzählen? Talamon hat eine ziemlich gut erhaltene Liste gefunden, auf der diese Titel aufgeführt waren, und er vermutet, dass es sich dabei um eine alte Bestandsliste aus der Bibliothek von Gamuth handeln könnte. Ich habe natürlich gleich meine Hilfe angeboten und mir alle Bücher von der Liste, die ich in unserer Bibliothek finden konnte, ausgeliehen – jetzt will ich mal schauen, ob ich da einen Hinweis finden kann. Wir hoffen darauf, dass in der Zeit, in der die Bücher in Gamuth waren, vielleicht Notizen oder Ergänzungen gemacht wurden, die uns nähere Informationen über das versunkene Kloster geben können. Wir wissen praktisch nichts darüber, da wäre jede Kleinigkeit eine Sensation. Aber Talamon ist ja schon alt, er ist für sowas nicht mehr der Richtige.“
„Da sagst du was“, murmelte Elias, nach wie vor sichtlich erstaunt. „Der war ja schon damals alt, als wir noch bei Merdarion waren.“
„Er muss bestimmt an die neunzig sein“, sagte Ruben und ordnete die Bücher in drei leidlich geraden Stapeln auf dem Tisch an. „Aber er ist immer noch wacher im Kopf als die ganzen Priester, die der König ständig um sich schart. Schade, dass du wohl keine Gelegenheit hast, ihn mal kennenzulernen.“
„Hmm“, machte Elias. Er wirkte jetzt gar nicht mehr so verstimmt, wie er Ruben zunächst noch vorgekommen war, vielmehr nachdenklich. „Ich wusste gar nicht, dass du an solchen Sachen dran bist. Dieses Gamuth... wenn wir da vor zehn Jahren was von gelesen hätten, in den Büchern vom alten Merdarion... wer weiß, dann wären wir jetzt vielleicht alle vier auf der Suche danach, was?“
„Tja, wer weiß.“ Ruben fühlte sich unangenehm berührt von den Worten seines Freundes. Er starrte ein bisschen auf seine von der Tischplatte baumelnden Beine hinab und sagte dann: „Und was machen eure Forschungen? Was Miriam zuletzt geschrieben hat, klang ja ganz vielversprechend.“
Der Blick in Elias’ Augen veränderte sich. Es war, als konnte ihm Ruben dabei zuschauen, wie er aus der Vergangenheit, aus einer anderen Vergangenheit vielleicht, in das Hier und Jetzt zurückkehrte.
„Deswegen wollte ich dich sprechen“, sagte Elias, als ob es für seinen Besuch einen besonderen Grund gebraucht hätte. „Wir haben es geschafft. Miriam hat es geschafft.“
Ruben sog zischend die Luft ein. „Ihr... habt es geschafft? Du meinst...?“
Elias nickte mit der feierlichen Ernsthaftigkeit, die einer solchen Botschaft gebührte. „Die Kugel ist vollendet, und sie funktioniert.“
„Dann war es wirklich der richtige Ansatz?“ Es hielt Ruben nun nicht mehr auf der Tischkante, und er rutschte zu Boden. „Schwarzes Glas?“
„Schwarzes Glas und ein Kern aus Xanit“, bestätigte Elias. „Du hast ja Miriams letzten Brief gelesen, wir waren uns schon seit Monaten sicher, dass es die richtige Kombination ist. Aber irgendetwas stimmte nie. Die Runen, der Erweckungszauber... und nach jedem Fehlschlag brauchten wir wieder ein paar Tage, um eine neue Kugel für den nächsten Versuch fertigzustellen. Bis Miriam vor zwei Wochen die richtige Idee hatte. Sie hat es tatsächlich geschafft, Ruben.“
„Und, habt ihr...“ Er war sich nicht sicher, ob er diese Frage wirklich stellen durfte, aber sie war zu drängend und zu offensichtlich, um nicht gestellt zu werden. „Habt ihr hineingesehen?“
„Miriam hat hineingesehen“, sagte Elias. „Wir werden Zeit brauchen, um den Umgang mit der Kugel zu erlernen. Sie ist ein völlig neuer Forschungsgegenstand, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist, ja, eine ganze Wissenschaft für sich. Wie eine neue Welt.“
Ruben hatte sich eine konkretere Antwort erhofft, aber er hatte das deutliche Gefühl, dass der grau gewandete Magier nichts Genaueres sagen wollte.
„Das ist wirklich... unglaublich“, sagte er, weil ihm keine besseren Worte einfielen. „Ihr habt es euch wirklich verdient, nach all den Jahren. Merdarion wäre bestimmt stolz auf euch.“
Elias lachte hart und plötzlich auf. „Merdarion würde es immer noch nicht glauben, und wenn er drei Tage lang am Stück in die Kugel schauen würde. Aber ich kann es ihm nicht verdenken. Ich habe ja selber nicht immer daran geglaubt.“
„Was habt ihr jetzt vor? Wollt ihr fort von Irdorath?“
Der Magier schüttelte den Kopf. „Auf keinen Fall. Unsere Forschung an der Kugel hat gerade erst begonnen, und ich schätze, dass es dafür nötig sein wird, dass wir weitere Exemplare herstellen. Außerdem hält es Miriam für zu gefährlich, die Kugel auf das Festland zu bringen. Sie ist ein bisschen eigen, was die Kugel angeht, und will sie nicht einmal für ein paar Sekunden ganz aus der Hand geben, aber ich denke, in diesem Fall sie hat recht. Sie darf auf keinen Fall in den Besitz der falschen Leute geraten. Wir können jetzt weniger von Irdorath fort als je zuvor.“
„Versteh schon. Ich dachte nur...“
„Aber das heißt nicht, dass du die Kugel nicht sehen kannst“, unterbrach ihn Elias. „Miriam glaubt, dass du uns von großer Hilfe dabei sein könntest, ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Und sie ist der Meinung, dass wir die Kugel nicht verwenden sollten, bis wir alle vier wieder vereint sind und gemeinsam hineinschauen können. Ich kann nicht behaupten, dass ich ihr da zustimme, aber so ist ist sie nun einmal.“
„Dass wir wieder vereint sind?“, wiederholte Ruben. „Heißt das...?“
„Sie möchte, dass du zu uns nach Irdorath kommst. Deshalb bin ich hier, Ruben... um dich mitzunehmen.“
Ruben hatte nicht mit diesem Angebot gerechnet, und es traf ihn so unvorbereitet, dass er mit den Fingern an der Tischkante nach Halt suchen musste. Er hatte sich völlig zurückgezogen, nur mal hier und da einen Brief beantwortet, und trotzdem wollten ihn seine Freunde, die in Wahrheit natürlich längst seine ehemaligen Freunde geworden waren, nach all den Jahren wieder in ihren Kreis aufnehmen – und das ausgerechnet im Moment ihres größten Triumphs?
„Puh... das ist...“
„Mir ist natürlich klar, dass du deine eigenen Verpflichtungen hast. Ich habe Miriam schon gesagt, dass es keinen Zweck hat, dich überhaupt zu fragen, aber sie hat darauf beanstanden, dass ich dir den Vorschlag mache. Aber diese Suche nach dem Kloster, wie hieß es noch gleich?“
„Gamuth.“
„Genau. Das ist eine aufregende Sache, an der du da dran bist, und ich möchte dich nicht aus deinem Leben reißen, das du dir hier aufgebaut hast. Du weißt, was der Orden über uns denkt. Deine Kirchenbrüder werden alles andere als begeistert sein, wenn sie davon erfahren, dass du zu uns nach Irdorath gefahren bist. Miriam möchte dich wirklich wiedersehen, und ich verstehe sie auch, aber wir können nicht von dir verlangen –“
„Vergiss die Kirchenbrüder und das Kloster.“ Ruben hatte einen Schritt nach vorne gemacht und Elias am Arm gefasst. „Natürlich komme ich zu euch nach Irdorath. Wie könnte ich mir so eine Gelegenheit entgehen lassen?“
Der Magier erstarrte für einen Moment vor Überraschung, dann erwiderte er die Geste, indem er den anderen Arm auf Rubens Schulter legte.
„Du solltest es dir noch einmal genau überlegen, bevor du so eine Entscheidung triffst. Unser Schiff legt noch heute Nacht ab, um dem Sturm zu entgehen, der aus dem Süden heranzieht. Viel Zeit bleibt dir also nicht mehr, aber sei dir bewusst, auf was du dich einlässt. Doch wenn du dich dazu entscheiden solltest, dann... dann würden wir uns natürlich alle freuen.“
„Ich bin mir sicher“, entschied Ruben. „Die anderen Feuermagier kommen auch eine Weile ohne mich aus, und Talamon wird es schon verkraften, wenn sich die Sache mit den Büchern noch ein paar Wochen hinzieht. Gib mir nur ein bisschen Zeit, dass ich eine Nachricht für ihn schreiben und meine Sachen packen dann.“
„Vielleicht solltest du lieber nicht dazu schreiben, wohin du gehst“, gab Elias zu bedenken. „Für die hohen Tiere in eurem Orden sind Miriam und ich schließlich schon beinahe so etwas wie Schwarzmagier.“
„Tja, es würde bestimmt helfen, wenn ihr euch ein bisschen farbenfroher anziehen würdet“, sagte Ruben grinsend. „Das was du da anhast sieht ja auch nun mal aus wie eine Schwarzmagierrobe, die ein bisschen zu heiß gewaschen wurde.“
„Unsere Roben hat doch noch keiner von denen je gesehen“, brummte Elias. „Dazu müssten sie ja überhaupt erstmal persönlich mit uns sprechen. Aber sollen sie doch denken, was sie wollen. Zum Glück bist du ja keiner von denen geworden, so viel habe ich schon gemerkt.“
Er klopfte Ruben zweimal auf die Schulter, dann hielt er ihm die andere Hand mit dem Knopf vors Gesicht.
„Aber den hier knotest du mir wieder dran, glaub nicht, dass ich das vergessen habe“, forderte er mit einer Ernsthaftigkeit, die so gut gespielt war, dass sie Ruben fast für voll nehmen wollte. „Während der Überfahrt hast du ja genug Zeit dafür.“
„Natürlich, wird erledigt!“, versprach Ruben.
„Das Schiff ist die Bak Shedim, ganz rechts am südlichen Pier. Und lass dir nicht zu viel Zeit, wir werden nicht lange auf dich warten können.“
„Keine Sorge, in spätestens einer Stunde bin ich dort.“
Elias hatte die Tür geöffnet, und Ruben begleitete ihn ein paar Schritte nach draußen. Ein langer Abschied war nicht vonnöten, und so war der Magier im grauen Mantel schon nach wenigen Sekunden vor dem nur unwesentlich dunkleren Grau des nächtlichen Vengard kaum noch auszumachen. Ruben hatte aber ohnehin nicht die Ruhe oder die Lust dazu, ihm lange nachzustarren. Er ging zurück ins Innere, schlug die Tür hinter sich zu und atmete kräftig aus. Bislang hatte er nie ein Problem damit gehabt, sich auf neue Situationen einzustellen, aber diesmal war es sogar für ihn ein bisschen zu viel auf einmal gewesen.
Die Kugel existierte also wirklich. Die Kugel, die als bloßes Hirngespinst in einem alten Schmöker geruht hatte, die er gewissermaßen angestoßen hatte und die nun ihren Weg hinausgefunden hatte in die Welt. Miriam und Elias hatten diese Kugel in die Welt gebracht, und er würde nach Irdorath reisen, um sie mit eigenen Augen zu sehen. Er war sich völlig im Klaren darüber, dass diese Kugel, wenn sie denn wirklich funktionierte wie gedacht, das mächtigste Artefakt der Welt sein musste. Wie hatte er da noch nachdenken können! Aber dennoch... er durfte nichts überstürzen, sagte er sich. Natürlich, es war zweifellos seine große Stärke, dass er es sich erlauben konnte, nicht mehr zu planen als unbedingt nötig, dass ihm immer noch etwas Rettendes einfiel im Notfall. Das versunkene Kloster von Gamuth!, schoss es ihm durch den Kopf, und er konnte nicht anders, als ein fassungsloses Grinsen aufzusetzen, während er noch einmal Revue passieren ließ, was er Elias da vorgesetzt hatte. Nicht zu glauben, dass er ihm das alles abgekauft hatte! Er musste wirklich überzeugend gewesen sein. Aber es war seine Schwäche, dass er sich manchmal zu sehr verließ auf diese Fähigkeit zur Improvisation, und er hatte das Gefühl, dass die Reise, die er jetzt vor sich hatte, jede Schwäche bestrafen würde. Er musste sichergehen, dass er alles so gut es ging durchdacht hatte, aber gleichzeitig war ihm klar, dass ihm genau dafür keine Zeit blieb, wenn er rechtzeitig auf dem Schiff sein wollte. Also würde er nachdenken müssen, während er alle Vorbereitungen für die Reise traf.
Die Robe wollte er ganz bestimmt nicht nach Irdorath mitnehmen, denn was würde sie ihm dort schon nützen? Sie würde bloß Distanz schaffen, die er nicht gebrauchen konnte. Was er brauchte, war bequeme Kleidung, die warm genug war, um das Klima auf Irdorath erträglich zu machen, aber gleichzeitig die Bewegungsfreiheit nicht zu sehr einschränkte. Er überlegte, in welcher seiner Kleidertruhen er wohl finden würde, was er suchte, entschied sich schließlich für eine der drei großen Eschenholztruhen neben dem Wandschrank und löste die erste Deckelschnalle.
Zur anderen Schnalle kam er nicht, denn zum zweiten Mal an diesem Abend wurde Ruben von lautem Klopfen aufgeschreckt. Aber diesmal war es anders – nicht so zaghaft und unentschlossen wie Elias’ Klopfen. Es war das Klopfen eines Mannes, der am Liebsten mit der Faust durchs Holz geschlagen hätte.
Das konnte nichts Gutes bedeuten, wusste Ruben. Entweder war es Morrison, der ihm die Sache mit dem dämlichen Einarmigen Harry immer noch nicht verziehen hatte, oder aber...
Im einen Moment hatte Ruben die Tür noch nervös angeguckt, im nächsten flog sie ihm auch schon um die Ohren. Entsetzt machte er einen Sprung nach hinten, als die Tür vor seinen Füßen auf dem Boden auftraf. Drei Männer in schwarzen Lederrüstungen drängten in den Raum, und bevor Ruben einen ganz klaren Gedanken fassen konnte, hatte ihn der Schäbigste von ihnen auch schon erreicht und am Hals gepackt.
„Du stinkender kleiner Scheißkerl!“ Der Atem des vernarbten Glatzkopfes hätte ihn würgen lassen, wenn das nicht schon dessen Hand übernommen hätte. „Flossen-Joe hat mir von deinem Deal mit Santiago erzählt. Hast du kleine Scheißkanalratte gedacht du könntest das vor mir geheim halten?“
Ruben wollte gerne etwas erwidern, aber es kam nicht viel mehr als ein verzweifeltes Gurgeln dabei heraus.
„Häufst dir beschissene Reichtümer in deinem kleinen Rattenloch zusammen und denkst nicht mal im Traum dran, deine verschissenen Schulden bei mir abzubezahlen? Wer hat dich aus dem Dreck gezogen, als du am Verrecken warst und die ganze Scheißstadt sich einen Scheiß um dich gekümmert hat, hä? Wem hast du deine Bude hier zu verdanken?“
„P... Pete!“, krächzte er hervor, als der Griff um seinen Hals endlich ein winziges Bisschen gelöst wurde. „Hör mir d...doch mal zu, verdammt! Ich will dich ja zurückbezahlen, aber du b...bist eben nicht der einzige bei dem ich in der Kreide stehe, ja? Gordon hat mir ein Ultimatum gestellt, also –“
„Was für ’ne Scheiße hat Gordon gemacht?“ Pete riss den Mund zu einem so dröhnenden Fauchen auf, dass die vielen Metallringe in seinen Augenbrauen wild zu rasseln begannen.
„Er hat mir mit dem Tod gedroht!“, erklärte Ruben hastig. „Er wollte mich umbringen, wenn ich ihn nicht sofort auszahle – also hab ich ihm natürlich zuerst was von dem Geld gegeben, das ich von Santiago für die Bücher bekommen habe. Obwohl ich’s eigentlich zuerst dir geben wollte, ist doch klar!“
Pete bohrte seine Fingernägel in Rubens Kehlkopf und leckte sich die Lippen. Ruben fragte sich, wie er sich jemals über den Kragen der Magierrobe hatte beklagen können.
„Ach, und das soll ich dir kleinem Scheißkerl jetzt glauben, was?“ Nicht zum ersten Mal fiel Ruben auf, dass rhetorische Vielseitigkeit und ein reiches Vokabular nicht gerade zu Petes Stärken zählten – aber es hatte schon Situationen gegeben, in denen es ihm mehr Freude bereitet hatte, sich darüber im Stillen zu amüsieren.
„Na schau doch, da auf dem Tisch liegen die nächsten Bücher für Santiago!“ Er wedelte mit der Hand in Richtung der Bücherstapel. „Das Geld, das ich dafür kriege, ist allein für dich gedacht, ehrlich!“
Pete stieß ihn demonstrativ schnaubend von sich, drückte die beiden gelangweilt dreinblickenden Schlägertypen zur Seite, die sich hinter ihm aufgestellt hatten, und pflückte eines der Bücher vom Tisch. Mit seiner heftig zittrigen Hand blätterte er durch das Buch und riss dabei, ob absichtlich oder versehentlich, ein paar Seiten heraus, die raschelnd zu Boden fielen.
„Und wieviel kriegst du für das Zeug hier so, hä?“
Jetzt nicht mehr so viel, ging es Ruben durch den Kopf, aber diesen Satz behielt er lieber für sich. Er musste seinen erstklassigen Instinkt gar nicht erst bemühen, um zu begreifen, dass es keine gute Idee war, Pete noch weiter zu reizen.
„Komm drauf an, wieviel Santiagos Kunden dafür geboten haben. Manchmal hundert Goldmünzen, manchmal zweihundert für eine Lieferung.“
„Hundert? Zweihundert?“, stieß Pete aus und pfefferte das bedauernswerte Buch in die Ecke, wo es zerknittert und zerfleddert liegen blieb. „ Für die ganzen Dinger hier? Santiago verarscht dich doch nach Strich und Faden, und du Scheißidiot merkst es nicht mal!“
„Ich weiß selber, dass seine Kunden ihm viel mehr dafür zahlen, aber ohne Santiagos Vermittlung würde ich die Bücher überhaupt nicht an den Mann bekommen.“ Ruben kam sich etwas albern dabei vor, jemanden wie Pete über die Grundlagen der Hehlerei aufzuklären, aber der Glatzkopf wollte es ja offenbar so. „Es ist der beste Handel, den ich kriegen konnte, und er hat ja schon gereicht, um Gordon auszubezahlen, also –“
Ruben verschluckte sich an seinem eigenen Atem, als Pete plötzlich wieder auf ihn zugeschossen kam, ihn mit einem brutalen Schlag an den Schrank schleuderte und mit einem langen, gebogenen Dolch auf ihn einstieß, den er plötzlich in der Hand hatte. Schreiend wollte sich der Angegriffene zur Seite schmeißen, doch plötzlich kam er nicht mehr weg: Pete hatte den Dolch durch den rechten Ärmel der Robe hindurch in die Schranktür gebohrt. Ruben wollte endlich den verfluchten Gürtel lösen, um sich der Robe zu entledigen, aber da hatte sich Pete schon ganz nah an ihn heran gepresst, während zu beiden Seiten die fleischigen Gesichter seiner Schergen auftauchten.
„Du schuldest mir aber keine hundert beschissenen Goldmünzen, sondern dreitausend beschissene Goldmünzen! Also wirst du eine ganze verschissene Menge von diesen Drecksdingern klauen müssen, wenn du nicht so enden willst wie Pancho!“
Ruben hatte keine Ahnung, wer dieser Pancho war, aber er verzichtete darauf, sich nach dessen Ende zu erkundigen. Er konnte sich keine Sorte Leiche vorstellen, die ihm besonders beneidenswert vorgekommen wäre.
„Genau das habe ich ja vor“, versprach Ruben und achtete bei aller gebotenen Redehast darauf, Petes in riesiger Größe vor ihm schwebendes Gesicht nicht versehentlich anzuspucken. Er wusste aus eigener leidvoller Erfahrung, dass Pete das gar nicht gerne hatte. „Ich werde genauso weitermachen wie bisher, und in ein paar Monaten –“
„Monaten?“ Pete packte ihn bei den Haaren und zerrte sein Gesicht daran in die Länge. „Du drückst mir das Scheißgold morgen in die Hand oder du bist Rattenfutter!“
„Pete, hör mal, das geht so nicht.“ Ruben ahnte gleich, dass so ein Satz keine gute Idee war, und der Gesichtsausdruck des Glatzkopfes bestätigte ihn umgehend darin. „Ich kann nicht einfach die ganze Bibliothek der Feuermagier leerräumen, ohne dass sie davon was spitzkriegen. Ein paar fehlende Bücher alle paar Wochen, das fällt nicht weiter auf, verstehst du? Aber wenn ich zu viele Bücher in zu kurzer Zeit klaue, dann sind bald die Paladine hinter mir her und hinter allen, die damit was zu tun haben – also dann vielleicht auch hinter dir, verstehst du? Das kannst du doch nicht wollen, Pete!“
„Pah! Wenn du dich wegen den verschissenen Paladinen einscheißt, dann bist du vielleicht einfach nicht der Richtige für den Job!“ Schon hatte Pete einen weiteren Dolch gezogen – erneut einen gebogenen, offenbar hatte Pete Urlaub in Varant gemacht – und drückte die Spitze mit solcher Kraft unter Rubens linkes Auge, dass ihm der Schmerz ins Hirn schoss und die Sicht vernebelte. „Wieso sollte ich dich nicht einfach hier und jetzt abstechen und jemanden mit der Sache beauftragen, der sie auch richtig durchzieht, hä? Santiago wird sich einen Scheiß drum scheren, von wem er die Dinger bekommt!“
„So einfach ist das nicht“, versuchte Ruben möglichst ruhig zu erklären, aber er konnte nicht verhindern, dass seine Stimme dabei ins Wimmern abglitt. „Du wirst so schnell keinen Zweiten finden, der sich die Räumlichkeiten im Tempelkomplex so gut eingeprägt hat wie ich. Der den Tagesablauf der Magier so gut kennt wie ich – der genau weiß, wann ein Raum unbeobachtet ist und wann nicht. Da draußen laufen nicht viele ehemalige Novizen herum, die bereit sind, ihre früheren Meister auszurauben!“ Beinahe hätte Ruben noch hinzugefügt, dass auch ganz sicher keiner von denen ein paar nachgemachte Schlüssel dabei hätte, um überhaupt in die privaten Gemächer der Magier eindringen zu können, geschweige denn in die Bibliothek – und eine echte, aufwändig gestohlene Feuermagierrobe, um sich unauffällig im Tempelinneren bewegen zu können, schon einmal gar nicht. Zum Glück wurde ihm in der gleichen Sekunde bewusst, dass sich Pete all diese Gegenstände sehr einfach von ihm nehmen konnte, und er biss sich rechtzeitig auf die Zunge.
„Glaubst du wirklich, ich will mir dein Scheißgelaber anhören?“, knurrte Pete. Die Ringe an seiner Stirn klingelten in Rubens Ohren wie die scheußlichsten Narrenglöckchen, die er je gehört hatte. „Die Sache ist ganz einfach: Entweder du nennst mir jetzt sofort einen Grund, warum ich dich beschissenes Arschloch von einem Scheißverräter nicht an deinem widerlichen Drecksschrank aufspießen sollte, oder ich...“ Pete hustete dröhnend ein bisschen Schleim hoch und versprühte ihn auf Rubens Gesicht. „...oder ich, oder ich mach genau das, ja!“
Der Druck unter dem linken Auge wurde stärker. Nicht mehr lange, und das Auge würde einfach herausspringen wie eine aus der Haut gedrückte Goblinbeere, da war sich Ruben sicher.
„Hör zu, Pete, ich hab da noch was anderes, ja? Ich wollte dir gleich davon erzählen, aber ich bin ja nicht dazu gekommen!“
„Achja?“ Der Glatzkopf runzelte die Stirn und löste die Dolchspitze aus Rubens Gesicht. „Na dann lass mal hören.“
„Gerade eben, bevor ihr gekommen seid, war ein alter Bekannter von mir hier.“ Rubens Stimme überschlug sich fast, so hastig platzte er mit den Erklärungen heraus. Auf Petes Geduld durfte er jedenfalls nicht bauen, also musste er schnell auf den Punkt kommen. „Ein Magier, ein echter Magier, er war vor ein paar Minuten noch hier und hat mir von einem Artefakt erzählt, das er zusammen mit einer anderen Magierin erschaffen hat. Aber nicht irgendein Artefakt, sondern... das mächtigste Artefakt der Welt!“
Ach du scheiße, dachte Ruben, kaum hatte er den letzten Satz ausgesprochen. Damit hast du es übertrieben, das kauft er dir doch nie im Leben ab. Weiß er ja nicht, dass es vielleicht die Wahrheit ist.
Aber Pete blieb ruhig, so ruhig jemand eben sein konnte, dessen Hände grundsätzlich immer in Bewegung waren, und dessen Blut niemals unter den Siedepunkt zu geraten schien.
„Was für’n Dingen soll das sein?“
„Eine Kugel“, erklärte Ruben und spürte den zarten Spross einer Hoffnung in sich aufkeimen, dass er diesen Raum noch einmal lebend verlassen würde. „Eine magische Glaskugel, mit der man in die Zukunft sehen kann. Wer diese Kugel besitzt, der kann alle möglichen Ereignisse vorhersehen, bevor sie eintreten, und dieses Wissen kann er dann nutzen, um alles Mögliche zu seinen Gunsten zu verändern – diese Kugel ist in der Lage, ganze Kriege zu entscheiden! Verstehst du jetzt, warum sie das mächtigste Artefakt auf der Welt ist? Jeder der Magier aus dem Süden wird dir ein Vermögen dafür zahlen, bloß ein einziges Mal hineinschauen zu können! Jeder König wird seine Schatzkammer für dich leeren, um die Kugel für eine Woche nutzen zu können! Du wirst der reichste Mann der Welt sein, Pete – der mächtigste Mann der Welt!“
Ruben war sich natürlich im Klaren darüber, dass er sich mit all dem ganz schön aus dem Fenster lehnte, aber ihm entging das Glänzen in Petes Augen nicht. Offenbar hatte er ins Schwarze getroffen.
„Die Kugel ist gerade auf der Insel Irdorath und wird gut bewacht, aber diese beiden Magier – die Bekannten von mir –, die denken, dass ich ein Feuermagier geworden bin und dass ich ihnen helfen kann beim Umgang mit der Kugel. Also haben sie mich eingeladen auf die Insel, und ich werde ganz problemlos an die Kugel herankommen können. Ich schnapp’ sie mir bei der ersten Gelegenheit, und dann fahr ich mit dem gleichen Schiff wieder zurück hierher, bevor sie überhaupt merken, was los ist. Verstehst du? Es ist eine idiotensichere Sache, ich muss mir nicht mal einen Plan für den Einstieg überlegen! Du bekommst die Kugel und ich bin meine Schulden los, okay, Pete?“
Das mächtigste Artefakt der Welt für dreitausend Münzen Schuldenerlass, dachte Ruben. Was für ein lausiges Geschäft. Aber immer noch besser als von einer Witzfigur wie Pete an den Schrank genagelt zu werden.
„Du willst einen beklauen, der in die Zukunft gucken kann?“, grunzte der Verbrecher mit plärrender Stimme. „Diese Magier müssen doch nur mal beim Kacken in ihre Scheißkugel glotzen und haben sofort kapiert, was du vorhast!“
Ruben war ein bisschen beeindruckt. So blöd wie er sich gab war Pete offenbar gar nicht, aber andernfalls hätte er es wohl auch kaum zu einer einflussreichen Position in der Unterwelt Vengards gebracht.
„Sie benutzen die Kugel aber gerade gar nicht“, bemühte sich Ruben glaubhaft zu versichern. „Sie wollen erst warten, bis ich bei ihnen auf der Insel bin. Die werden überhaupt nichts mitbekommen, verstehst du? Es sind die perfekten Voraussetzungen für einen Raub, so eine Gelegenheit kommt nie wieder!“
„Wenn du mir gerade einen Haufen Scheiße erzählt hast, dann bist du tot“, stellte Pete klar und fletschte die Zähne, aber er klang gar nicht mehr so aggressiv dabei wie gewöhnlich. Sogar seine beiden Begleiter hatten sich ein wenig entspannt, als ob sie schon ahnten, dass sie nicht mehr gebraucht wurden. „Wenn du dich verpisst und diese Kugel irgendwann mal in den Händen von irgendeinem anderen Arschloch auftaucht, dann bist du auch tot!“
„Die Kugel wird sonst keiner zu Gesicht bekommen, Pete, ich werde sie direkt zu dir bringen! Aber du musst mich jetzt gehen lassen, sonst verpasse ich das Schiff und –“
„Ich war noch nicht fertig!“, grunzte der Glatzkopf. Ruben schnappte überrascht nach Luft, als ihn der Verbrecher mit seinem linken Arm an den Schrank presste, den Dolch an den Schergen zu seiner Rechten weiterreichte und im nächsten Moment einen dritten Dolch zückte. Dieser besaß eine deutlich kleinere und dünnere Klinge als die anderen beiden, war mehr Nadel als Messer. An seinem Knauf funkelte etwas Grünes, aber bevor Ruben einen genauen Blick darauf erhaschen konnte, schnellte Petes bebende Hand nach vorn und stach ihm mit der Klinge in den Hals. Im gleichen Moment hatte er den Dolch wieder herausgezogen, und innerhalb eines Sekundenbruchteils war alles schon wieder vorbei. Mit weit aufgerissenen Augen tastete Ruben nach der Wunde, fühlte das Blut über seine Finger tropfen und brachte nur noch ein tonloses, heiseres Krächzen hervor. Er konnte nicht fassen, was gerade geschehen war. Pete hatte ihn abgestochen, einfach so, und das, obwohl er ihm das beste Angebot der Welt gemacht hatte! Er würde verbluten, elendig verrecken, nur weil dieser Wahnsinnige zu durchgeknallt war, um sich ohne jede Anstrengung zum reichsten Mann der Welt machen zu lassen!
„Hör auf zu quieken, du Scheißkanalratte“, brummte Pete und fummelte mit dem Dolch vor seiner Nase herum. „Der kleine Stich wird nicht mal so ’nen Schwächling wie dich aus den Socken hauen.“
Tatsächlich bemerkte Ruben nun, dass den paar Bluttröpfchen, die seine Finger verklebten, keine weiteren mehr gefolgt waren. So tief ins Fleisch, wie er es im ersten Schreckmoment angenommen hatte, war Pete mit dem Dolch gar nicht vorgedrungen.
„Aber... was...?“
„Was das sollte, hä?“, äffte ihn Pete schief grinsend nach. „Das schöne Teil hier hab ich einem Assassinen abgekauft – und ’ne Ampulle Assassinengift gleich mit dazu. Ja, Gift, Kleiner. Aber scheiß dich nicht ein, das Zeug bringt dich nicht gleich um. Das dauert seine Zeit, bis sich das im Kopf festgesetzt hat. Drei, vier Wochen vielleicht. Lange genug für dich, um nach Irdorath zu fahren und wieder zurück.“
„Du hast mich vergiftet!“, keuchte Ruben, obwohl das natürlich längst allen Anwesenden klar war. „Wieso machst du so eine Scheiße? Ich halte mein Wort, verdammt!“
„Klar machst du das, genau wie ich.“ Pete befestigte den vergifteten Dolch wieder an seinem Gürtel. Dann zog er den ersten Dolch aus dem Schrank und drückte ihn dem Schergen zu seiner Linken in die Hand. „Also komm mit deiner Kugel zurück zu mir, und ich steche dir nochmal in deinen verschissenen Hals – aber diesmal mit dem Gegenmittel auf der Klinge. Und versuch gar nicht erst, selber an das Zeug zu kommen. Gibt viel zu viele verschiedene Mischungen da unten im Süden, da bringst du dich erst recht mit um. Aber ich weiß ja, dass du sowas nicht probieren würdest, hä? Hältst ja dein Wort!“
„Ja!“, schrie Ruben den irren Glatzkopf an. „Ja, mach ich! Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen!“
Er brachte den Satz kaum noch richtig zu Ende, weil ihm die Stimme versagte und ihn die Kraft verließ.
„Dann hast du ja auch keinen Grund, dir in die Robe zu scheißen, hä?“ In Petes Augen glänzte es wieder, als er mit groben Handbewegungen den verbeulten Kragen der Feuermagierrobe gerade rückte und ihm zum Abschied ein letztes Mal den Zeigefinger auf die Brust drückte. „Bring mir die Kugel und wir können wieder Freunde sein, was sagst du? Ha!“
Ruben sagte gar nichts mehr dazu. Hilflos sah er mit an, wie Pete und seine beiden bulligen Begleiter sich durch den Trümmerhaufen, den sie hinterlassen hatten, einen Weg zu dem rechteckigen Loch in der Wand bahnten, das einmal eine Tür beherbergt hatte.
„Achja.“ Die Schläger waren schon nach draußen gegangen, als sich Pete noch einmal zu ihm umdrehte. „Ich will der einzige sein, der so eine Kugel hat, klar? Wenn es noch mehr davon gibt, dann bring sie mir alle. Und auf jeden Fall sorgst du dafür, dass es keine weiteren mehr geben wird. Bring diese Scheißmagier um, spreng ihre Insel in die Luft, was auch immer. Wenn der Diebstahl so einfach ist, dann hast du ja bestimmt nichts gegen eine kleine Herausforderung, hä?“
Ruben sagte nichts. Er erwiderte bloß Petes verhassten Blick, bis er den Anblick nicht mehr länger ertrug und die Augen schloss.
„Verstanden?“
Ruben wollte nichts mehr antworten, weil er das Gefühl hatte, dass jedes Wort den ekelhaften Triumph dieses Dreckssacks, der ihn in der Hand hatte, nur noch versüßen würde. Aber bevor Pete ging, wollte er noch ein Wort hören. Ein allerletztes Wort musste noch sein.
„Verstanden.“
-
▦
Die Sonne war keine zwei Stunden untergegangen, da tauchte ein neues Licht über dem Wasser auf. Schwach und fahl blinzelte es aus der Dunkelheit hervor, ohne Feuer, ohne Leben. Es war ein einsames Licht, und dass es jeder sehen konnte, der nah genug auf einem Schiff herangefahren war, änderte daran nichts. Niemand war bei ihm, um über es zu wachen, und nur gelegentlich schaute jemand vorbei, um sicherzustellen, dass es noch am Leben war. Es war ein einsames Licht auf einer einsamen Insel. Und im Inneren war es nichts als Magie.
„Ihr habt sogar einen Leuchtturm gebaut. Nicht schlecht.“
Elias erschrak, als Rubens Stimme plötzlich ganz dicht hinter ihm erklang.
„Das hast du dir immer noch nicht abgewöhnt, was?“ Eigentlich hatte er sich auf das Oberdeck begeben, um ein wenig ungestört zu sein, aber dieser Plan war offenbar nicht aufgegangen.
„Was meinst du?“
„Dich an mich heranzuschleichen.“
Elias rückte ein bisschen auf dem Rand der Holzkiste nach rechts, die noch feucht war vom Regen des Nachmittags, und sein alter Freund nahm neben ihm Platz. Leise summend folgte das magische Licht, das über Elias’ Kopf schwebte – die kleine Schwester des großen Leuchtens an der Küste von Irdorath – seiner Bewegung.
„Keine große Kunst, wenn du dich immer noch von allem hypnotisieren lässt, was irgendwer auf einen Zettel geschmiert hat“, erwiderte Ruben griemelnd und warf ohne jede Spur von höflicher Zurückhaltung einen Blick auf das oberste Blatt Papier in Elias’ Händen. „Aber, äh, für Quadrate hast du dich früher noch nicht so interessiert.“
Elias konnte nicht anders, als sich im Stillen zu ärgern über die neugierige Art des Feuermagiers, die ja beileibe nichts Neues war für ihn. Eigentlich war es genau wie früher, dachte er. Genau das hatte er gewollt, oder?
„Das sind die Pläne, die mir Varyan gegeben hat“, erklärte er ruhig und blätterte für Ruben durch die Papiere. „Er hat sie heute Vormittag gezeichnet. Es sind die genauen Maße eingetragen, damit können die Glasmacher arbeiten.“
„Er meint das also wirklich ernst, hm? Fensterscheiben aus schwarzem Glas? Da kann man die Fenster auch gleich zumauern und kommt billiger dabei weg.“
Elias zuckte mit den Schultern. „Er wird wohl schon Leute haben, die daran interessiert sind, irgendwo im Süden. Macht sich vielleicht gut in einem Beliartempel. Je weniger Licht, desto besser, denken sich die Schwarzmagier vielleicht.“
Tatsächlich war ihm der Gedanke, über Umwege möglicherweise Handel mit Schwarzmagiern zu betreiben, überraschend gleichgültig. Nachdem er eine Woche lang erfolglose Gespräche mit den Seefahrern und Händlern am Hafen von Vengard geführt hatte, war ihm die Begegnung mit Varyan wie eine gewaltige Befreiung vorgekommen. Der Südländer hatte ihm mit seiner ungewöhnlich ruhigen Art von Anfang an gut gefallen – er hatte sich in den zermürbenden Tagen zuvor mehr als genug verlogene Schmeicheleien für ein ganzes Leben anhören müssen –, und obwohl mit dieser angenehmen Zurückhaltung auch eine auffällige Verschlossenheit einherging, hatte er im Gespräch mit ihm erstmals das Gefühl gehabt, jemandem gegenüber zu sitzen, der sein Wort halten würde. Varyan hatte nur zwei Bedingungen gestellt: Die erste bestand darin, dass die Glasmacher die Herstellung von Krügen, Kannen und Karaffen einstellen und stattdessen einfache Scheiben herstellen würden. Scheiben aus schwarzem Glas in unterschiedlichen Größen und Formen, in den meisten Fällen aber rechteckig und in den Maßen gewöhnlicher Fensterscheiben. Natürlich hatte Elias sogleich nach dem Einsatzzweck für diese schwarzen Scheiben gefragt, die Varyan ihm und Miriam über mindestens ein halbes Jahr hinweg zu vielen Hunderten abkaufen wollte, aber der Händler hatte sogleich seine zweite Bedingung genannt: Keine Nachfragen. Er hatte diese zweite Bedingung keinesfalls in unfreundlichem Ton gestellt, aber doch auf eine sehr bestimmte Weise, die Elias sogleich hatte spüren lassen, dass er diesen Teil des Handels ebenso ernst meinte wie die übrigen. Und Elias war bereit, ihn zu akzeptieren, denn die restlichen Details des Vertrags hatten ihm keinen Grund zum Zweifeln gegeben. Die Übereinkunft gab ihnen mindestens ein halbes Jahr lang Sicherheit und die nötige Ruhe, um sich ganz auf die Kugel zu konzentrieren. Ein besseres Angebot würde ihnen niemand bieten, da war er sich sicher. Er fürchtete zwar, dass Miriam nicht ganz glücklich mit der zweiten Bedingung sein würde, denn mit Geheimniskrämerei kam sie nur dann gut zurecht, wenn sie von ihr selbst betrieben wurde. Doch selbst im Falle, dass es am Ende tatsächlich Schwarzmagier oder andere zwielichtige Gestalten waren, an die Varyan ihre Waren auslieferte – es blieben ja doch bloß Glasscheiben, die sie diesen Leuten verschafften. Es brauchte schon einen Priester des Feuers, um in einem solchen Handel etwas Verwerfliches zu entdecken. Aber die Innoskirche lag nun schon drei Tagesreisen hinter ihnen, und obwohl sich einer ihrer Diener auf dem Schiff befand, fühlte es sich nicht danach an, als ob sie einen Teil dieser Kirche mit sich genommen hatten.
Ruben gab sich auch alle Mühe, nicht wie ein Feuermagier zu wirken, dachte Elias, als er ihn nun im kühlen Schein des schwebenden Leuchtens neben sich auf der Kiste sitzen sah. Er hatte nicht einmal eine Robe mit sich auf die Reise genommen. Seine Kleidung war schlicht und granitfarben, bis auf den zerfledderten Wolfspelz, den er sich um die Schultern geworfen hatte, um sich in der Nacht auf See zu wärmen. Um den Hals trug er einen dicken, flusigen Wollschal, und das Gesicht, das zwischen Pelz und Wolle hervorschaute, schien beinahe so jungenhaft wie in den alten Tagen.
„Ich glaube, ich erkenne schon ein bisschen was von der Insel.“ Rubens Interesse an den Glasscheibenplänen hatte sich offenbar erschöpft, und er widmete seine Aufmerksamkeit wieder dem fernen Licht in der Finsternis, das er über die Reling hinweg erspähte. „Ob uns wohl schon jemand sieht? Habt ihr sowas wie einen Leuchtturmwärter?“
„Nur einen Nachtwächter“, sagte Elias. „Der schaut auch ab und zu mal beim Leuchtturm nach dem Rechten. Aber es ist kein Feuer, das dort brennt, deswegen muss auch niemand dort sein, der es am Leben hält.“
„Ein magisches Licht?“
„Eine Ansammlung magischer Lichter. Zusammen leuchten sie stark genug, um von Weitem sichtbar zu sein. Miriam hat den Zauber so verfeinert, dass er nur alle paar Tage erneuert werden muss.“
Ruben nickte, und Elias konnte bloß mutmaßen, was er sich dazu denken mochte. Er hoffte, dass er nicht großspurig geklungen hatte bei der Erklärung des Zaubers. Ein Lichtzauber, und sei er noch so ausgeklügelt, musste für einen Feuermagier wohl gar nicht der Rede wert sein. Aber über den genauen Umfang der Ausbildung, die Ruben genossen hatte, konnte er sich noch immer kein richtiges Bild machen. Er hatte in den Tagen, die sie gemeinsam auf See verbracht hatten, den Eindruck gewonnen, dass Ruben nicht besonders gerne über sein Leben als Feuermagier sprach. Wenn er ihn auf seine Forschungen ansprach, dann gab er bloß ausweichende Antworten, und obwohl er ihm bereitwillig mehr über das versunkene Kloster erzählt hatte, dem er gemeinsam mit Meister Talamon nachspürte, hatte Elias stets das Gefühl, dass die Dinge, die ihm Ruben erzählte, weit in der Unterzahl waren gegenüber denjenigen, die er ihm verschwieg. Vermutlich war das nicht einmal etwas, das ihm zum Vorwurf gemacht werden konnte. Es war ja bekannt, dass die Magier aus dem Kreis des Feuers gerne unter sich blieben, und dass nicht viel nach außen getragen wurde von all dem, was sich innerhalb dieses Kreises abspielte. Sein alter Freund, so sehr er sich auch bemühte, Gegenteiliges zu vermitteln, stellte in dieser Hinsicht offenbar keine Ausnahme dar.
„Ha! Ihr Magier haltet ja doch ganz schön was aus! Bei der Kälte hier draußen auf’m Oberdeck, wer hätt’ denn sowas gedacht? Gebt ja vielleicht sogar’n paar ganz taugliche Matrosen ab!“
Elias drehte den Kopf zur Seite und bemerkte zwei Mitglieder der Schiffsbesatzung, die gemeinsam ein langes, aufgerolltes Tau schleppten. Derjenige, der gesprochen hatte, war ein verschwitzter Mann mittleren Alters namens Steffen oder Stefan, der mit seiner Augenklappe und der auffälligen Hakennase auch ohne Weiteres auf jedes Piratenschiff gepasst hätte, und der darüber hinaus zu den wenigen Mitgliedern der überwiegend varantischen Mannschaft gehörte, die aus Myrtana stammten. Begleitet wurde er von einem Ungetüm, das fast doppelt so groß war wie er selbst, und dessen Augen in all dem wild wuchernden gräulichen Fell nur deshalb zu erkennen waren, weil ihre Pupillen stechend gelb waren. Elias hasste es, in der Gesellschaft von Orks zu reisen, zumal sich die orkischen Matrosen ebenso grimmig gaben, wie es von Orks eben zu erwarten war – und noch deutlich unangenehmer rochen. Wann immer er nicht anders konnte, als einem Ork so nahe zu kommen, dass er diesen ganz bestimmten muffigen Geruch in die Nase bekam, ein Geruch wie von Pilzen, die zu viel Feuchtigkeit abbekommen hatten, da fragte er sich unwillkürlich, wie bloß Leute, die man durchaus für vernünftig halten konnte, auf die Idee gekommen waren, so einen Ork nicht nur im eigenen Umfeld als Arbeiter oder Freund zu dulden, sondern in manchen Fällen sogar zu heiraten. Die myrtanische Prinzessin kam ihm dann natürlich gleich in den Sinn. Man konnte wohl nur für sie hoffen, dass die leider wenig glaubwürdigen Berichte über eine Liebesheirat der Wahrheit entsprachen.
„Ach, wir sind ja schön warm angezogen“, rief Ruben den Matrosen mit einem Lächeln zu. „Und als Feuermagier ist einem sowieso immer mollig warm, da kann man gar nichts gegen machen!“
„Na, ich für mein’ Teil fühl mich bei dem ganzen Geschleppe ja eher wie’n Wassermagier!“, brüllte Steffen oder Stefan zurück und lachte über seinen eigenen Witz, während der Ork neben ihm bloß unleidlich grunzte. Ruben winkte ihnen etwas überzogen freundlich hinterher, als sie das Tau die Treppe hinab zum Unterdeck trugen.
„Nette Leute, nicht wahr?“, sagte er, und als Elias nichts darauf erwiderte, wandte sich sein Blick wieder dem Licht Irdoraths zu. „Was ist eigentlich mit dem Tempel? Kann man ihn von hier aus sehen?“
Elias schüttelte den Kopf. „Der ist auf der anderen Seite der Insel, und zum großen Teil unterirdisch. Es gibt eine Wassergrotte an der Steilküste im Südosten, da liegt der ursprüngliche Eingang über den Seeweg. Aber Miriam und ich benutzen einen anderen zu Land, am Quarzbruch.“
„Das klingt ja fast so, als wärt ihr ständig da drin. Ich dachte, da gibt es nur kalte Mauern und leere Gänge.“
„Damit liegst du auch nicht so falsch“, sagte Elias. „Wenn wir hineingehen, dann meistens, um die Quarzhauer davon zu überzeugen, dass sie sich die gruseligen Geräusche nur eingebildet haben, die sie immer mal wieder von dort hören.“
„Gruselige Geräusche? Und du bist dir ganz sicher...?“
„Jetzt fang du nicht auch noch an“, entgegnete Elias mit nicht ganz ernst gemeintem Ärger. „Wir sind den Tempel so oft abgegangen, da ist kein Funken schwarzer Magie mehr zu finden. Es ist genauso, wie du gesagt hast: Mauern, Flure, schwarzer Stein. Viel mehr ist es nicht. Aber ich kann den Männern keinen Vorwurf machen. Sie sind für viele Monate von ihren Familien getrennt, ganz allein auf einer kargen Insel ohne jede Ablenkung nach der Arbeit, abgesehen von den trostlosen Besäufnissen mit den immer gleichen Menschen. Ich glaube, da würden die meisten von ihnen sich selbst dann ab und zu mal etwas einbilden, wenn kein alter Beliartempel in der Nähe wäre. Wir können ja froh sein, dass wir überhaupt genug Leute finden, die sich darauf einlassen.“
„Da sagst du was“, murmelte Ruben, der gerade an seinem Schal herumnestelte und ihn dabei wohl etwas strammer zog. „Ihr müsst ganz schön gut bezahlen, dass die Leute das alles in Kauf nehmen.“
„Das tun wir“, sagte Elias, „und das müssen wir tatsächlich. Mit den üblichen Löhnen, die geradeso zum Überleben reichen, lockt man niemanden nach Irdorath. Jeder der Arbeiter ist nur dort, weil er darauf hofft, sich ein schönes kleines Vermögen angespart zu haben, sobald er wieder in der Heimat ist. “
In der Heimat. Immer wenn er ein wenig länger mit irgendeinem der Männer sprach, die für sie arbeiteten, dann ging es früher oder später um die Sehnsucht nach der Heimat. Um die Menschen und Pläne, die dort warteten, und die bloß noch ein wenig länger warten mussten, bis sie wieder ins Leben treten würden, schöner und geliebter als je zuvor, bis sie die einsame, kalte Zeit auf Irdorath vergessen machen konnten. Wenn Elias hingegen an seine Heimat dachte, dann kam ihm inzwischen genau dieses Irdorath in den Sinn. Die Menschen und die Pläne, die ihm etwas bedeuteten, sie waren alle dort. Manchmal fragte er sich, wo er selbst sein würde, wenn all die Leute, die sich so sehr von dort fortsehnten, erst einmal wieder in ihrer Heimat angekommen waren. Würde er Irdorath dann auch hinter sich lassen, dem verlassenen Tempel eine kleine Geisterstadt zur Seite stellen? Hier und jetzt fühlte sich dieser Gedanke sehr fremd an. Dem magischen Leuchten an der Küste dabei zuzuschauen, wie es ganz langsam größer und größer wurde, heller und heller, das war nichts anderes als das Gefühl, nach Hause zu kommen. Aber vielleicht würde er dieses Gefühl bei jedem Ort auf der Welt haben, an dem Klarissa auf ihn wartete.
Und diesmal... diesmal wartete noch etwas anderes dort.
Der Feuermagier sprach nicht viel davon, aber Elias sah es in seinen Augen. Wenn Ruben gen Irdorath schaute, dann hatte er natürlich nicht den Leuchtturm und nicht den Tempel und auch nicht die Arbeiter dabei im Kopf. Dann hatte er die Kugel im Kopf.
Ein nervöser Schauer fuhr über Elias’ Haut, als er daran dachte, dass nur wenige Stunden vergehen würden, bis sie alle vier wieder vereint waren. Bis sie gemeinsam in die Kugel schauen würden. Was dann geschehen mochte, das konnte er sich nicht ausmalen. Alles war denkbar. Aber es sprach einiges dafür, dass diese letzten Stunden auf dem Weg nach Irdorath auch die letzten Stunden in ihren Leben sein würden, in denen noch eine ungewisse Zukunft vor ihnen lag.
▥
Zu länglich.
Zu klein.
Zu dick.
Aber der hier... der könnte vielleicht...
Ruben warf einen raschen Blick zu der kleinen Menschentraube, die sich in wenigen Schritten Entfernung an der Anlegestelle der Bak Shedim gebildet hatte, bevor er sich nach dem Stein bückte und ihn aufhob. Die dunkelgraue Farbe, die ovale Form, die Größe – es kam alles ziemlich gut hin. Natürlich war er nicht ebenmäßig geschliffen wie ein echter Runenstein, aber beim flüchtigen Hinschauen würde der Unterschied hoffentlich nicht auffallen. Wenn er jetzt noch ein Stückchen Kreide auftreiben konnte, um ein Zeichen auf die Oberfläche zu kritzeln... aber vermutlich durfte er keine zu hohen Ansprüche an sein Glück stellen. Ein blanker Runenstein war besser als gar keiner. Und ein Magier ohne Runen – das war nur damals gegen Ende des Krieges für kurze Zeit denkbar gewesen, als die Runenmagie wenige Wochen lang ihre Kraft verloren hatte und die Magier ihre Zauber auf andere und deutlich kräftezehrendere Weise wirken mussten. Ruben wäre es ganz recht gewesen, wenn sich daran nichts geändert hätte, aber seit er denken konnte, hatten die Magier wieder ihre Runen. Und deshalb schadete es nicht, selbst eine zu haben, auch wenn sie bloß Attrappe war.
„He, Ruben!“
Elias hatte seine kurze Unterredung mit Varyan und einigen seiner Arbeiter offenbar abgeschlossen und winkte ihn zu sich heran. Obwohl sich viele Bewohner Irdoraths an der Küste eingefunden hatten und an Bord des Schiffes emsige Betriebsamkeit herrschte, war es merkwürdig still, und vor dem dünnen Rauschen des Meeres wirkte jedes Wort wie bloßes Geflüster.
„Hast du deine Sachen alle dabei?“, wollte Elias wissen, als Ruben bei ihm angekommen war.
„Alles hier drin.“ Ruben deutete auf den Sack, den er sich über die Schulter geworfen hatte. „Wieso fragst du? Fahren sie etwa gleich wieder ab?“
„Das nicht. Varyan will den Tag über ankern und erst morgen früh wieder ablegen“, erwiderte Elias zu seiner Beruhigung. Ein ganzer Tag Zeit also. „Aber ich würde lieber nichts unbeaufsichtigt auf dem Schiff lassen.“ Er senkte die Stimme zu einem Raunen. „Du weißt ja selber, wer da alles an Bord ist. Ishtarer, Orks...“
Der Ork, der mir was klaut, muss erst noch geboren werden, dachte Ruben im Stillen, antwortete aber bloß mit einem Lächeln.
„Also gut, dann komm mal mit.“
Elias setzte sich in Bewegung, und Ruben folgte ihm nach. Es war ein merkwürdiges Gefühl, über den kühlen, schwarzen Fels von Irdorath zu laufen. Fast hatte er ein wenig den Eindruck, dass ihm die Kälte in die Füße stieg und sie lähmte, den Schritt verlangsamte, bis er irgendwann in der Bewegung erstarren musste. Aber er wusste selbst, dass es nur Einbildung war. In seiner derzeitigen Verfassung, in die ihn Pete gebracht hatte, war er für jegliche Einbildungen allzu empfänglich.
Es ging nun eine Steigung hinauf, und ein paar Arbeiter kamen ihnen entgegen, zunächst noch leise miteinander flüsternd, im nächsten Moment bereits den Blick senkend und schweigend. Ihre Gesichter waren schmal und blass, und Ruben glaubte, eine große Anspannung in ihren Zügen zu erkennen.
Ein paar beschwerliche Schritte später hatten sie den höchsten Punkt des Hangs erreicht und waren auf einem Plateau angekommen, das Ruben zum ersten Mal einen guten Überblick über den westlichen Teil der Insel bot. Irdorath hatte schon von Weitem wie ein gewaltiger schwarzer Felsbrocken ausgesehen, den irgendwer aus Langeweile ins Meer geworfen hatte – ein Gott vielleicht, oder ein sehr großer Troll. Dieser Eindruck hielt sich auch jetzt noch hartnäckig, da Ruben die Insel aus der Nähe betrachten konnte. Alles hier schien schwarzer Fels zu sein, aufgelockert nur von gelegentlichen dunkelgrauen Äderchen, die sich durch den Stein zogen, und von seltenen weißen, kränklichen Maserungen hier und da. Abgesehen von den Menschen, die Elias und Miriam hier angesiedelt hatten, schien die Insel zumindest auf den ersten Blick völlig frei von Leben zu sein. Kein Baum, kein Grashalm, nicht einmal ein bisschen Moos. Keine Möwen kreisten in der Luft, keine Mücke summte im Ohr, und natürlich heulte auch kein Wolf in der Ferne. Irdorath war nichts als ein ins Meer geworfener Felsen, und die würfelförmigen Gebäude aus Stein und Holz, die man auf diesen Felsen gesetzt hatte, hatten ganz den Anschein, als müssten sie beim nächsten Regenfall von der glatten Oberfläche zurück ins Meer gespült werden. Ruben zählte abgesehen von dem Lagerhaus, das sie gerade passierten, und dem Leuchtturm, der an einer Klippe zu seiner Linken stand, sechzehn weitere Häuser in unterschiedlichen Größen, die auf dem Plateau errichtet waren. Das Größte davon hatte man in einigem Abstand von den anderen in einer kleinen Senke erbaut, und nach dem zu schließen, was ihm Elias bereits über die Siedlung erzählt hatte, musste es sich dabei wohl um die Werkstatt handeln. Dort erschufen die Glasmacher aus den Quarzen, die unter Tage gewonnen wurden, das wertvolle Handelsgut, auf dem die ganze Unternehmung der Magier aufbaute. Auch die Kugel war dort entstanden, hatte Elias gesagt. Wo sie sich jetzt befand, darüber konnte Ruben nur Mutmaßungen anstellen. Es hing wohl davon ab, wo sich Miriam gerade aufhielt.
Lange waren sie nicht gegangen, als sie auch schon bei drei kleineren Häusern zum Halten kamen, die in einer geraden Reihe nebeneinander standen. Aus dem Schornstein des Linken qualmte hellgrauer Rauch, während die anderen beiden verlassen schienen.
„Miriam hat gesagt, dass du fürs Erste in ihrem Bett schlafen kannst.“ Elias näherte sich der Tür des mittleren der drei Häuser, und als er Rubens Blick bemerkte, fügte er hinzu: „Sie selbst übernachtet sowieso ständig in der Werkstatt. Ihr Bett ist also frei, du verstehst?“
„Ja“, sagte Ruben. „Verstehe.“
Elias klopfte trotzdem zweimal an und wartete kurz ab, bevor er die Tür aufschloss. Der Raum war schlicht, aber durchaus gemütlich eingerichtet: In der Ecke ein Bett, an den Wänden ein Schrank und eine kleinere Kommode, dazu noch ein Nachttischchen und vor dem Kamin ein schmaler, bräunlich-roter Teppich. Die Kälte jedoch machte jede Behaglichkeit von vornherein zunichte.
„Wahrscheinlich ist sie auch jetzt gerade in der Werkstatt“, fuhr Elias fort. „Am besten, zu lädst deine Sachen ab und machst dir schon mal ein Feuer im Kamin, und ich hole derweil Miriam. Einverstanden?“
„In Ordnung.“
Mit einem dumpfen Schlag fiel die Tür hinter dem Magier wieder ins Schloss, und zum ersten Mal seit drei Tagen war Ruben mit sich allein. Er ließ den Sack mit seinen mitgebrachten Habseligkeiten zu Boden sinken und genoss ein paar Sekunden lang die Ruhe, die eine wirklich vollkommene Ruhe war, da auch Elias’ Schritte schon nach sehr kurzer Zeit nicht mehr zu hören waren. Dann lockerte er den Schal, und seine Hand tastete nach der Wunde an seinem Hals. Für einen kurzen Moment war da die Hoffnung, dass er überhaupt nichts erfühlen würde, dass es gar keine Wunde gab und auch keine Vergiftung, aber dann hatte er sie doch gefunden: Nur eine kleine Unregelmäßigkeit, nicht viel mehr als ein Pickel, aber kaum übte er etwas Druck darauf aus, entsandte sie eine Welle kalten Schmerzes hoch in seinen Kopf. Der Schwindel zwang ihn dazu, sich aufs Bett zu setzen, und er konnte nicht verhindern, dass er einmal mehr von der Panik gepackt wurde. Kaum war die Betäubung abgeklungen, stolperte er wieder in die Höhe, riss die Schubladen des Nachttischchens auf, dann die der Kommode gleich daneben, und wurde schließlich fündig. Er wischte die dünne Staubschicht mit dem Ärmel weg, die auf dem kleinen, schmucklosen Handspiegel lag, und hielt ihn sich mit angehaltenem Atem vor den Hals. Mit dem Blick in den Spiegel war auch der letzte Zweifel an Petes Worten gestorben. Ein kleiner, blassroter Punkt markierte die Stelle, an der die Nadelspitze des Dolches seine Haut durchdrungen hatte, und um dieses rote Zentrum herum hatte sich die Haut im Umkreis mehrerer Daumenbreiten pechschwarz gefärbt. Einige ebenso schwarze Äderchen ragten aus dem Fleck der Vergiftung heraus und griffen nach allen Seiten hin um sich. Was hatte Pete gesagt? Drei oder vier Wochen, bis sich das Gift im Kopf festgesetzt hatte? Ruben zweifelte daran, dass ihm überhaupt so viel Zeit bleiben würde, aber es spielte auch kaum eine Rolle. Er kannte zwar die genauen Details des Vertrags nicht, den Elias mit Varyan geschlossen hatte, aber der Händler würde die Insel vermutlich nur alle paar Monate einmal anfahren. Dass sich ein anderes Schiff nach Irdorath verirrte war äußerst unwahrscheinlich, also musste er schnell handeln. Entweder, er konnte die Kugel in dieser Nacht an sich nehmen und am nächsten Morgen mit der Bak Shedim abreisen, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekam, oder aber er war dem Tode geweiht, und dann konnte es ihm auch gleichgültig sein, ob ihn die Vergiftung nun in vier Wochen oder vielleicht schon in einer einzigen dahinraffen würde. Vielleicht war es dann sogar besser, wenn es schneller vorüber war.
Er zog den Schal um seinen Hals wieder zu, stellte noch einmal durch einen Blick ins Spiegelglas sicher, dass von seiner Wunde nichts zu sehen war, und legte den Handspiegel in die Schublade zurück. Seine Lage war ihm nun also bewusst. Jetzt galt es, sich davon nicht verunsichern zu lassen, sondern die besten Entscheidungen zu treffen, die ihm offen standen. Er musste die Kugel in Besitz nehmen, das war alles worauf es zunächst ankam – denn ohne die Kugel war er in jedem Fall verloren, so viel stand fest. Der Gedanke, sie anschließend tatsächlich Pete zu geben, behagte ihm zwar nach wie vor nicht, aber ebenso unklar war ihm, auf welche Weise er die Kugel womöglich dazu benutzen konnte, um seinen neuen Erzfeind auszutricksen und das Gegengift ohne seine Hilfe zu erhalten. Selbst wenn ihm die Kugel tatsächlich einen Blick in jenen Teil der Zukunft gewährte, der ihn am meisten interessierte, wie genau sollte ihm das weiterhelfen? Er würde entweder sehen, wie er die Kugel an Pete übergab, oder wie er an dem Gift verreckte, oder vielleicht auch wie Pete ihn betrog und beides nacheinander eintrat – wenn Pete denn dumm genug war, etwas Derartiges zu versuchen, obwohl er natürlich damit rechnen musste, dass Ruben selbst von der Kugel Gebrauch machte. Aber dieses Gebrauch machen, das war ja gerade das Problem: Ruben hatte keine Ahnung, wie genau die Kugel eigentlich funktionierte. Wenn er sie tatsächlich Pete gab, dann konnte er nur hoffen, dass der Mistkerl beim Hineinschauen auf Anhieb irgendetwas sehen würde, das ihn zufrieden genug machte, um das Gegengift herauszurücken. Aber die Befürchtung, dass er mit seinen Versprechungen von Allmacht und unendlichem Reichtum ein wenig zu hoch gegriffen hatte, ließ sich nicht so leicht abschütteln. Seine größte Hoffnung war, dass er an Bord des Schiffes ein Versteck finden würde, das bequem genug war, um sich dort während der dreitägigen Rückreise ausgiebig mit der Kugel auseinandersetzen zu können. Vielleicht würde er dabei eine Lösung finden, und wenn nicht... dann würde er sein Glück eben doch mit Pete versuchen müssen. Aber so weit durfte er jetzt noch nicht denken. Zuerst brauchte er die Kugel, dann konnte er weitersehen.
Ein Frösteln durchfuhr ihn, und obwohl es sicher nicht allein der Kälte geschuldet war, musste sich Ruben an Elias’ Aufforderung erinnern, den Kamin zu entzünden. Vergeblich suchte er den Raum nach den nötigen Utensilien zum Feuermachen ab, bevor ihm bewusst wurde, dass Miriam Feuerstein und Zunder überhaupt nicht nötig hatte. Sie mochte keine Feuermagierin sein, aber einen kleinen Funken würde sie mit Leichtigkeit aus der leeren Luft schlagen können. Ärgerlich dachte Ruben daran, dass seine kleine Schachtel mit Zündstein und Feuerschwamm noch in seinem Haus in Vengard am Kamin stand – wenn seine Hütte nicht längst ausgeplündert worden war. Viel Zeit hatte er nicht gehabt, um die Tür wieder im Rahmen zu befestigen, und er bezweifelte, dass seine notdürftige Lösung einem einigermaßen engagierten Fußtritt standhalten würde.
„Okay, ein Feuer...“, murmelte Ruben leise zu sich selbst. „Wie kriegst du jetzt ein Feuer in den Kamin?“
Das Problem war so lächerlich im Vergleich zu seinen sonstigen Sorgen, dass er über das Selbstgespräch fast lachen musste, aber es konnte auch schnell zu einem größeren werden, wenn der Kamin kalt blieb und sich Elias darüber ein paar Gedanken zu viel machte. Für einen Feuermagier war das Anzünden eines Kamins eine Sache von ein paar Sekunden, über die er gar nicht richtig nachdachte – und ein Feuermagier fragte natürlich auch niemanden nach Feuerstein und Zunder. Ein Feuermagier brachte den Kamin einfach zum Brennen, ganz selbstverständlich.
Grübelnd durchwanderte Ruben den Raum, fast froh darum, ein Problem lösen zu können, das ihm viel simpler und klarer schien als alles, worüber er in den Tagen auf See unablässig nachgesonnen hatte. Aber erst, als er von draußen das Knarren einer Tür vernahm und durch das Fenster beobachtete, wie eine junge Dame im beigefarbenen Rock und mit langem, strengem Zopf das benachbarte Haus verließ, zeichnete sich eine Lösung in seinem Kopf ab. Es war das Bild eines rauchenden Schornsteins.
Natürlich war es ein bisschen riskant, aber das war ja nichts Neues für ihn. Im Haus nebenan brannte ein Feuer, es war jetzt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verlassen und seine Dietriche hatte Ruben natürlich nicht zuhause vergessen. Was gab es also noch zu überlegen? Die Werkstatt war weit genug weg von hier, dass er wieder hier sein konnte, bevor Elias mit Miriam zurück war. Er würde sich bloß ein bisschen beeilen müssen.
Ruben nahm ein paar Holzscheite vom Stapel neben dem Kamin und legte sie in die kalte Asche, die das vorherige Feuer hinterlassen hatte. Dann griff er sich eine der zwei Kerzen, die auf der Kommode standen, verbarg sie sicherheitshalber im Ärmel und öffnete die Tür.
Draußen war niemand zu sehen außer der Frau, die in einiger Entfernung den Hang in Richtung der Küste hinabstieg. Bei der Werkstatt nicht, und auch nicht bei den übrigen Häusern, die Ruben von hier aus einsehen konnte. Nur unten am Schiff wuselten die Matrosen und vielleicht auch einige der hiesigen Arbeiter herum, aber die würden gar nichts davon mitbekommen, was er hier oben auf dem Plateau tat. Ein paar flinke Schritte später war er an der Tür des Hauses mit dem qualmenden Schornstein angekommen und warf durch eines der Fenster einen Blick ins Innere. Es war ganz wie er vermutet hatte: Niemand zu sehen. Er huschte zurück zur Tür, hatte im gleichen Atemzug bereits den Dietrich im Schloss versenkt und nach ein paar raschen Drehungen das ersehnte Klicken erzwungen. Jetzt schaute er sich nicht mehr um, drückte die Klinke herunter und zog die Tür auf.
Zum ersten Mal, seit er einen Fuß auf die Bak Shedim gesetzt hatte, wusste er wieder, was Wärme bedeutete. In diesem Fall bedeutete sie leider auch eine drückende Stickigkeit, die Ruben in den ersten Sekunden fast den Atem nahm. Der Raum war ähnlich eingerichtet wie Miriams Wohnstätte, machte auf ihn allerdings einen gänzlich anderen Eindruck. Die Art und Weise, wie die Stühle unter den Tisch gerückt waren, wie die gläserne Karaffe auf der Kommode platziert war, wie die dunkelgelbe Decke auf der Tischplatte lag... es fühlte sich an wie ein sehr rustikales Museum, nicht wie ein Ort, an dem tatsächlich jemand lebte.
Ruben hielt sich nicht lange mit solchen Beobachtungen auf. Er schob die Kerze aus dem Ärmel heraus und hielt sie ins lodernde Kaminfeuer, bis sich der Docht entzündet hatte. Ein, zwei Herzschläge lang wartete er ab, bis er sicher war, dass die Kerzenflamme überleben würde, dann drehte er sich zur Tür um.
Und hielt inne. Er glaubte, etwas aus den Augenwinkeln wahrgenommen zu haben.
Langsam wandte er sich wieder um, und beinahe wäre ihm vor Schreck die Kerze aus der Hand gefallen. Verborgen in einem schattigen Winkel des Raums stand ein Sessel, und auf dem Sessel saß, tief versunken in den dunklen Stoff, eine schmale Gestalt. Die Arme lagen schlaff auf den Lehnen, die Beine waren wie zwei dürre, gerade Stöcke, die im Boden steckten. Die Gestalt rührte sich nicht, hielt ihren Kopf leicht geneigt. Langsam hob und senkte sich ihr Brustkorb. Ihr Mund stand ein wenig offen, fast als atme sie bewusstlos im Schlaf. Ihre Augen aber waren weit geöffnet, und ihr Blick allein auf Ruben gerichtet. Sie schaute ihm unmittelbar in die Augen.
„Klarissa“, sagte Ruben, und seine Stimme war auf einmal sehr wackelig. „Ich habe... nur ein bisschen Feuer geholt.“
An Klarissas Blick änderte sich nichts. Unverändert starrte sie ihn an, einige schmerzhafte Sekunden lang, und als Ruben zu einem weiteren Wort ansetzen wollte, hielt er es nicht mehr aus. Er drehte sich um, riss die Tür auf und stürzte ins Freie. Hastig stieß er die Tür hinter sich zu, achtete gar nicht mehr darauf, ob sie richtig ins Schloss gefallen war, und lief zurück zu Miriams Haus. Als er die Tür hinter sich geschlossen hatte, wunderte er sich selbst darüber, dass die heftig flackernde Kerzenflamme noch brannte. Er hatte überhaupt nicht mehr auf sie geachtet.
Reiß dich zusammen, befahl sich Ruben selbst, während er sich darum bemühte, zu einem ruhigen Atem zurückzufinden. Es gab keinen Grund zu all dieser Aufregung, es war überhaupt nichts passiert. Klarissa würde niemandem von seinem kleinen Einbruch erzählen, wieso also regte er sich so dermaßen darüber auf? Früher hätte ihn eine solche Situation ganz bestimmt nicht aus der Ruhe gebracht. Diese Vergiftung hatte wirklich einen anderen Menschen aus ihm gemacht.
Er erinnerte sich wieder daran, dass die ganze Aktion noch nicht völlig abgeschlossen war und hielt die Kerze an ein paar der kleineren Holzscheite, bis sich nach einigen Versuchen endlich ein Feuer im Kamin festgesetzt hatte. Erleichtert stellte er die Kerze wieder in ihrem Halter auf der Kommode ab. Das erste Problem war also gelöst. Blieben nur noch die schwierigen übrig.
Er trat ans Fenster, um sich zu vergewissern, dass ihn draußen niemand bemerkt hatte, und stellte fest, dass seine Eile durchaus angemessen gewesen war: Denn während Ruben noch seinen Blick über die wie ausgestorben wirkende Siedlung schweifen ließ, öffneten sich die Tore der Werkstatt und zwei Menschen traten ins Freie. Im ersten Moment war sich Ruben ganz sicher, dass es sich um Elias und Miriam handeln musste, aber als sie ein wenig näher gekommen waren, bemerkte er, dass er mit dieser naheliegenden Vermutung nur zur Hälfte richtig gelegen hatte: Es war in der Tat Elias, der zu ihm zurückkehrte, aber begleitet wurde er nicht von der Magierin, sondern von einem schwarzhaarigen Mann in Lederrüstung.
Ruben öffnete den beiden die Tür und wartete ihre Ankunft ab. Je näher sie kamen und je deutlicher er den Ausdruck auf ihren Gesichtern lesen konnte, desto mulmiger wurde ihm zumute. Irgendetwas stimmte nicht, das war offensichtlich.
„Alles in Ordnung?“, rief er ihnen zu, als sie in Hörweite geraten waren. „Ist Miriam nicht in der Werkstatt?“
Elias schüttelte den Kopf, aber erst als er mitsamt seinem Begleiter die Türschwelle erreicht hatte, sagte er den einen Satz, den Ruben an diesem Tag als allerletztes hatte hören wollen.
„Sie ist weg.“
„Weg?“, entfuhr es Ruben. „Aber... was soll das heißen? Sie muss doch hier irgendwo sein?“
„Ihr seid Meister Ruben, nicht wahr?“ Der Mann in der Lederrüstung machte eine Art ungelenke Verbeugung, die er wohl für die angemessene Form der Magierbegrüßung hielt. „Darf ich mich vorstellen? Jobst, mein Name, ich bin der Nachtwächter auf Irdorath.“
„Ja, sehr... schön“, stammelte Ruben, der noch immer nicht wusste, wie ihm geschah. „Aber was ist nun mit Miriam?“
Er hatte seine Worte mehr an Elias gerichtet als an den Nachtwächter, aber sein Freund aus früheren Tagen schaute ihn gar nicht an. Er war auffällig bleich geworden und seine Lippen zitterten. Rubens Blick fiel auf den obersten Knopf am Mantel des Magiers, und in einem kurzen, absurden Moment lobte er sich selbst in Gedanken dafür, wie großartig er diesen Knopf wieder hinbekommen hatte. Aber schon im nächsten Moment war die schreckliche Ahnung wieder da, die Ahnung davon, auf welche katastrophale Art und Weise sein Plan und sein ganzes Leben von diesem Moment an unvermeidlich scheitern konnten. Drei Worte hatten gereicht, um alle Gedanken über den perfekten Diebstahl und den richtigen Umgang mit der Kugel obsolet zu machen. Sie war weg.
„Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen“, fuhr Jobst fort und räusperte sich. „Wie ich Meister Elias bereits mitteilen musste, ist Meisterin Miriam schon wenige Stunden nach des Meisters Abreise nach Vengard aus der Siedlung verschwunden. Wir alle hier auf Irdorath sind seit mehr als zwei Wochen in großer Aufregung, wie Ihr Euch denken könnt.“
„Was soll das heißen, sie ist verschwunden?“, unterbrach Ruben die Ansprache des Nachtwächters. „Sie wird sich ja nicht einfach so in Luft aufgelöst haben! Habt ihr denn nicht nach ihr gesucht?“
„Natürlich haben wir das getan. Tatsächlich verfügen wir auch über einen Hinweis auf den Ort ihres Verbleibens. Mehrere Quarzhauer wollen sie beim Betreten des Tempels beobachtet haben.“
„Der alte Beliartempel? Was wollte sie denn da?“
„Wir können uns auch keinen Reim darauf machen“, sagte Jobst. „Sie ist in der Vergangenheit manchmal zuliebe eines Hauers hineingegangen, der glaubte, etwas Verdächtiges gesehen oder gehört zu haben. Aber an diesem Tag hat sich niemand wegen solcher Vorkommnisse bei ihr gemeldet. Wir können nur mutmaßen, weshalb sie in den Tempel gegangen ist.“
„Was ist mit ihrer Kugel? Hatte sie die dabei?“ Ruben wusste, dass ihn diese Frage verdächtig machen konnte, aber im Augenblick kümmerte es ihn nicht. Es war die Frage, die ihm die ganze Zeit schon auf der Zunge lag, und er musste sie endlich loswerden. Zu seiner Überraschung war es allerdings nicht der Nachtwächter, der antwortete, sondern Elias.
„Ja. Die Kugel ist fort. Miriam, die Kugel... sie sind beide fort.“
„Nun, ich bin nicht darüber unterrichtet, welche Bewandnis es mit der Glaskugel hat, die Meisterin Miriam am Tage ihres Verschwindens bei sich trug“, meldete sich Jobst nun doch noch zu Wort. „Wir bangten natürlich zuvorderst um die Meisterin selbst. Leider hat sie den Tempel bis heute nicht verlassen, und wir wissen nichts von ihrem Verbleiben.“
„Aber ihr habt doch nachgeschaut, oder?“ Ruben wusste nicht, ob es an der allzu disziplinierten Sprechweise des Nachtwächters lag oder an der sich verstetigenden Erkenntnis, dass gerade alles ganz gehörig den Bach herunterging, aber er spürte plötzlich einen ordentlichen Zorn in sich aufsteigen. „Ihr habt doch den Tempel durchsucht, oder etwa nicht?“
„Wir haben die Höhlen in der Nähe des Quarzbruches durchsucht“, antwortete Jobst. „In den Tempel selbst sind wir nicht vorgedrungen, da uns dies auf Anweisung von Meister Elias und Meisterin Miriam nicht gestattet ist.“
Ruben zweifelte zwar nicht daran, dass es dieses Verbot wirklich gab, wurde aber das Gefühl nicht los, dass Jobst ziemlich glücklich über die Ausrede war. Vermutlich war er ähnlich erpicht darauf wie die Bergarbeiter, einen Ausflug in den alten Beliartempel zu unternehmen.
„Das heißt, sie ist seit mehr als zwei Wochen dort? Und niemand hat versucht, sie herauszuholen?“
„Sie ist tot“, sagte Elias, und es klang so endgültig und niederschmetternd, dass nicht einmal der Nachtwächter noch etwas sagen wollte.
„Aber das wissen wir doch überhaupt nicht“, beendete Ruben die kurze, aber äußerst unangenehme Stille. „Solange noch niemand den Tempel nach ihr durchsucht hat, ist doch alles möglich.“
Elias schüttelte den Kopf. „Niemand überlebt so lange im Tempel. Es gibt dort keine Nahrung, kein Trinkwasser. Vielleicht ist sie gestürzt und in eine Schlucht gefallen. Oder eine Säule ist über ihr zusammengefallen und hat sie begraben. Aber was ihr auch passiert ist, sie kann keine zwei Wochen dort überlebt haben.“
„Sie ist eine Magierin“, versuchte Ruben zu widersprechen, fühlte aber, dass er sich mit diesem Argument auf ziemliches Glatteis begab. Das konnte für Elias ja kaum etwas Neues sein. „Woher weißt du, dass sie keine Möglichkeit gefunden hat? Wenn es eine schafft, dann ist es ja wohl Miriam, oder? Und wir wissen doch überhaupt nicht, wie viel Proviant sie mitgenommen hat. Vielleicht hat sie ja sogar vorgehabt, so viel Zeit dort zu verbringen, aus welchen Gründen auch immer.“
Elias reagierte gar nicht, und noch immer schaute er ihm nicht in die Augen, was Ruben inzwischen fast verrückt machte. Er war ganz sicher nicht bereit dazu, Miriams Schicksal – und damit sein eigenes – einfach so zu akzeptieren.
„Elias!“ Er packte den Mann, dessen grauer Mantel wohl noch nie so gut zu seinem Gesicht gepasst hatte, an den Schultern und rüttelte ihn durch, bis er sich dazu gezwungen sah, aufzublicken. „Du wirst doch Miriam nicht aufgeben! Kann ja sein, dass ihre Chancen nicht gut stehen, aber es kommt überhaupt nicht infrage, dass wir sie deswegen gleich für tot erklären. Es könnte alles mögliche passiert sein, aber wir werden es nur herausfinden, indem wir in den Tempel gehen und nachschauen!“
„Ist ja gut.“ Ärgerlich schob der Magier Rubens Hände von seinen Schultern. „Natürlich müssen wir im Tempel nachschauen. Ich habe ja bloß gemeint, dass wir uns keine falschen Hoffnungen machen sollten.“
„Nun, ich wünsche Euch viel Erfolg bei Eurer Unternehmung“, sagte der Nachtwächter, und es war ihm deutlich anzumerken, dass er die Aufforderung dazu fürchtete, sie in den Tempel zu begleiten. Elias schien daran aber kein Interesse zu haben.
„Wir sollten uns gleich aufmachen“, sagte er an Ruben gerichtet. „Noch ist es Vormittag, und je mehr Tageslicht durch die Ritzen und Löcher der Tempeldecke dringen kann, desto besser. Wir werden auch so noch die meiste Zeit über einen Lichtzauber brauchen, aber zumindest haben wir dann in den äußeren Bereichen des Tempels keine völlige Dunkelheit mehr vor Augen.“
Obwohl Ruben erleichtert darüber war, dass Elias den ersten Schock allmählich zu verkraften schien, hatte er die letzten Worte des Magiers nicht ganz ohne Unbehagen aufgenommen. Er konnte nur hoffen, dass Elias mit diesem einen Lichtzauber seinen eigenen meinte...
▦
„Ach, hol mich doch Beliar, so ein Dreck!“
Der Lichtzauber war so unvermittelt erloschen, dass Elias die Stufe nicht richtig erwischt hatte und ins Stolpern geraten war. Er hatte den Fall zwar mit den Händen abdämpfen können, aber das Gelenk der rechten Hand schmerzte, und der letzte tanzende Funken des Zaubers schien seinen Erschaffer kurz vor dem endgültigen Erlöschen noch verspotten zu wollen. Im nächsten Augenblick war es stockdunkel. Sie waren so tief in die Eingeweide Irdoraths vorgedrungen, dass sich kein Sonnenstrahl mehr über eine Lücke im Gestein in das Tempelinnere verirrte.
„Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist, sowas zu sagen?“, hörte er Rubens Stimme gleich hinter sich. „Ich meine, ausgerechnet hier...?“
„Es ist eine verdammte Ruine“, brummte Elias verstimmt. „Beliar hört uns hier genauso wenig zu wie irgendwo anders auf der Welt.“
Wieso sparte sich Ruben solche unsinnigen Kommentare nicht einfach und sorgte lieber für einen neuen Lichtzauber? Es ärgerte ihn gewaltig, dass er an diese kleine, eigentlich selbstverständliche Hilfestellung nicht einmal zu denken schien. Aber was wunderte es ihn? Ein schnöder Lichtzauber war bestimmt weit unter Rubens Würde, für so etwas hatte ein Feuermagier dann ja seine Novizen.
Elias war kurz davor, eine bissige Bemerkung darüber auszusprechen, aber biss stattdessen die Zähne zusammen und erschuf kommentarlos selbst eine weitere Lichtkugel, die über seinen Kopf schwebte und dort flackernd verharrte. Es hatte keinen Zweck, Streitigkeiten zu provozieren. Sie durften sich auf keinen Fall von der Suche nach Miriam ablenken lassen. Zumindest in dieser Hinsicht konnte er Ruben aber keinen Vorwurf machen: Er wollte sie offenbar ebenso sehr zurückhaben wie er selbst. Noch immer verblüffte es ihn, wenn er daran dachte, wie ehrlich betroffen sich Ruben von Miriams Verschwinden gezeigt hatte. Vielleicht hatte er ihn tatsächlich falsch eingeschätzt. Er hatte nicht geglaubt, dass Ruben überhaupt der Einladung nach Irdorath folgen würde, und doch war er hier. Es wäre ein Leichtes für ihn gewesen, sich nun einfach zurückzuziehen und am nächsten Morgen wieder mit dem Schiff nach Vengard aufzubrechen. Aber stattdessen war er an seiner Seite und stolperte gemeinsam mit ihm durch dunkle und feuchte Ruinen. Und wenn Elias ehrlich zu sich war, dann musste er sich eingestehen, dass er ihm sehr dankbar dafür war.
„Hast du dich verletzt?“ Der Feuermagier streckte die Hand aus und half ihm wieder auf die Beine.
„Nein, nein, geht schon“, versicherte Elias und nahm die letzten paar Stufen zur Bestätigung seiner Worte besonders schnell. Der Raum, in den sie jetzt eintraten, war eine kleine Krypta der Schwarzmagier. Im kühlen, weißen Licht des Zaubers schälten sich mehrere massive Steinsärge aus der Dunkelheit. Elias wusste nicht, ob er es sich bloß einbildete, aber die Luft schien in diesem Teil des Tempels noch ein wenig modriger zu sein als anderswo.
„Hier wurden Leute begraben?“, wunderte sich Ruben. „In einem Tempel?“
„In einem Tempel des Totengottes“, ergänzte Elias. „Reicht das als Erklärung?“
Ruben murmelte etwas Zustimmendes und schritt die Reihe der Särge ab, während sich Elias auf der anderen Seite der Krypta umsah.
„Das müssen aber sicher wichtige Leute sein, die hier begraben wurden, oder?“, erkundigte sich Ruben. „Irgendwelche Schwarzmagier, nehme ich an?“
„Vermutlich. Aber die Särge sind alle leer. Miriam vermutet, dass die Leichen als untote Wächter aus den Särgen gestiegen sind, als der Tempel damals von den Paladinen gestürmt wurde. Sie glaubt, dass sie hier überall in Einzelteilen auf dem Boden liegen.“
Elias stieß zur Verdeutlichung einen Haufen halb zerfallener Knochen mit dem Fuß an. Tatsächlich fanden sich überall im Tempel verstreute Knochen und Schädel, aber er war nicht ganz überzeugt davon, dass sie wirklich einen hinreichenden Beweis für Miriams Theorie darstellten. Er hatte sie vielmehr von Anfang an als die naheliegendste Form der Dekoration begriffen.
„Tja, Miriam werden wir hier wohl jedenfalls nicht finden“, sagte Ruben, aber Elias packte ihn am Ärmel, als er den Raum wieder verlassen wollte.
„Wir haben noch nicht in den Särgen nachgesehen.“
„Was? Du denkst...?“
„Wir müssen zumindest nachsehen, oder?“
Ruben seufzte und wandte sich dem Sarg zu, der dem Eingang am nächsten stand. Vorsichtig strich er mit dem Finger über den Deckel und malte so eine kurze Linie in den Staub.
„Kriegen wir überhaupt den Deckel weggeschoben? Scheint ja ganz schön schwer zu sein.“
„Ich habe ihn zusammen mit Miriam aufbekommen, also schaffen wir beide das auch“, sagte Elias und stellte sich auf die andere Seite des Sarges. „Du schiebst und ich ziehe, ja?“
Er nickte Ruben zu und hatte gerade den etwas hervorstehenden Rand des Sargdeckels gepackt, als sein Blick in Richtung des steinernen Türrahmens fiel, der den Eingang des Raums markierte. Irgendwo dort, wo die Treppe hinunter in die Schwärze führte, war für sehr kurze Zeit ein Licht aufgeflammt.
„Hey, was soll das? Du ziehst ja gar nicht!“
„Still!“, zischte Elias. „Da war irgendwas.“
Ruben löste die Hände vom Sarg und hielt sie etwas unschlüssig in der Luft. „Was meinst du?“
„Da war ein Licht. Unten, am Ende der Treppe. Irgendjemand ist mit uns im Tempel.“
„Miriam?“, wisperte Ruben.
„Ich... weiß nicht.“ Es war ein allzu verlockender Gedanke, aber leider kein besonders schlüssiger. „Vielleicht ist sie es. Aber wieso hat sie sich dann nicht zu erkennen gegeben? Sie muss uns doch gehört haben.“
„Wir müssen auf jeden Fall nachschauen“, sagte Ruben. „Schnell, bevor sie wieder abgehauen ist.“
Als sie die Treppe wieder hinabgestiegen waren, spielte Elias mit dem Gedanken, das magische Licht zu löschen, um mögliche andere Lichtquellen leichter ausmachen zu können. Die Vorstellung, in völliger Finsternis zu verbleiben, während womöglich irgendein Fremder um sie herum schlich, ließ ihn diese Idee allerdings gleich wieder verwerfen.
„Siehst du was?“, flüsterte Ruben.
Elias schüttelte frustriert den Kopf. „Es war aber da, ich bin mir ganz sicher. Irgendwer ist hier in der Nähe.“
„Sicher, dass es nicht bloß eine Spiegelung war? Vielleicht hat irgendwas unser eigenes Licht reflektiert, zum Beispiel eine der Marmorfliesen da an der Wand...“
„Das kann es nicht sein“, widersprach Elias. „Es war ein anderes Licht, ein wärmeres. Wie von einer Flamme.“
„Meinst du, Miriam würde eine Fackel benutzen? Vielleicht hat sie ihre Lichtrune nicht dabei, oder... hm...“
Elias antwortete nicht. Er wusste doch auch nicht, was er glauben sollte. Plötzlich war er sich nicht einmal mehr so sicher, ob ihm seine Sinne nicht doch einen Streich gespielt hatten. Er hatte eine ganze Weile lang nicht geschlafen, da konnte man sich so ein Licht sicher schon einmal einbilden, oder?
„Elias“, raunte Ruben plötzlich. „Komm mal her. Hier ist irgendwas.“
Er kam der Aufforderung nach, und Ruben deutete auf eine Stelle zu ihren Füßen, die nun vom magischen Licht beschienen wurde. Der Boden war in diesem Abschnitt des Tempels mit unterschiedlichen Steinen aus Marmor und Granit gepflastert, dunkle Gesteine zumeist, und auf der Oberfläche mehrerer dieser Steine war eine glänzende Flüssigkeit versprenkelt.
„Ist das Öl?“
„Sieht ganz danach aus. Öl oder Tran, oder etwas in der Art.“ Elias bückte sich und berührte die Flüssigkeit mit dem Zeigefinger. „Hm. Warm.“
„Eine Lampe“, schloss Ruben. „Sie muss eine Lampe bei sich getragen haben. Und als sie gerade vor uns weg gelaufen ist, hat sie in der Hektik ein bisschen was von dem Öl verschüttet.“
„Schon möglich. Aber Miriam wäre bestimmt nicht vor uns geflohen.“
„Wer soll es sonst sein? Glaubst du, es ist uns jemand aus der Siedlung nachgegangen?“
Elias hielt das für sehr unwahrscheinlich. Aber es gab etwas anderes, das sein Interesse geweckt hatte, und anstatt auf Rubens Frage eine Antwort zu geben, ging er ein paar Schritte an ihm vorbei, ohne den Blick zu heben.
„Schau mal, Ruben, hier sind noch mehr Öltropfen. Vielleicht haben wir Glück, und unser Fremder hat uns unfreiwillig eine Fährte hinterlassen.“
„Unfreiwillig... oder freiwillig“, murmelte der Feuermagier. „Hoffen wir mal lieber, dass uns nicht irgendwer in eine Falle locken will.“
Rubens Misstrauen überraschte Elias ein wenig, denn er selbst hatte in eine solche Richtung überhaupt nicht gedacht. „Eine andere Spur haben wir gerade nicht. Aber du hast Recht, lass uns aufmerksam bleiben.“
Tatsächlich hatten sie keine großen Schwierigkeiten, weitere Öltropfen auf dem Boden auszumachen. Die Fährte führte sie zurück in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Zurück durch die steinernen Flure, vorbei an den kleinen quadratischen Räumen, die wohl einmal die Wohnquartiere der Schwarzmagier gewesen sein mussten. Im Vorbeigehen schaute Elias noch einmal durch die längst türlosen Eingänge und fragte sich nicht zum ersten Mal, wie das Leben hier wohl einmal gewesen war. Die Betten, Tische und Regale, mit denen die Leute hier gelebt hatten, sie waren noch immer hier. Ruhig und geduldig waren sie an Ort und Stelle verblieben und hofften vielleicht darauf, eines Tages wieder jemandem von Nutzen sein zu können. Aber nicht einmal Spinnen gab es auf Irdorath, die zwischen den verlassenen Möbeln ihre Netze hätten spannen können. Nur Staub, den gab es in allen Ecken und auf allen Flächen, und wenn man ihn zwischen den Fingern zerrieb, dann stellte man fest, dass er zu großen Teilen aus feinem, auseinandergefallenem Felsgestein bestand. Es war ein wenig, als wollte die Insel die Löcher, die man in sie geschlagen hatte, über die Jahrzehnte hinweg wieder auffüllen und versiegeln. Als heilte sie sehr langsam ihre tiefen Wunden.
Nachdem sie die Wohnbereiche hinter sich gelassen hatten, traten sie zwischen einer Vielzahl großer Säulen hinaus in eine natürliche Höhle von gewaltigen Ausmaßen. Die Felsendecke befand sich weit über ihren Köpfen, viel zu weit um sie im kleinen Radius ihrer schwebenden Lichtquelle erkennen zu können. Elias wusste, dass dieser Teil der Unterwelt Irdoraths einer der gefährlichsten war, gab es hier doch nicht bloß mehrere kleinere Gräben, in denen leicht mal ein Fuß umknicken konnte, sondern auch eine tiefe Schlucht, die den begehbaren Teil der Höhle durchschnitt. Zwar hatten die Schwarzmagier über die Schlucht eine steinerne Brücke errichtet, die glücklicherweise noch immer einen stabilen Eindruck machte, doch in der Dunkelheit war der verhängnisvolle Fehltritt immer nur eine kurzzeitige Unaufmerksamkeit entfernt.
„Da hinten.“
Als sich Elias zu seiner Rechten wandte und in die Richtung schaute, in die Ruben wies, da sah er es erneut. Und diesmal gab es keine Zweifel mehr: ein fieberhaft flackerndes, orangefarbenes Licht jenseits der großen Schlucht. Das Geräusch ferner, aber tausendfach widerhallender Schritte auf dem Stein. Jemand war auf der Flucht vor ihnen.
„Schnell“, zischte Elias dem Feuermagier zu, und mehr Worte brauchte es nicht. Natürlich musste Ruben die gleiche Vermutung haben wie er selbst: Dass diese Person, die sie nun raschen Schrittes verfolgten, vielleicht nicht Miriam selbst war, aber doch mit einiger Wahrscheinlichkeit etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hatte.
Nachdem sie die Brücke überquert und die Schlucht hinter sich gelassen hatten, traten sie in eine weitere große Höhle ein, deren Decke diesmal allerdings niedriger und zudem löchriger war. Mehrere schmale Sonnenstrahlen beleuchteten Teile der schwarzen Felswände, und ein stetiges Tröpfeln durchbrach die sonst vorherrschende Stille in den unterirdischen Gewölben. Elias hatte seinem Begleiter bereits auf dem Hinweg erklären müssen, dass es sich bei der Flüssigkeit, die hier an einigen Stellen von der Decke tropfte, leider um Salzwasser handelte, mit dem Miriam ihren Durst nicht gestillt haben konnte. Aber Miriam war ohnehin nicht hier, davon hatten sie sich längst überzeugt.
Im ersten Moment war es angenehm, wieder natürliches Tageslicht zu erblicken, doch es dauerte nicht lange, bis Elias bewusst wurde, dass ein anderes Licht dafür verschwunden war.
„Wo ist sie hin?“, flüsterte er Ruben zu, während sie Seite an Seite über den rauen Höhlenboden eilten, so schnell es ihnen die gebotene Vorsicht erlaubte.
„Vielleicht hat sie die Lampe ausgemacht. Hier ist es ja auch so hell genug.“
Vergeblich versuchte er, die Gestalt irgendwo in der Höhle auszumachen. Aus dem schummrigen Halbdunkel zeichneten sich bloß Steinsäulen ab. Nichts, was sich bewegte. Und verräterische Ölflecken auf dem Boden waren auch nicht zu erkennen.
„Wohin gehen wir jetzt?“, wisperte Ruben. „Zurück an die Oberfläche?“
Es ärgerte Elias gewaltig, dass sie die Spur so kurz vor der entscheidenden Stelle verloren hatten. Entweder sie entschieden sich für den Durchbruch an der Höhlenwand, die sich am Ende des langen Dunkels zu ihrer Linken befand, gingen wieder nach draußen und hofften darauf, die unbekannte Person irgendwo im Quarzbruch aufzuspüren, oder aber...
„Nein. Wenn er in diese Richtung gegangen ist, dann finden wir ihn ohnehin nicht mehr wieder. Zu viele Möglichkeiten, sich zu verstecken oder unter die Arbeiter zu mischen. Wenn es nicht sowieso einer der Arbeiter ist.“
„Was ist die andere Möglichkeit? Geradeaus?“, wollte Ruben wissen. „Wo geht es da hin?“
„In die Grotte“, sagte Elias. „Das ist eine Sackgasse. Wir können nur darauf hoffen, dass er dorthin gegangen ist.“
Er kam sich plötzlich ziemlich dumm dabei vor, alles auf die Annahme zu setzen, dass ihr rätselhafter Fremder sich selbst in eine ausweglose Lage gebracht hatte. Aber nun war die Entscheidung gefallen, und Ruben meldete keinen Widerspruch an.
Keine Minute später hatten sie die große Höhle hinter sich gelassen und stiegen eine kurze Treppe hinab, die jemand in den Stein des offenbar natürlich entstandenen Steintunnels geschlagen hatte. Miriam hatte einmal die Vermutung geäußert, dass es in diesem äußeren Bereich des Tempels früher einmal weitere Gänge und Räumlichkeiten gegeben hatte, die allerdings bei einem Erdbeben oder einer anderen Erschütterung unter Felsen und Geröll begraben worden waren. Vielleicht war es durchaus denkbar, dass es vor zwei Wochen ein weiteres derartiges Vorkommnis gegeben hatte, und dass Miriam dabei verschüttet worden war. Aber davon hätten sie doch sicherlich auch an der Oberfläche etwas mitbekommen? Er konnte sich auch keinen Grund denken, wieso Miriam überhaupt in diese kahlen Höhlengänge hätte vordringen sollen. In den inneren Tempelhallen gab es hier und da verwitterte Inschriften im Gestein, es gab schwarze Gesichter aus Granit, die von den Wänden starrten, und es gab in einem Raum eine merkwürdige glänzende Scheibe im Boden, über die Miriam einmal die gruselige Phantasie entwickelt hatte, sie könnte den Zauber gewirkt haben, der einst alles Leben von Irdorath gebannt hatte und der vielleicht noch immer nicht vollends erloschen war. Es gab dort also noch einiges, das sich erforschen ließ, und obwohl Elias nicht verstand, wieso sich Miriam angesichts der viel größeren und aufregenderen Geheimnisse, die sich in der erfolgreich gefertigten Kugel verbergen mochten, auf einmal wieder mit den längst bekannten Rätseln des Beliartempels beschäftigen sollte, so wusste er doch zumindest, dass es in diesen tieferen Bereichen des Tempels Dinge gab, die Miriam faszinierten. In der Grotte und den anliegenden Tunneln allerdings gab es überhaupt nichts von Interesse. Die Schwarzmagier hatten hier vermutlich Waren gelagert, die mit den Schiffen angekommen waren, aber davon war nichts übrig geblieben. Er konnte sich kaum denken, dass sie Miriam ausgerechnet hier finden würden, und damit war auch kaum noch Hoffnung übrig, dass sie sie überhaupt finden würden. Bisher sah alles nach einem Sturz in den Abgrund aus, was nur bedeuten konnte, dass sie niemals Gewissheit über Miriams Verbleib haben würden. Der Unbekannte, den sie verfolgten, war die letzte Hoffnung, die geblieben war. Vielleicht hatte dieser Eindringling eine Erklärung, vielleicht war er der Schuldige an Miriams Verschwinden... und vielleicht, dachte Elias finster, war er in diesen Minuten längst auf dem Weg zurück in die Siedlung und sie würden niemals herausfinden, mit wem sie es eigentlich zu tun hatten. All die Stunden, die sie in der nasskalten Finsternis verbracht hatten, sie waren wohl umsonst gewesen. Und währenddessen hatte die ganze Zeit über Klarissa darauf gewartet, dass er endlich zu ihr kam. Er hatte sie dort sitzen lassen, allein in der Verwahrlosung, und sich nur um eine bemüht, die wohl gar nicht mehr zu retten war.
„Ist das die Grotte?“ Angesichts der besseren Lichtverhältnisse war es nicht mehr nötig, nah beieinander im Lichtkreis des Zaubers zu bleiben, sodass Ruben ein paar Schritte vorausgegangen war. Elias schloss zu ihm auf, als sie beide am Ende des Tunnels angelangt waren.
„Ja, das ist sie.“
Es fühlte sich beinahe so an, als wären sie bereits wieder an der Oberfläche angekommen. In gewisser Weise stimmte das auch, denn von der zum Meer hin offenen Seite der Wassergrotte drang grelles Tageslicht hinein, das Elias für ein paar Sekunden zum Zukneifen der Augen zwang. Meeresrauschen drang an ihre Ohren, und der Geruch von Salzwasser brachte seine Nase zum Jucken. Ein sanfter Abhang führte hinab zum Wasser, wo vor langer Zeit einmal die Schiffe der Schwarzmagier geankert hatten. In den heutigen Zeiten allerdings –
„Sag mal, siehst du das auch?“ Ruben stieß ihm mit dem Ellbogen in die Seite. „Das ist doch... ein Mast, oder?“
Ohne eine Antwort zu geben, schritt Elias ein paar Schritte vorwärts die Steigung hinab, bis ihm keiner der großen Felsen, die den Abhang säumten, mehr das Blickfeld versperrte und er freie Sicht hatte auf die kleine Bucht im Inneren der Grotte. Halb hatte er erwartet, dass sich Ruben verguckt hatte, dass es bloß ein länglicher Felsen oder vielleicht ein Schatten gewesen war, den er gesehen hatte. Aber zu seiner Verblüffung musste Elias feststellen, dass der Feuermagier erneut einen klaren Blick bewiesen hatte: Es lag tatsächlich ein Schiff in der Höhlenbucht vor Anker. Ein kleines zwar, mit nur zwei eingeklappten Segeln und ohne die Spur einer Besatzung – aber es war zweifelsohne ein Schiff. Ohne dass sie es bemerkt hatten, war jemand auf die Insel gekommen.
„Miriam!“, stieß Elias aus, als er diesen Gedanken halberlei verdaut hatte und zum nächsten gekommen war. „Sie muss auf dem Schiff sein! Vielleicht wurde sie entführt – oder –“
„Ich habe niemanden entführt.“
Einen wirren Moment lang glaubte Elias, Ruben hätte diese Worte ausgesprochen, aber die Stimme war höher gewesen und weniger lebhaft. Kühler. Erst als der Feuermagier einen Schritt auf den großen Fels zu ihrer Rechten zumachte, bemerkte Elias die Gestalt, die daran lehnte.
Es war eine ebenso kleine wie ausgesprochen schmale Figur, und ihr dürrer Körper war umwickelt und eingehüllt in mehrere Lagen halb zerrissener Stoffbänder, die so schwarz waren wie das Gestein, an das sie sich drückte. Ihre langen, spröden Haare waren vor Jahren einmal strahlend blond gewesen, aber nun waren sie verblichen wie ein alter Brief, der zu lange auf dem Fenstersims gelegen hatte. In ihrer Hand pendelte an einem dünnen Bügel leise quietschend eine erloschene Laterne, doch Elias beachtete sie kaum. Es war das Gesicht der Frau, das ihn gefangen hielt, und das Ruben im gleichen Augenblick erkannt haben musste wie er selbst. Bleicher, eingefallener, und um zwei lange Narben quer über Wange und Stirn bereichert, aber mit dem gleichen verhassten Ausdruck in den grauen Augen.
„Teresa?“ Schon in der ersten Verblüffung dieses einen, lange vergessenen Namens aus Rubens Mund lag eine Spur der Wut, die Elias in sich selbst hochkommen fühlte.
„Hört zu“, setzte sie an. „Ich wollte nicht –“
„Wo hast du die Kugel?“
Teresa entfuhr ein kleiner Schrei, als Ruben den letzten Abstand zu ihr überwand und sie an der Schulter packte.
„Was hast du mit Miriam gemacht?“
„Gar nichts habe ich gemacht! Ich weiß überhaupt nichts von –“
„Du hast schon wieder alles ruiniert, oder? Du tauchst immer nur auf, um alles zu ruinieren, du verdammte –“
„Ruben.“ Sanft, aber bestimmt fasste Elias seinen aufgebrachten Freund am Arm und zog ihn von der dürren Frau in den schwarzen Lumpen weg. So sehr er Rubens Zorn auch teilte – er wollte nicht, dass er sie den Abhang hinunterstieß oder ihr sonst etwas antat. Sie brauchten Antworten, und die würden sie von einer toten Teresa nicht mehr bekommen.
„Was denn?“, herrschte ihn der Feuermagier an. „Es ist doch offensichtlich, oder etwa nicht? Sie hat von eurer Unternehmung erfahren, und nachdem sie selbst immer noch nichts auf die Reihe bekommt, hat sie sich auf den Weg gemacht, um euch alles zu ruinieren – um uns alles zu ruinieren!“
Natürlich hatte Elias den gleichen Gedanken gehabt, schon in dem Moment, in dem er zum ersten Mal seit mehr als neun Jahren in Teresas Augen gesehen hatte. Er hatte gehofft, dass die Erinnerung an dieses Gesicht nie wieder eine Auffrischung erfahren würde. Dass er es einfach vergessen konnte, und dass er alles, was der Geist hinter diesem Gesicht angerichtet hatte, als üblen Akt eines launenhaften Schicksals hinnehmen konnte, den es zu akzeptieren und als einzige mögliche Realität zu begreifen galt. Aber jetzt war dieses Mädchen von damals wieder hier, und es sprach alles dafür, dass es ihm auch noch den anderen Menschen genommen hatte, der ihm etwas bedeutete – dieses Mal gründlicher und endgültiger als zuvor.
„Es ist fast ein Jahrzehnt vergangen“, sagte Teresa mit leiser Stimme, die vor Kälte klirrte, „und ihr könnt mir noch immer nicht verzeihen. Ich habe mit nichts anderem gerechnet, und ich werde ganz sicher kein weiteres Mal um Verzeihung bitten.“
„Frag doch Klarissa, ob sie dir verzeihen kann!“
Als Ruben den Namen ausspie, erstarrte all der Zorn, den Elias in sich gespürt hatte, und er fühlte sich von einer lähmenden Schwermut ergriffen.
„Sie kann dir ganz sicher nicht verzeihen!“, brüllte Ruben, und der Schall seiner Worte schmerzte in Elias’ Ohren. „Weil sie überhaupt nichts mehr kann! Sie sitzt da oben in ihrem Sessel und glotzt vor sich hin wie eine bessere Zimmerpflanze! Und das macht sie seit zehn Jahren, und das wird sie auch in zehn und zwanzig und dreißig Jahren noch machen! Wie soll das irgendjemand verzeihen können? Du hast das angerichtet, Teresa! Du hast das getan!“
Teresa war verstummt, und in Elias’ Schädel kreisten die Gedanken. Er fragte sich, wann Ruben Klarissa in ihrem Sessel gesehen hatte, versuchte sich an dieser harmlosen Frage festzuhalten, aber es währte nicht lange. Bald war Teresas Gesicht wieder narbenlos und jung, ihre Augen funkelten wagemutig und ihre Hände taten das Schrecklichste.
Merdarions Gesicht tauchte vor dem schwarzen Grund des Irdorath-Gesteins auf, sorgenvoll und geschlagen. Es war das Gesicht, das er gehabt hatte, als er den Wachen in die Kaserne gefolgt war. Als sie ihn stundenlang ausgefragt hatten, über jede Einzelheit. Über die Lieferung aus dem fernen Magierturm, den man den unsichtbaren Turm nannte. Dutzende Male hatten sie ihn gefragt. Ob er nicht gewusst hätte, welche gefährlichen Artefakte er da bekommen hatte. Ob es verantwortungsvoll war, derart riskante Studien und Experimente mitten in einer belebten Stadt durchzuführen, und das als Diener Adanos’. Ob er nicht an die Menschen gedacht hätte. Nicht an seine Schüler gedacht hätte.
Natürlich hatte Merdarion all das bedacht. Er hatte die Kiste mit den Artefakten aus dem unsichtbaren Turm in der tiefsten Kammer des Kellers verborgen, er hatte die Tür stets verschlossen gehalten und nie geöffnet, und er hatte seinen fünf Schülern eindringlich untersagt, überhaupt das unterste Geschoss zu betreten, geschweige denn die Tür zu öffnen. Aber Teresa hatte all das getan. Sie hatte die Kiste geöffnet, und sie hatte eines der Artefakte benutzt. Elias wusste nicht, welcher Art das Artefakt gewesen war und was Teresa getan hatte, um seine Kräfte freizusetzen. Er kannte nur die Folgen.
Vierzehn Menschen in der benachbarten Handwerkergasse waren wahnsinnig geworden. Die Tiere hatten Besitz von ihren Köpfen ergriffen, und die meisten waren aufeinander losgegangen. Zwei hatten sich gegenseitig die Haare und die Haut in Fetzen vom Körper gerissen. Einer war von der Stadtmauer gesprungen, vielleicht weil er sich für einen Geier gehalten hatte oder für eine Blutfliege. Nur eine einzige außer Teresa war zu dieser Zeit in Merdarions Haus gewesen, und niemand wusste, welche Tierseele an diesem Abend in sie gefahren war. Aber während Merdarion die anderen Leute im Geiste hatte heilen können, wenn auch manche körperlich versehrt blieben, hatte er Klarissa nicht zu helfen gewusst. Sie war stumm und regungslos geblieben, ein bloßes Zwinkertier, seit bald zehn Jahren.
Es war nicht Teresa gewesen, die dafür hatte büßen müssen, sondern Merdarion. Elias hatte nie verstanden, wieso er alle Schuld auf sich genommen hatte. Man hatte ihn aus dem Kreis der Wassermagier verstoßen und von Khorinis verbannt, und es war seinem letzten langen Blick vor der Abreise anzumerken gewesen, dass beides gemeinsam einem Todesurteil gleichkam für diesen alten Mann, der sich schon seit Jahren nur noch für seine Studien und seine Schüler am Leben gehalten hatte. Teresa hatte gleich zwei Menschen vernichtet an diesem Tag, aus nichts als bloßer, hässlicher Lust am Chaos heraus, und nun stand sie hier und sprach davon wie von einem kleinen Missgeschick aus weit vergangener Zeit, das schon lange für niemanden mehr von Bedeutung war. Und doch hatte Elias keine Kraft mehr für all den Zorn, den Ruben an den Tag legte. Er hatte Teresa nicht wiedersehen wollen, und er wollte sie auch jetzt nicht sehen. Nichts, was sie sagte oder tat und nichts, was er ihr antun konnte, würde irgendetwas erträglicher machen.
„Wo ist Miriam?“, hörte er Ruben schreien, und zum ersten Mal hörte Elias wieder hin. „Sie ist auf deinem Schiff, oder? Was hast du mit ihr vor?“
„Sie ist nicht auf dem Schiff“, zischte Teresa. „Ob du es glaubst oder nicht, ich interessiere mich nicht für das, was ihr hier auf Irdorath macht. Ich bin wegen dem Tempel hier, nicht wegen euch beiden und sicher auch nicht wegen Miriam.“
„Das sollen wir dir glauben?“, fuhr Ruben unerbittlich fort. Seine Stimme, die jetzt immer nah daran war, sich zu überschlagen, war Elias schon beinahe so leidig geworden wie Teresas Gesicht. „Miriam verschwindet – du tauchst auf – und es gibt keinen Zusammenhang?“
Teresa seufzte tief. „Hört zu, ich weiß nicht, wo eure Freundin ist, aber auf meinem Schiff ist sie nicht. Ihr könnt euch selbst davon überzeugen, schaut euch ruhig darauf um. Durchsucht es von oben bis unten, mir ist es gleich. Aber wenn ihr einen ehrlichen Ratschlag hören wollt: Ihr sucht am falschen Ort. Ich bin seit vier Tagen hier und war in jeder Ecke des Tempels. Wenn Miriam irgendwo hier unten wäre, dann hätte ich sie längst vor euch gefunden.“
Elias wusste nicht, was er davon halten sollte. Alles in ihm sträubte sich dagegen, ihr Glauben zu schenken. Teresa war die allerletzte Person, der er vertrauen wollte, und noch weniger wollte er die letzte echte Hoffnung auf eine lebendige Miriam aufgeben. Wenn sie nicht auf dem Schiff war, und wenn sie nicht im Tempel gefunden werden konnte, dann musste sie am Grund einer Schlucht liegen, verdreht und zerschmettert inmitten der Scherben der geborstenen Kugel. Er wehrte sich dagegen, dieses Bild zu akzeptieren, aber lange hielt sein Widerstand dem Blick in Teresas Gesicht nicht stand. Es war hässlich, wenn es log, aber in diesem Augenblick hasste er es dafür, dass es ihm die Wahrheit sagte.
„Du kannst überhaupt nicht jede Ecke des Tempels durchsucht haben“, ging Ruben erneut gegen sie an. „In die Abgründe bist du ja wohl kaum gesprungen.“
„Glaubt, was ihr wollt“, erwiderte Teresa unbeeindruckt, „aber die Wahrheit ist, dass Miriam nicht hier unten ist. Nicht in den Hallen, und auch nicht in den Abgründen.“
Elias hatte keine Ahnung, wie Teresa lebend zu den unbekannten Bereichen tief unten am Boden der Schluchten vorgedrungen sein wollte, aber es interessierte ihn im Augenblick auch nicht. Und als er sah, wie Ruben erneut nachhaken wollte, kam er ihm zuvor.
„Du bist also nicht wegen uns hier.“
Ihm entging der überraschte Ausdruck in Rubens und Teresas Blicken nicht, als sie ihm fast gleichzeitig die Köpfe zudrehten. Offenbar hatte keiner der beiden mehr damit gerechnet, dass er an dem Gespräch noch einmal teilnehmen wollte.
„Natürlich nicht“, versicherte Teresa. „Ich halte es für das Beste, wenn wir uns auch in Zukunft aus dem Weg gehen. Deswegen habe ich direkt in der Grotte angelegt. Ich hätte meine Angelegenheiten im Tempel abgeschlossen und wäre wieder fort gewesen, bevor ich irgendjemanden von euch mit meiner Anwesenheit hätte behelligen können. Aber nun habt ihr mich gefunden, und wir müssen alle damit zurechtkommen.“
„Was sollen das für Angelegenheiten sein?“, entgegnete Elias. „Dieser Tempel ist eine Ruine.“
Es hätte ihn nicht weiter gewundert, wenn aus Teresa mittlerweile eine Schwarzmagierin geworden wäre, aber die merkwürdige Bandagenkleidung, die sie trug, hatte keine Ähnlichkeit mit den Roben der Nekromanten, wie er sie auf Bildern gesehen hatte. Und bislang hatte er nie den Eindruck gewonnen, dass Irdorath bei den Dienern Beliars als Pilgerstätte hoch im Kurs war. Der dunkle Orden hatte diesen Ort ebenso vergessen wie alle anderen auch. Wie die meisten, zumindest.
Teresa antwortete nicht gleich auf seine Frage, dann aber löste sie sich von dem Felsbrocken, an den sie sich angelehnt hatte, und nickte Elias und Ruben auffordernd zu.
„Ihr wolltet ohnehin auf mein Schiff, nicht wahr?“, sagte sie. „Also los, gehen wir. Ich werde euch etwas zeigen.“
-
▥
Gedämpft hallten die leisen Worte von der anderen Seite des Schiffes an sein Ohr. Worte, die Elias und Teresa miteinander wechselten, kaum lauter als das sanfte Rauschen des Meeres. Weit genug entfernt, um einen raschen Blick zu riskieren.
Ruben beugte sich über die Reling und blickte hinab auf das Wasser, dessen glatte, im Schein der untergehenden Sonne rötlich glimmende Oberfläche nur von gelegentlichen schwachen Wellen gekräuselt wurde. Angespannt beobachtete er sein Spiegelbild dabei, wie es den Schal an der linken Seite packte und nach unten zog, sodass das schwarze Fleisch darunter sichtbar wurde. Obwohl es keine Überraschung mehr sein konnte, dass sich die Vergiftung weiter ausgebreitet hatte, setzte ihm der Anblick mehr zu als beim letzten Mal. Der dunkle Fleck zog sich nun schon über beinahe den ganzen linken Bereich des Halses, rund um die Stelle, in die Pete mit dem Dolch eingedrungen war, und diesmal konnte sich Ruben nicht damit beruhigen, dass er binnen weniger Stunden schon wieder mit der Kugel auf dem Heimweg sein würde. Bald würde die Nacht hereinbrechen, und bisher deutete nichts darauf hin, dass er mit der Kugel in seinem Besitz an Bord der Bak Shedim sein würde, wenn Varyan in den frühen Morgenstunden ablegte. Bislang hatte er sich immer mit dem Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten beruhigen können, aber eine Kugel, die nicht existierte, die konnte auch niemand stehlen. Und wenn er sie nicht hier an Bord von Teresas Schiff fand, worauf bisher nichts hindeutete, dann hatte er in der Tat nichts, das die Existenz der Kugel erahnen ließ. Dann war sie genauso weit weg wie sie es immer gewesen war seit dem fernen Tag, an dem er zum ersten Mal etwas von ihr gelesen hatte in dem alten Buch, das ihm Merdarion am liebsten gleich wieder weggenommen hätte, wenn er damit nicht seiner eigenen Meinung widersprochen hätte, nach der es ein Unding und zudem ein Zeichen von Schwäche sei, anderen Menschen das Lesen unliebsamer oder allzu interessanter Bücher verbieten zu wollen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er damals auf den alten Wassermagier gehört und sich den Gedanken an die Kugel gleich wieder aus dem Kopf geschlagen hätte, dachte Ruben jetzt. Dann hätten Elias und Miriam sie nie erschaffen können, dann hätte er Pete nie von ihr erzählen können. Dann hätte er sich auf andere Weise herausgeredet, vielleicht hätte ihn Pete auch gleich abgemurkst – was aber unwahrscheinlich war, solange noch die Möglichkeit bestand, dass Ruben ihm zu Gold verhelfen konnte. Jedenfalls wäre er ganz sicher nicht vergiftet worden, um auf einer kalten, schwarzen Insel selbst kalt und schwarz zu werden, ganz langsam, Tag für Tag.
Bevor ihn die Schwermut vollständig übermannen konnte, zwang er sich dazu, die lähmenden Gedanken an sein bevorstehendes Ende abzuschütteln, schob den Schal wieder nach oben und wandte sich von der Reling ab. Solange es noch ein Fleckchen auf diesem Schiff gab, das er nicht abgesucht hatte, durfte er die Hoffnung nicht aufgeben. Leider war das Schiff nicht besonders groß, und nachdem er den Lagerraum auf dem Unterdeck bereits erfolglos durchkämmt hatte, blieb nur noch das Kajütenhäuschen gleich hinter der merkwürdigen hölzernen Galionsfigur, die am ehesten wie ein verschrumpeltes Molerat mit zwei langen, dürren Armen aussah. An jeder Hand hatte das Wesen drei Finger, die es in einer beschwörerischen Geste gen Himmel streckte, als wollte es die Sonne selbst zu sich herab holen. Ruben hatte schon viele seltsame Figürchen gesehen – und meistens im gleichen Atemzug eingesteckt – aber dieses hier schaffte es dennoch, ihm auch beim zweiten Anblick noch einmal ein Stirnrunzeln zu entlocken. Dabei war es nicht einmal das Seltsamste, das er auf diesem Schiff gesehen hatte.
Als sich die Kajütentür nicht öffnen lassen wollte und Rubens Blick auf das lächerliche, rostige Türschloss fiel, bewegte sich seine Hand wie von selbst auf die Manteltasche zu, in der er seine Dietriche verborgen hielt. Es brauchte allerdings keine magische Glaskugel, um zu erahnen, dass ihn eine problemlos geknackte Tür nur verdächtig machen konnte. Ruben unterdrückte seine Neugier und ließ die Hand auf halbem Weg sinken. Zurückhaltung war geboten.
Er wandte sich ab und marschierte am größeren der beiden Masten vorbei zum hinteren Teil des Oberdecks zurück, wo Elias und Teresa noch immer in ihre leise Unterhaltung vertieft waren. Teresa lehnte am kleineren Mast, mit verschränkten Armen und gesenktem Kopf, während Elias unruhig vor ihr auf und ab wanderte. Und dahinter: Ein Dutzend Männer und Frauen, dazu zwei Kinder, stramm und starr im Licht der roten Abendsonne. Sie standen wie Statuen und von Weitem musste man tatsächlich glauben, sie seien aus Granit gefertigt oder aus Marmor, in monatelanger Arbeit von einem meisterhaften Bildhauer, einem Besessenen, der sein Werk erst ruhen ließ, wenn die Unmöglichkeit der Perfektion erreicht war. Aber die Kleidung, die sie trugen, war bunt und sommerlich, und sie wellte sich im sanften Wind, der sie ab und an streifte. Die Haut dieser Menschen war rosig, ging teils ins Bräunliche über, ohne jede Spur vom Staub der alten Steine. In den Augen mancher lag gar ein scherzhafter Ausdruck, die meisten Blicke aber waren ruhig und versonnen, als schauten sie nachdenklich in die Ferne oder bewunderten vielleicht das abendliche Lichtspiel in der Grotte. Aber ihre Lider blinzelten nicht, ihre Mundwinkel zuckten nicht, ihre Finger regten sich nicht. Und während sich ihre Kleider dem Griff des Windes ergaben, blieben ihre Haare starr und straff, wie festgefroren ragten sie von den reglosen Köpfen herab. So standen sie zusammen, ordentlich aufgereiht, immer zwei nebeneinander. Die beiden Kinder, ein Junge und ein Mädchen, hielten sich an den Händen.
„Und?“, wandte sich Ruben im Näherkommen an Elias. „Was genau hat sie nun mit denen angestellt?“
„Wie ich schon sagte, ich habe überhaupt nichts mit ihnen angestellt“, gab Teresa zurück, ohne sich zu Ruben umzudrehen. „Auch wenn euch die Vorstellung sicher schwerfällt.“
„Allerdings.“
„Sie bleibt dabei, dass sie diesen Leuten helfen will“, sagte Elias und rieb sich die vor Müdigkeit und Anstrengung rötlich unterlaufenen Augen. „Angeblich ist sie im Auftrag einer Gruppierung hier, die sich um solche... Sachen kümmert.“
„Was für Sachen?“, erwiderte Ruben. „Was ist denn überhaupt los mit denen?“
„Das ist für euch nicht von Belang“, behauptete Teresa. „Alles, was ihr wissen müsst, ist, dass ich nicht wegen euch hier bin, sondern wegen ihnen. Ich hatte guten Grund zur Annahme, dass ich auf Irdorath finden würde, was ihren Zustand aufheben kann. Es scheint so, dass ich mich geirrt habe, aber vielleicht habt ihr bloß vor mir gefunden, was ich suche.“
„Wir haben überhaupt nichts im Tempel gefunden“, sagte Elias, „außer das, was jetzt noch da ist. Wenn du glaubst, dass wir irgendwelche Tränke, Schriftrollen oder Artefakte geborgen haben, dann irrst du dich.“
Erneut blieb Rubens Blick an Teresas eigentümlicher Kleidung hängen, und zum ersten Mal fiel ihm auf, dass unter den unzähligen schwarzen Bändern, in die der ausgemergelte Körper eingewickelt war, überhaupt keine losen oder verknoteten Enden zu erkennen waren. Es wirkte fast ein wenig, als habe sie sich in ein einziges, sehr langes Band eingekleidet, obwohl das natürlich ein absurder Gedanke war. Irgendwo hörte jedes Band einmal auf. In jedem Fall war sie sehr gründlich dabei gewesen: Kein Fleckchen Haut blitzte zwischen dem Schwarz der größtenteils glatten, teils aber auch etwas ausgefranst und flusig wirkenden Bandagen auf. Ruben fragte sich unwillkürlich, wie ein Toilettengang für Teresa aussehen mochte. Sie würde sich ja kaum jedes Mal komplett auswickeln, oder etwa doch?
„Welche Gruppierung soll das sein, für die du arbeitest?“, fragte Ruben, um sich wieder den dringlicheren Fragen zuzuwenden.
„Eine, von der ihr ganz sicher noch nie etwas gehört habt“, murmelte Teresa, „und von der ihr auch nichts hören müsst.“
„Genug davon“, brummte Elias, der von Teresas unbefriedigenden Antworten offenbar genauso sehr die Nase voll hatte wie er selbst. „Hast du schon alles abgesucht, Ruben?“
„Fast. Die Tür der Kajüte da drüben ist verschlossen.“
Teresa hob kurz den Kopf, um Ruben einen knappen, eisigen Blick zuzuwerfen. „Und das bleibt sie auch.“
„Du hast gesagt, wir können das ganze Schiff von oben bis unten durchsuchen, weißt du noch?“, erinnerte sie Ruben. „Also, schließ die Tür auf.“
„Ihr habt mir überhaupt nichts zu befehlen“, zischte Teresa. „Ich hätte euch nicht einmal auf mein Schiff lassen müssen. Ihr habt euch überall umsehen dürfen, aber in meine Schlafkammer werdet ihr nicht eindringen. Ihr habt kein Recht dazu.“
„Kein Recht?“, fuhr sie Ruben an. „Nach allem was du angerichtet hast, hätten wir das Recht zu ganz anderen Sachen! Solange wir nicht jede Ecke dieses Schiffes abgesucht haben, glaube ich dir kein Wort, dass Miriam nicht hier an Bord ist – also schließ uns die Tür auf oder –“
Er vergaß, seine Drohung zu vollenden, als er Elias wortlos und strammen Schrittes an ihm vorbei in Richtung des Kajütenhäuschens marschieren sah. Noch bevor sich Teresa ganz aufgerichtet hatte, riss der Magier den rechten Arm in die Höhe und eine magische Windfaust zerschmetterte die Holztür in ihre Einzelteile. Teresa hatte es offenbar die Sprache verschlagen, und für einen Moment hatte es ganz den Anschein, als wollte sie sich als fünfzehnter Statuenmensch zu ihrer eigenen Sammlung gesellen. Ruben schenkte ihr keine Aufmerksamkeit mehr, lief zum offen stehenden Eingang der Kajüte hinüber und folgte Elias ins Innere.
Es war ein enger Raum, aber er war gefüllt mit dem Inhalt eines halben Museums und einer kleinen Bibliothek. In mehreren niedrigen Regalen, auf einem schmalen Tischchen und auch auf dem Bett und dem Boden lagen zahllose Papiere, Bücher, Karten, Zeichnungen verstreut – und dazwischen allerlei sonderbare Artefakte. Kleine Statuetten, Amulette, milchig blasse Edelsteine. Eines aber hob sich ab von all dem Chaos, als schwarzes Zentrum des Raumes lag es auf der Tischplatte, sorgsam platziert auf einem Fetzen blauen Stoffes. Die Oberfläche war rund und ebenmäßig, und das rote Sonnenlicht spiegelte sich nur ganz leicht auf dem tiefschwarzen Glas. Ruben hatte nie etwas lieber gesehen in seinem Leben als diese Kugel.
Eine, zwei Sekunden lang konnte er nichts sagen, dann stieß er hervor: „Ist sie es?“
Elias antwortete nicht, er drückte ihn zur Seite mit plötzlicher Wucht und stürmte zurück an Deck. Im Laufen wühlte seine Hand in der Manteltasche, zog einen Stein hervor und rief ein Wort, das Ruben nicht verstand. Teresa schien zu begreifen, was geschehen würde, denn sie stieß einen kurzen, erstickten Schrei aus, noch bevor sie die dornenbesetzte Ranke am Arm packte und hinab auf die Holzplanken riss. Eine weitere rote Schlinge legte sich um ihren Hals, die nächsten zwei wickelten sich um ihre Beine, und eine letzte kroch dreimal um Oberkörper und Arme, bis sie festgezurrt und keuchend vor Schmerz am Boden ihres Schiffes lag und sich nicht mehr regen konnte.
Elias schloss die Finger um die Rune zu einer Faust und blickte auf die Gefesselte hinab.
„Du wirst uns einiges zu erklären haben, Teresa. Und diesmal wirst du antworten.“
▦
Es klopfte gerade zum dritten Mal, als Elias die Tür zur Werkstatt nach außen hin aufstieß. Es überraschte ihn nicht, dass es Jobst war, der mit einer Fackel in der Hand und der gewohnt ernsten Miene draußen vor der Werkstatt stand.
„Was ist?“ Er wusste, dass er dem Nachtwächter unrecht tat mit dieser schroffen Begrüßung, aber er konnte im Augenblick wirklich keine Störung gebrauchen.
„Ich, nun...“ Jobst räusperte sich. „Ich wollte lediglich sicherstellen, dass Ihr wirklich keine Hilfe benötigt im Umgang mit der Gefangenen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist sie so etwas wie eine dunkle Zauberin, nicht wahr? Ich hörte gerade etwas merkwürdige Geräusche, und da fürchtete ich –“
„Wir wissen nicht genau, was sie ist“, entgegnete Elias. „Aber wir kommen schon mit ihr klar, danke.“
Ein Summen war zu vernehmen, und als Elias den Blick senkte, sah er einen kleinen schwarzen Falter, der sich gerade auf seiner rechten Hand niedergelassen hatte. Ärgerlich scheuchte er ihn fort und begegnete dem irritierten Blick des Nachtwächters.
„Tempelmotten“, sagte er. „Wir müssen wohl ein paar mit an die Oberfläche geschleppt haben.“
„Es gibt dort unten Motten?“ Jobst runzelte erstaunt die Stirn. „Ich wusste gar nicht...“
„Jetzt weißt du es. Noch etwas?“
„Nun, ich...“
„Gut. Wir rufen dich, wenn wir dich brauchen.“
Elias nickte dem Nachtwächter noch einmal knapp zu, dann schlug er ihm die Tür vor der Nase zu und wandte sich um.
Sie hatten eine Flamme an einer der Feuerstellen der Glasmacher entfacht, die das Zentrum des großen Werkstattraumes in ein warmes, aber unruhiges Licht tauchte. Nicht weit entfernt des Feuers hatten sie drei Stühle aufgestellt, zwei nebeneinander und der dritte gleich gegenüber. Er nahm wieder Platz gleich neben Ruben, der stumm auf ihn gewartet hatte, und schaute der Person in die Augen, die mit dicken Seilen an den dritten Stuhl gefesselt war. Teresa atmete langsam und schwer, ihr Kopf wippte leicht vor und zurück, und auf ihrer von Beulen und winzigen blutigen Bisswunden übersäten Gesichtshaut glänzte der kalte Schweiß. Einige der Beulen waren aufgeplatzt, und kleine Rinnsale bräunlichen Sekrets flossen von Wangen und Stirn hinab, waren teils vertrocknet auf halbem Wege, hatten ihr linkes Augenlid schon fest genug verklebt, dass sie es nicht mehr vollständig heben konnte. Elias hatte nicht erwartet, dass es ihm Vergnügen bereiten würde, sie so zu sehen, und tatsächlich blieb jede Art der Befriedigung aus. Er war es längst leid geworden, sie zu quälen. Alles was er wollte, war die Wahrheit.
„Wo ist Miriam?“, fragte er so ruhig wie es ging, formulierte jedes der Worte mit größter Deutlichkeit. „Was hast du ihr angetan?“
Teresa schwieg zunächst, und Elias glaubte schon, dass sie nun überhaupt nicht mehr antworten wollte, aber dann fuhr sie doch wieder fort mit der endlosen Wiederholung ihrer Lügen.
„Ich weiß nicht, wo Miriam ist“, krächzte sie. „Ich habe sie seit damals nicht mehr gesehen. Ich kann euch nicht –“
Elias’ Finger verkrallten sich um den Runenstein, und im nächsten Augenblick brachen sie wieder alle aus der Dunkelheit jenseits des Feuerscheins hervor, strömten zischend und brummend und fiepend in die Mitte des Raumes, direkt auf die gefesselte Frau auf dem Stuhl zu. Die dunklen Falter mit den Krallenbeinen, die durstigen glubschäugigen Stechmücken, die fingergroßen Hornissen mit den giftigen glänzenden Stacheln, und zu Tausenden und Abertausenden die kleinen pechschwarzen Käfer, die ihr ätzendes, süßliches Sekret versprühten. Sie alle gingen wieder auf Teresa los, und für einige lange Sekunden war von ihr nichts zu sehen als eine ohrenbetäubend surrende Wolke aus Insekten, aus deren Lärm die Schreie kaum herauszuhören waren. Dann lösten sich die Tiere eines nach dem anderen, zogen sich in Schwärmen zurück in die Schatten und waren bald verstummt und verschwunden. Lediglich fünf oder sechs waren verblieben, kleine Falter und Käfer, und krabbelten noch eine Weile lang auf Teresas rotem Gesicht herum, bis auch sie sich in kurzer Zeit auflösen würden.
„Wo ist Miriam?“, fragte Elias, und seine Fingernägel kratzten über die Oberfläche des Runensteins. „Was hast du ihr angetan?“
„Elias, das bringt doch nichts.“ Ruben legte ihm eine Hand auf den Arm. „Vielleicht weiß sie ja wirklich nicht, wo Miriam ist.“
„Sie hat uns schon einmal angelogen“, erwiderte Elias. „Du hast sie gleich auf die Kugel angesprochen, als wir ihr begegnet sind, und sie hat sie uns verheimlicht. Sie wollte verhindern, dass wir ihren Schlafraum durchsuchen, weil sie genau wusste, dass wir die Kugel finden würden. Wieso sollten wir ihr also jetzt vertrauen? Wieso sollten wir nicht davon ausgehen, dass sie Miriam umgebracht und in irgendeinen Abgrund geworfen hat?“
„Ich habe die Kugel gefunden“, presste Teresa zornig hervor und bleckte die Zähne. Elias fiel zum ersten Mal auf, wie entsetzlich schlecht gepflegt diese Zähne waren. Nichts als schwarze, faulige Klumpen.
„Und das sollen wir dir glauben? Dass die Kugel einfach so auf dem Tempelboden herumlag?“
„Das ist die Wahrheit.“ Teresa spuckte aus, als ihr ein dicker Tropfen des blutigen Sekrets in den Mund gelaufen war. „Diese Kugel ist ein... ein faszinierendes Artefakt, also habe ich sie mitgenommen. Ist das so schwer zu glauben?“
„Vielleicht sollten wir dich einmal eine ganze Stunde lang mit den Insekten alleine lassen“, sagte Elias und drehte den Runenstein in der Hand. „Vielleicht sagst du danach ja etwas, das wir glauben können.“
Teresa presste die Lippen aufeinander und sagte nichts. Wenn sie die Drohung geängstigt hatte, dann ließ sie sich jedenfalls nichts anmerken.
„Elias“, meldete sich Ruben erneut zu Wort, aber Elias schüttelte die Hand des Feuermagiers ärgerlich ab.
„Vorhin hättest du sie noch fast selbst umgebracht“, fuhr er ihn an, „und jetzt hast du plötzlich Mitleid mit ihr? Wegen ein paar Insektenstichen?“
„Ich meine ja nur, dass wir so nur unsere Zeit verschwenden“, wandte Ruben ein. „Egal ob sie die Wahrheit sagt oder nicht, wir bekommen doch ohnehin nichts aus ihr heraus. Du bist genauso übermüdet wie ich, Elias. Was wir jetzt brauchen, ist Schlaf. Vielleicht kommt uns morgen früh eine bessere Idee, wenn wir erholt und –“
„Dann geh doch schlafen, wenn dir so danach ist! Ich werde ganz bestimmt kein Auge zu tun, solange ich nicht weiß, was mit Miriam geschehen ist!“
Er hatte die Worte noch nicht ganz zuende gesprochen, da raste der Schwarm schon ein weiteres Mal auf die Gefesselte zu und hüllte sie ein. Elias verbarg die Rune in der Hand, verschränkte die Arme und ließ die Sekunden verstreichen. Diesmal würde sie sich nicht darauf verlassen können, dass alles ganz schnell wieder vorbei war.
„Was ist mit der Kugel?“, brüllte Ruben durch den Insektenlärm hindurch. „Wieso benutzen wir nicht die Kugel?“
Elias’ Blick wanderte hinüber zum runden, schwarzen Tisch, auf dem die Kugel in dem Drahtgestell ruhte, das sie bereits während der Erkaltung gehalten hatte. Natürlich hatte er auch schon daran denken müssen. Es war eine wenig konkrete Hoffnung, aber vielleicht würde ein Blick in die Zukunft eine Antwort bringen. Was ihn davon abhielt, war die Vorstellung, ohne Miriam hineinzusehen, denn die behagte ihm ganz und gar nicht. Er wusste nicht, ob sie damit einverstanden gewesen wäre, und vor allem wusste er nicht, ob er ohne ihre Hilfe überhaupt etwas mit der Kugel anzufangen wusste. Vielleicht würde sie bloß schwarz bleiben für ihn, nichts als dunkles Glas. Dann wäre die letzte Hoffnung dahin.
Eine Welle der Müdigkeit erfasste ihn, und das sonore Brummen und Summen der Insekten begann, ihn einzulullen. Aus all den dröhnenden Geräuschen ging ein einziger, dunkler Ton hervor, den die kleinen Tiere gemeinsam anstimmten. Ein Ton, der Elias’ Körper erfasste und sanft erbeben ließ, der seine Nerven massierte und ihn entspannte. Teresas Schreie waren so schwach geworden, dass sie diesen Ton nicht mehr stören konnten. Vielleicht hatte Ruben recht, dachte er. Vielleicht war es das Beste, zu schlafen, hier und jetzt...
Jemand packte ihn an der Schulter, der Runenstein entglitt seinen Händen und fiel zu Boden. Elias schlug die Augen auf. Zehntausende kleine Flügelchen flatterten aufgeregt, und der Schwarm stob nach allen Seiten auseinander.
„Schluss damit!“ Rubens Stimme war nun viel zu laut für den vollkommen ruhigen Raum, in dem nicht einmal mehr Teresas angestrengtes Atmen zu vernehmen war. „Wir sind Magier und keine Folterknechte! Und wenn wir sie umbringen, wissen wir genauso wenig über Miriam wie vorher!“
Einen kurzen Moment lang glaubte Elias, Teresa wäre schon jetzt nicht mehr am Leben. Ihre Augen waren nur noch kleine, von Blut und Sekret überkrustete Vertiefungen zwischen rissigen Beulen und aufgequollener, zerstochener Haut. Die Lippen waren geschwollen und aufgeplatzt, die bleichen Haare in dicken, pappigen Strähnen mit den Wangen verklebt. Ihr Gesicht regte sich nicht, es war ganz das Antlitz eines übel zugerichteten Toten. Aber der Zauber tötete nicht, wie sich Elias entsann. Er tötete niemals, war genau für diesen Zweck, für das bloße Quälen erdacht. Und so hob und senkte sich Teresas Brustkorb unter den Seilen und den schwarzen Bandagen, die an vielen Stellen halb zerrissen waren von den Dornenranken, die sich bei der Gefangennahme am Abend in sie gebohrt hatten. Langsam, ganz langsam atmete sie.
„Wir werden in die Kugel schauen“, sagte Elias.
Wortlos machten sie sich an die Arbeit. Sie packten den Stuhl, auf dem Teresa saß, und schleppten ihn mitsamt der Gefesselten in eine schattige Ecke des Raumes. Sie rückten die beiden anderen Stühle näher an das Feuer heran, sodass sie beide hineinsehen konnten, wenn sie nebeneinander darauf saßen. Und schließlich, als alles vorbereitet war, nahm Elias die Kugel aus dem Drahtgestell und brachte sie hinüber zur Flamme.
Er musste an sein Versprechen denken, das er Klarissa gegeben hatte. Dass sie dabei sein würde, wenn sie alle zum ersten Mal in die Kugel schauten. Aber es war alles anders gekommen als gedacht. Miriam war nicht hier, und jetzt, in dieser Nacht, mit Teresa im Raum, wollte er Klarissa nicht dabei haben. Es konnte sie nur aufwühlen, Teresa zu sehen, und darüber hinaus war er nicht in der richtigen Stimmung. Wenn sie erst einmal Miriam wiedergefunden hatten, wenn Teresa wieder weit fort wäre und zurückgefunden hätte zu ihrer Rolle als schattenhafte Gestalt aus einer schwachen Erinnerung, ja dann war der richtige Zeitpunkt gekommen, um Klarissa dazu zu holen. Dann würden sie alle vier hineinschauen, gemeinsam.
„Was müssen wir tun?“, fragte Ruben, als Elias sich neben ihn setzte, die schwere Kugel in beiden Händen.
„Miriam hat den Erweckungszauber schon gesprochen“, sagte Elias, „also ist keine Magie mehr vonnöten. Alles, was wir tun müssen, ist die Kugel vor das Feuer zu halten und hinzuschauen. So lange, bis wir... etwas sehen.“
„Das ist alles? Vors Feuer halten und hineinschauen? Und dann sehen wir die Zukunft?“
Erneut überkamen ihn Zweifel, als Ruben es so lapidar zusammenfasste. Es klang tatsächlich viel zu einfach. Aber so hatte es in den Büchern gestanden und so hatte es Miriam selbst erlebt.
„Ja“, sagte er. „Dann sehen wir die Zukunft.“
„Aber welchen Teil der Zukunft?“
„Ich weiß nicht. Wie sich beeinflussen lässt, was die Kugel zeigt, das wollten wir ja erst noch herausfinden. Wir werden einfach darauf setzen müssen, dass wir etwas sehen werden, das für uns von Nutzen ist.“
Als er hinabblickte auf das große runde Ding in seinen Händen, da war er sich plötzlich mit erschreckender Klarheit ganz sicher, dass sie nur schwarz bleiben konnte. Dass es unmöglich gehen würde ohne Miriam. Aber versuchen mussten sie es.
„In Ordnung“, murmelte er und schloss noch einmal kurz die Augen, um sich zu konzentrieren. Er hatte sich diesen Moment immer völlig anders vorgestellt, aber es waren zweifellos genau diese Minuten, auf die er gemeinsam mit Miriam ein knappes Jahrzehnt lang hingestrebt hatte. Der erste Blick in die Kugel.
„Bist du bereit, Ruben?“
Der Feuermagier wirkte deutlich angespannt, seine Blicke pendelten unruhig zwischen der Kugel und Elias selbst. Natürlich musste es auch für ihn ein großer Moment sein.
„Ja“, sagte er bestimmt. „Lass uns anfangen.“
Als Elias sie anhob, schien die Kugel noch einmal an Schwere zu gewinnen. Er streckte sie empor, bis die Flamme hinter ihr loderte, und sah, wie sich das undurchdringliche Schwarz ihrer gläsernen Haut in einen grauen Nebel lichtete. Schwaden dunkler Wolkenfetzen stiegen im Inneren der Kugel auf und vergingen wieder in der Schwebe. Und dann, als Elias gerade der Gedanke gekommen war, dass weiter nichts geschehen würde, erschien hinter dem Nebel etwas anderes.
Zunächst war es wie eine Täuschung, ein Funkeln im Feuer, das die Kugel umrandete. Aber es blieb bestehen, hielt auch einem zweiten Blick stand, und schließlich, nach einigen weiteren Blicken, nahm es Gestalt an. Gemalt mit dickem Pinsel, mit schwachen Konturen und in gedämpften Pastellfarben lag es vor seinen Augen. Ein Bild aus der Zukunft.
▥
Er sah sich selbst.
Er schaute sich selbst in die Augen, ganz so als ob er direkt vor sich stünde, als ob es ihn zweimal gäbe in der Welt.
Er trug den gleichen hellgrauen Mantel, den er auch jetzt trug, und den gleichen dicken Wollschal. Die Sonne schien vom wolkenlosen Himmel hinab auf den großen, kreisrunden Platz, auf dem er stand: ein Platz, den man aus weißem Sand geformt hatte, weit oben auf einem hohen, grünen Hügel. Am Horizont war das blaue Meer zu sehen, und dahinter zwei Inseln, zwischen denen eine gewaltige, natürliche Brücke aus Fels verlief. Es war ein so erstaunlicher Anblick, dass er erst im zweiten Moment bemerkte, dass er nicht allein war auf dem Hügel, auf diesem Platz aus weißem Sand. Elias stand gleich hinter ihm, lugte über seine Schulter, und als ob er plötzlich bemerkt hätte, dass er von außerhalb der Kugel beobachtet wurde, zuckte seine Hand nach vorn und packte den Schal, der um seinen Hals lag.
Er zuckte zusammen, als Elias den Schal an der linken Seite des Halses hinunterzerrte, genau da wo alles schwarz und vergiftet war, wo sich der dunkle Fleck über die Haut und ins Fleisch hinein zog... aber es war nichts als saubere, blasse Haut, die zum Vorschein kam. Keine Spur der Verderbnis war zu erkennen, keine noch so kleine Unreinheit auf der Haut. Die Vergiftung war fort.
Seine Gedanken rasten, der Blick seines Doppelgängers war wie versteinert – Elias hielt in der Bewegung inne – und dann, in der letzten Sekunde, bevor das Bild in sich zusammenfiel und im Nebel versank, trat eine Frau im weißen Kleid aus der leeren Luft hervor.
Miriam.
„Ja, genau, die gesamte Produktion. Es wird nichts anderes mehr hergestellt als die Glasscheiben, die auf diesen Papieren beschrieben sind. Bitte studiert die Dokumente jetzt gleich, und das so eingehend wie möglich, damit wir noch Zeit haben, uns mit Varyan zu besprechen, falls es Unklarheiten geben sollte. Er legt in wenigen Stunden ab, also macht euch umgehend an die Arbeit.“
Nachdenklich und nervös stapfte Ruben vor der Werkstatt auf und ab, hörte kaum hin, was Elias im Inneren mit den Glasmachern besprach. Durch die offene Tür sah er ihn vor dem runden Tisch stehen, um den die Männer versammelt waren. In seinen Händen ruhte, verborgen in einem Säckchen aus dunklem Samt, die Kugel. Er wollte sie genauso wenig aus der Hand geben wie Miriam es vor ihrem Verschwinden getan hatte. Und natürlich hatte er die ganze Nacht über kein Auge zugetan, die Kugel nie aus der Hand gelegt – und Ruben keine Chance gelassen. Sie war zum Greifen nah, aber es brauchte schon mehr als ein gewisses Talent für einen gelungenen Taschendiebstahl, um jemandem ein so schweres und großes Objekt aus den eigenen Händen zu stehlen. Wenn er mehr Zeit gehabt hätte, dann hätte er sich womöglich ein Ablenkungsmanöver überlegen können. Irgendetwas, das Elias dazu brachte, die Kugel abzulegen und allein zu lassen, und sei es nur für ein paar Sekunden. Aber er hatte nur noch zwei oder drei Stunden, und selbst wenn er das Artefakt irgendwie in die Finger bekommen könnte – sobald Elias bemerkte, dass es fort war, würde er Varyan und seine Leute nie und nimmer abreisen lassen. Er würde die ganze Siedlung und auch das Schiff durchsuchen lassen, bis die Kugel gefunden war. Ruben musste einsehen, dass er sich diese Sache wohl ein ganzes Stück zu einfach vorgestellt hatte.
Vielleicht aber, und dieser Gedanke nahm ihn zunehmend ein, seit er in der Nacht einen Blick in die Zukunft geworfen hatte, war der Diebstahl auch gar nicht mehr die beste Option, die sich ihm bot. Natürlich, die Kugel hatte funktioniert, und sie würde aller Voraussicht nach auch für jemanden wie Pete funktionieren, aber wer sagte ihm schon, dass der Mistkerl sein Versprechen wirklich halten würde? Woher wollte er wissen, dass er die Kugel nicht einsteckte und ihn verrecken ließ – vielleicht weil er nichts damit anfangen konnte, was er im dunklen Nebel des Glaskörpers erblickte, vielleicht auch aus purer Gehässigkeit oder einer bloßen Laune heraus? Es war Wahnsinn, sein Leben in die Hände eines unberechenbaren Mannes wie Pete zu legen. Was er allerdings in der Kugel gesehen hatte...
Der Vorschlag, sie zu verwenden, war ein gewaltiges Risiko gewesen, wie Ruben durchaus bewusst gewesen war. Sie hätte Elias zeigen können, wie er ihm die Kugel stahl und damit auf der Bak Shedim von der Insel floh. Sie hätte ihm auch verraten können, dass er kein Feuermagier war. Er konnte sich eine ganze Menge an möglichen Zukunftsbildern vorstellen, die ihm alle nicht besonders recht gewesen wären. Aber er hatte nicht einfach abwarten können, während sich Elias in endlosen, sinnlosen Befragungen erging – er hatte etwas tun müssen, sein Schicksal in die Hand nehmen. Alles auf eine Karte setzen. Und bislang sah es danach aus, als ob sich dieses Risiko gelohnt hatte.
Er hatte eine Zukunft gesehen, in der er geheilt war von der Vergiftung, was grundsätzlich schon einmal etwas sehr Beruhigendes an sich hatte. Aber durfte er darauf zählen, dass der schwarze Fleck von ganz allein wieder verschwinden würde? Bisher hatte er ganz den Eindruck erweckt, dass er bloß immer weiter und weiter um sich greifen würde, wenn Ruben nichts dagegen tat. Vielleicht musste er selbst dafür sorgen, dass das Bild aus der Zukunft auch tatsächlich zu seiner Zukunft wurde. Vielleicht war das die Art und Weise, auf die dieses rätselhafte Artefakt eingesetzt werden musste. Wenn der Kugel zu glauben war, dann würde er geheilt sein, sobald er auf dem Hügel stand, den sie ihm gezeigt hatte, inmitten des glatten weißen Sandes. Das musste doch bedeuten, dass die Vergiftung irgendwann – irgendwie – auf dem Weg dorthin verschwinden würde, oder etwa nicht? Nun, da er sie erstmals mit vollem Ernst in Betracht zog, kam ihm diese Hoffnung plötzlich wieder sehr verzweifelt vor. Er musste sich also entscheiden, ob er sein Leben lieber in die Hände eines Irren oder in die nebligen Bilder einer Glaskugel legen wollte.
„Ihr bleibt hier auf Irdorath, ja? Magier?“
Ruben fuhr herum und blickte hoch in das längliche Gesicht Varyans. Es erschrak ihn, dass er überhaupt nicht mitbekommen hatte, dass sich der Händler ihm genähert hatte.
„Ja, ich... ich denke schon“, stammelte Ruben, obwohl ihm klar war, dass hier bleiben die zweifellos ungünstigste aller Entscheidungen war, die er treffen konnte. „Ihr, ähm, fahrt in ein paar Stunden wieder ab, nehme ich an?“
Varyan war ein großer Mann, der ihn um mehr als einen Kopf überragte. Seine langen, schwarzen Haare hatte er zu einem Zopf gebunden – eine Frisur, die Ruben bislang noch bei keinem Südländer gesehen hatte. Er hatte allerdings ohnehin den Verdacht, dass im Stammbaum des Händlers auch Menschen aus nördlicheren Regionen eine nicht ganz unwichtige Rolle spielten, denn seine Haut war etwas heller als er es von den meisten Leuten aus Varant gewohnt war, und seine Augen schimmerten in einem leuchtenden Grün. Auch sein Myrtanisch war zwar nicht ganz akzentfrei, aber weit entfernt von den Radebrechereien, die sich Ruben schon von vielen varantischen Händlern und Herumtreibern hatte anhören müssen.
„Noch in dieser Stunde“, sagte Varyan. „Ich wollte gerade Eurem Freund davon erzählen.“
Er nickte ihm zu und setzte seinen Weg fort, doch bevor der Händler ins Innere der Werkstatt gehen konnte, hielt Ruben ihn zurück.
„Eine kurze Frage, Varyan.“
Er drehte sich um und bedachte Ruben von oben herab mit einem ruhigen Blick.
„Was ist es?“
„Ihr seid weit gereist, nicht wahr? Habt Ihr schon einmal von einem Hügel gehört, auf dessen Kuppe sich ein großer runder Platz aus Sand befindet? Ganz weißer Sand, viel weißer als der, den man in Myrtana an den Stränden sieht?“
„Ich bin weit gereist, Magier“, erwiderte Varyan, „aber ich war nicht überall auf der Welt. Der Ort, den Ihr beschreibt, ist mir unbekannt.“
„Es liegt am Meer, deswegen dachte ich – die beiden Inseln, vielleicht sind die Euch ein Begriff? Zwei kleinere Inseln, die miteinander verbunden sind von einem Felsgebilde... fast wie eine Art Brücke. Sie sind ganz in der Nähe. Es wird Euch sicher in Erinnerung geblieben sein, wenn Ihr es gesehen habt.“
Der Ausdruck im glatten, bartlosen Gesicht des Mannes veränderte sich nicht. Nach einigen Momenten des Schweigens aber nickte Varyan, langsam und bedächtig.
„Der Ort, den Ihr beschreibt, liegt am nordwestlichen Rand des großen Archipels im Osten. In Myrtana werden sie die Irrlicht-Inseln genannt. Es gibt viele andere kleine Inseln in diesem Randbereich des Archipels, und vermutlich befindet sich Euer Hügel auf einer von ihnen.“
„Die Irrlicht-Inseln?“, wiederholte Ruben. „Wieso heißen sie so?“
Varyan hob eine Braue. „Wegen der Irrlichter.“
Ruben glaubte schon, der Seefahrer wollte es bei dieser trockenen Antwort belassen, doch dann setzte er hinzu: „Es ist viele Jahre her, seit ich zum letzten Mal in diesen Gewässern unterwegs war, aber ich höre immer noch Geschichten von dort. Seefahrer, die sich von den Lichtern auf die Inseln locken lassen und nie mehr gesehen werden. Manche sagen, an den Küsten der Irrlicht-Inseln liegen Seite an Seite die verlassenen Schiffe, prächtige Kähne sollen darunter sein, und sie alle warten nur darauf, von neuen Mannschaften abgeholt und fortgebracht zu werden. Aber niemand, der dorthin geht, kommt wieder zurück. Viele sagen, dass die Irrlichter sie verrückt gemacht haben. Manche, die vorbei gesegelt sind, wollen die Verlorenen gesehen haben, wie sie sich gegenseitig von der Felsbrücke hinabgestoßen haben. Andere sagen, dass sie von selbst gesprungen sind. Und wieder andere meinen, dass an den Geschichten nichts dran ist, dass sie keine Verrückten und auch keine Lichter gesehen haben, als sie die Inseln passiert haben.“
„Und was glaubt Ihr?“, fragte ihn Ruben.
„Ich glaube, es sind die Magier.“ Es war Ruben nicht entgangen, dass Varyan das Wort Magier stets mit einer auffälligen Betonung aussprach. Im ersten Moment hatte er sich ein wenig ertappt gefühlt, aber mittlerweile glaubte er, dass es etwas anderes damit auf sich hatte. Er wusste allerdings noch immer nicht zu sagen, ob es Verächtlichkeit oder das genaue Gegenteil, vielleicht sogar eine Art von Ehrfurcht war, die dahintersteckte.
„Es heißt, dass diese Inseln im Nordwesten des Archipels unbewohnt sind, aber jeder weiß, dass es nicht stimmt. Die Magier hausen dort. Keine Feuermagier, keine Wassermagier, vielleicht nicht einmal Schwarzmagier. Magier wie Euer Freund, die ihre Ruhe haben wollen vor Kirchen und Zwängen.“
Ruben horchte auf. Vielleicht kannte sich der eine oder andere Magier auch mit Vergiftungen aus? Ein gewöhnlicher Priester würde nichts für ihn tun können, mit dem Gedanken hatte er sich längst abgefunden – aber vielleicht gab es dort jemanden, der sich mit den absonderlichen Giften und Gemischen des Südens auskannte? War es so jemand, zu dem ihn die Kugel führen wollte?
„Und Ihr glaubt, diese Magier entführen Seeleute?“
„Die Magier herrschen über diese Inseln“, sagte Varyan und verschränkte die Arme vor der dunkelgrün schimmernden Weste. Er war viel zu luftig angezogen für die eisigen Temperaturen auf Irdorath, dachte Ruben. „Wer weiß schon, was dort vor sich geht? Es hat einen Grund, warum ich diese Gewässer nicht mehr anfahre. Und Ihr tut auch gut daran, Euch fernzuhalten von dort. Ihr mögt Euch auskennen mit Eurer Magie, aber Ihr seid nicht vorbereitet auf das, was Euch dort erwarten würde.“
Es waren die letzten Worte des Seefahrers, bevor er sich umdrehte und die Werkstatt betrat, und sie verwirrten Ruben ganz gehörig. Wenn er bloß vage Geschichten über die Inseln gehört hatte, wieso formulierte Varyan dann eine so eindeutige Warnung? Er wirkte nicht wie ein sehr abergläubischer Mann. Eines jedenfalls hatte Ruben nach dem Gespräch für sich beschlossen: Die Reise ins östliche Archipel war die beste Chance auf Rettung, die er im Augenblick hatte. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort ein kundiger Giftmischer aufhielt, war allemal höher als diejenige, mit der Kugel unbemerkt von Irdorath zu fliehen und anschließend anstandslos von Pete das Gegenmittel überreicht zu bekommen. Vor allem aber, und Ruben gefiel sich in der Überzeugung, dass es dieser Gedanke war, der den Ausschlag gab, würde er auf diese Weise nicht nach Petes Pfeife tanzen. Wenn er sterben würde, dann zumindest in der Gewissheit, in den letzten Lebenstagen nicht zum Sklaven eines räudigen Hafenschurken geworden zu sein.
Blieb nur die Frage, wie er auf diesen allzu fernen Hügel irgendwo am Rande des östlichen Archipels gelangen sollte. Varyan würde ihn nicht dorthin bringen, so viel stand fest. Zum Glück, dachte Ruben, war Varyans Schiff nicht das einzige, das bei Irdorath vor Anker lag.
Beim nächsten Blick durch die dicken Glasscheiben des Fensters war die Bak Shedim schon kaum mehr als ein dunkler Punkt am roten Horizont. Ein mulmiges Gefühl regte sich in Ruben, als er dabei zusah, wie das Schiff, das ihn zurück nach Vengard hätte bringen können, langsam seiner Sicht entschwand. Mit Varyan und seinen Männern fuhr auch der alte Plan davon, unwiederbringlich. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich an den neuen zu klammern.
„So, das hier ist sie.“ Elias war zum Tisch zurückgekehrt, um den sie sich versammelt hatten, und legte eine große, gut erhaltene Seekarte darauf ab. „Es ist nicht das vollständige Archipel darauf eingezeichnet, aber der Teil, auf den es uns ankommt.“
Ruben rückte ein Stück näher heran auf seinem Stuhl, und auch Jobst beugte sich interessiert über die Karte. Nur Matilda, die junge Frau mit dem Zopf, die Ruben kurz nach seiner Ankunft schon einmal aus der Ferne beobachtet hatte, schaute gar nicht richtig hin. Offenbar wusste sie genauso wenig wie Ruben, was sie bei der kleinen Versammlung im unteren Geschoss des Leuchtturms, die Elias einberufen hatte, eigentlich verloren hatte.
„Hm“, machte Ruben, während er die Inseln im Nordwesten des Archipels mit den Fingern abfuhr. „Irgendwo in diesem Bereich müssen die Irrlicht-Inseln sein, von denen Varyan gesprochen hat.“
„Vielleicht diese hier?“ Elias deutete mit dem Zeigefinger auf zwei kleine Flecken auf der Karte, die durch eine dicke Linie miteinander verbunden waren.
„Sieht ganz danach aus“, stimmte Ruben zu. „Wenn das die Irrlicht-Inseln sind, dann müssten wir unseren Hügel auf einer der Nachbarinseln finden.“
„Und damit Miriam“, sagte Elias.
Es war erwartungsgemäß keine große Überredungskunst notwendig gewesen, um ihn dazu zu bringen, der Reise zum Archipel zuzustimmen. Elias hatte die gleichen Bilder in der Kugel gesehen: Ebenso wie Ruben hatte er Miriam aus dem Nichts heraus auf den Sandplatz treten sehen, ganz so als wäre sie gerade aus einer anderen Welt zurückgekehrt. Und vielleicht würde genau das ja auch geschehen, überlegte Ruben. Es war lange her, dass er in Merdarions Haus zum letzten Mal von solchen Dingen gelesen hatte, aber es war unter Magiern kein Geheimnis, dass es weitere Welten gab, in die einige unter den Wagemutigen angeblich schon vorgedrungen waren – oder es zumindest versucht hatten. Vielleicht hatte Miriam einen solchen Ort betreten, und vielleicht würde sie auf der fernen Insel, die ihnen die Kugel gezeigt hatte, wieder herauskommen. Aber so faszinierend solche Überlegungen auch waren, Ruben konnte sich nie länger als ein paar Sekunden mit ihnen befassen, bevor der nagende Gedanke an seine Vergiftung und die ungewisse Heilung wieder Besitz von ihm ergriff.
Ein Räuspern kündigte an, dass Jobst das Wort ergreifen wollte.
„Ihr seid Euch sicherlich im Klaren darüber, dass es eine beschwerliche Reise wird“, sagte der Nachtwächter. „Das Archipel liegt viele Seemeilen entfernt von Irdorath, und das Schiff, mit dem Ihr reisen wollt, ist gewiss nicht das Schnellste. Seid Ihr Euch sicher, dass Ihr die Reise zu zweit antreten könnt?“
„Teresa hat dieses Schiff alleine gefahren“, entgegnete Elias, „also werden wir es zu zweit schon steuern können. Allerdings werden wir die Reise ohnehin nicht zu zweit antreten.“
Ruben blickte überrascht auf. „Sollte Jobst nicht auf Irdorath bleiben? Um sicherzustellen, dass Teresa in Gefangenschaft bleibt?“
Der Nachtwächter nickte eifrig. „Jemand muss hier während Eurer Abwesenheit nach dem Rechten sehen, und ich bin fest entschlossen –“
„Ich habe ja nicht von dir gesprochen, Jobst“, fiel ihm Elias ins Wort. „Klarissa wird mit uns fahren. Und da ich womöglich nicht immer die Zeit haben werden, mich ihr zu widmen, wirst auch du uns begleiten, Matilda.“
Das Gesicht der jungen Frau war wie festgefroren, aber Ruben glaubte, ihr das Entsetzen anmerken zu können. Vermutlich aber hatte sie mit so etwas bereits gerechnet.
„Hältst du das wirklich für eine gute Idee?“, wandte sich Ruben an den Magier. „Du weißt, was Varyan über diese Inseln gesagt hat. Es könnte gefährlich werden. Und auf jeden Fall wird es eine anstrengende Fahrt sein. Willst du Klarissa dem wirklich aussetzen?“
„Ich lasse sie ganz bestimmt nicht alleine hier mit Teresa.“ Elias funkelte ihn ärgerlich an, und sein Tonfall gab ihm deutlich zu verstehen, dass er darüber nicht diskutieren wollte. „Klarissa kommt mit uns, und dabei bleibt es.“
Eine längere Stille trat ein, in der Elias auf die Karte hinab schaute und die anderen drei Anwesenden betreten in die Leere starrten. Dann schließlich blickte Elias wieder auf und sagte: „Nun, wenn es weiter nichts zu besprechen gibt, dann sollten wir uns an die Vorbereitungen machen. Ich will, dass wir vor Mittag in See gestochen sind.“
In einer anderen Situation hätte Ruben vielleicht eingewandt, dass sie noch immer keinen Schlaf gefunden hatten und besser erholt sein sollten, wenn sie sich auf eine solche strapaziöse Reise machten, aber angesichts seiner fortschreitenden Vergiftung konnte ihm die Eile nur recht sein. Auch wenn ihm sein Körper etwas anderes mitteilen wollte: Schlafen konnte er noch, wenn er tot war, und je früher sie aufbrachen, desto besser die Aussichten, dass es bis dahin noch eine Weile hin sein würde.
„Matilda, bereite Klarissa auf den Transport hinunter auf das Schiff vor. Und pack sorgfältig ihre Sachen, sie soll nicht jeden Tag die gleichen Kleider anziehen müssen.“
Zwischen ihren nun deutlich bebenden Lippen presste Matilda ein undeutliches „Sehr wohl“ hervor, rückte polternd den Stuhl zurück und verließ hastig den Raum. Ruben hatte gewaltige Zweifel an der Notwendigkeit, sie auf die Reise mitzunehmen, aber noch weniger gefiel ihm die Aussicht, tagelang zusammen mit Klarissa auf engstem Raum zu verbringen. Allein der Gedanke an ihre kurze Begegnung während seines kleinen Einbruchs ließ ihn frösteln. Aber er würde es Elias nicht ausreden können, also musste er versuchen, sich mit der Vorstellung anzufreunden.
„Jobst, ich möchte, dass die Gefangene rund um die Uhr überwacht wird“, wandte sich Elias nun an den Nachtwächter. „Sie mag in ihrer derzeitigen Verfassung wie ein Häufchen Elend wirken, aber der Eindruck kann täuschen. Lasst sie nicht aus den Augen. Sie verlässt mein Haus nicht, bis wir wieder hier sind – keine Ausnahmen. Verstanden?“
„Selbstverständlich“, versicherte Jobst.
Damit war die Unterredung beendet. Als der Nachtwächter den Raum verlassen hatte, hob Elias das Säckchen vom Boden auf, das neben einem Tischbein gelegen hatte, und holte die Kugel hervor. Wie ein Kind ruhte sie in seinem Schoß, schwer und schwarz und für die Augen undurchdringlich.
„Mit ihr ist es genauso wie mit Klarissa“, sagte er so leise, dass Ruben nicht recht wusste, ob er sich angesprochen fühlen sollte. „Wenn ich jemanden wüsste, dem ich sie anvertrauen könnte, ich würde sie nicht mitnehmen wollen. Aber sie kann nicht allein hier auf Irdorath bleiben. Nicht, nachdem sie schon einmal fast verloren gegangen wäre.“
„Vielleicht werden wir noch froh darüber sein, sie dabei zu haben“, sagte Ruben. „Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wenn wir den Hügel erreicht haben und... nichts geschieht...“
„Daran will ich nicht denken.“
„Ich auch nicht“, gab Ruben zu. „Aber wenn es dazu kommt, dann werden wir ein weiteres Mal hineinschauen wollen. Wir müssen die Kugel mitnehmen, so oder so.“
Elias nickte versonnen in sich hinein, während seine Finger über die glatte Oberfläche des Artefakts strichen.
„Wir werden alle beisammen bleiben.“
Und dann schaute er auf und schenkte Ruben ein Lächeln.
„Hm, ob das wohl hält? Auch wenn es mal stürmisch wird...?“
Prüfend musterte Ruben das Drahtgestell, das einer der Glasmacher noch vor nicht ganz zwei Stunden an dem kleinen Tisch angebracht hatte. Es sah beinahe so aus wie jenes, in das Elias die Kugel in der Werkstatt einmal abgelegt hatte, ließ sich jedoch nach oben hin auf- und zuklappen. Die Kugel konnte also vollständig vom Draht umschlossen werden, was hoffentlich verhinderte, dass sie während allzu heftigem Wellengang hinausfiel und auf dem Boden zersprang. Ruben hatte zwar nicht den Eindruck, dass die Kugel bei einem kurzen Fall gleich zu Bruch gehen würde, aber er wollte es lieber nicht darauf ankommen lassen. Schließlich hatte er sein Leben abhängig gemacht von dieser Kugel und den Bildern, die sie ihm zeigte.
Er warf einen Blick zum Bett hin, wo Matilda gerade das Bett machte, schaute aber gleich wieder weg, als er sah, dass Klarissa genau in seine Richtung guckte. Sie saß in ihrem Sessel, den zwei Bergarbeiter durch die Höhlen und die Grotte getragen und ins Schiff gebracht hatten, und auch ein paar der anderen neuen Gegenstände im Raum erkannte Ruben aus seinem kurzen Besuch bei Klarissa wieder: Die gläserne Karaffe war eingewickelt in einen schmalen Stoffstreifen zwischen zwei Regalbretter geklemmt, und über die Stuhllehne hatte man die zusammengefaltete dunkelgelbe Tischdecke geworfen. All die Schriften und Artefakte, die Teresa hier gesammelt hatte, waren in den Lagerraum auf dem Unterdeck gebracht worden, sodass die Kajüte nun ganz wie eine kleinere und kargere Variante von Klarissas Behausung auf Irdorath wirkte. Ein wenig Mitleid kam in Ruben hoch, als er den Haufen aus Decken und Kissen in der Ecke gleich neben der Tür sah, in dem Matilda nächtigen musste – aber ihm selbst würde es ja nicht besser ergehen. Mangels anderer Räumlichkeiten auf dem Schiff hatten Elias und er es sich im Lagerraum gemütlich gemacht, so gut oder schlecht es eben ging. Er ahnte schon, dass er sich in kürzester Zeit eine ordentliche Erkältung zuziehen würde.
Matilda wollte auf seine halben Selbstgespräche nichts antworten, also gab Ruben den Gesprächsversuch auf. Ein letztes Mal prüfte er, dass das Gestell fest saß und die Kugel nicht herausfallen konnte, dann trat er wieder nach draußen auf das Oberdeck.
Die Sonne stand hoch am wolkenlosen Himmel, und er musste die Augen zukniepen, als ihn das helle Licht blendete. Langsam schritt er über den wackeligen Dielenboden, atmete die angenehm raue Seeluft ein, die sich schon jetzt viel lebendiger anfühlte als alles, was er auf Irdorath geatmet hatte, und sah hinüber zur Insel, die sich ganz langsam von ihnen entfernte. Noch war sie in Schwimmweite, dachte er, aber wusste mit diesem Gedanken selbst nichts anzufangen. Was wollte er noch auf Irdorath? Es fühlte sich gut an, den kargen Felsen hinter sich zu lassen, selbst wenn es bedeutete, dass er jetzt tagelang bloß das immergleiche Blau des Ozeans um sich herum haben würde.
An der Reling, gleich neben dem größten Mann unter den vierzehn starren Menschen, die sie gezwungenermaßen auf ihrer Reise begleiteten – denn sie hatten es nicht geschafft, auch nur einen von ihnen anzuheben –, stand Elias, und Ruben gesellte sich zu ihm.
„Meinst du, wir sind schnell genug?“, fragte er den Magier und deutete hoch zu den beiden flatternden Segeln. „Es weht ja ein ordentlicher Wind, aber so richtig vorwärts kommen wir nicht, oder?“
Elias zuckte mit den Schultern. „Schneller geht es nicht. Vielleicht wird es zwei Wochen dauern statt einer, bis wir das Archipel erreichen. Aber wenn wir der Kugel vertrauen können, dann wird es schnell genug sein.“
Zwei Wochen, dachte Ruben mit Schaudern. Er konnte sich kaum darauf verlassen, dass ihm so viel Zeit blieb. Selbst wenn ihn das Gift nicht umbringen würde, bis sie die Inseln erreicht hatten, es würde doch sicher bis zum Kinn oder darüber hinaus gekrochen sein, sodass es alle sehen konnten. Bis dahin musste er sich irgendetwas einfallen lassen, um die schwarze Haut zu erklären. Aber das war doch sein großes Talent, oder? – Sich etwas einfallen lassen. Leider, musste er sich eingestehen, war er von diesem Talent schon einmal wesentlich überzeugter gewesen.
„Wir sollten uns schlafen legen“, sagte Ruben, nachdem er ein lautes Gähnen nicht hatte unterdrücken können. „Wir sind beide schon viel zu lange wach.“
„Schlaf du nur. Jemand muss darauf achten, dass der richtige Kurs gehalten wird.“
„Matilda kann –“
„Matilda“, lachte Elias freudlos auf. „Die ist schon mit Klarissa überfordert. Geh nur, Ruben. Schlaf dich aus.“
Etwas unschlüssig blieb Ruben noch für einige Augenblicke an der Reling stehen. Es war zwar eine direkte Aufforderung gewesen, aber eine, die sich nach Verrat anfühlte, wenn man ihr Folge leistete. Andererseits, dachte Ruben: Seit wann schreckte er schon vor Verrat zurück? War nicht seine ganze Anwesenheit auf Irdorath ein einziger großer Verrat gewesen? Dass er unbegangen geblieben war, änderte daran nichts.
„Bis nachher“, murmelte Ruben, klopfte Elias noch einmal etwas halbherzig auf die Schulter und drehte sich von der Reling weg.
Es dauerte einen Moment, bis er begriff, dass sich etwas verändert hatte. Die Statuenmenschen, sie standen alle noch genauso starr und steif Seite an Seite wie zuvor. Aber in ihrer Mitte, gleich zwischen einem leicht gebeugten alten Mann und einer auffallend hübschen Frau mit langen schwarzen Haaren... war eine fünfzehnte Person hinzugekommen. Die schwarzen Bandagen waren rissig und blutverklebt, das gemarterte Gesicht im hellen Sonnenlicht noch grässlicher als es in der Nacht gewesen war. Der Wind packte ihr Haar und brachte es zum Schweben.
„Ich habe zugelassen, dass ihr mich quält.“
Als Teresas Stimme erklang, lauter und fester als zuvor, fuhr auch Elias herum.
„Weil ich es verdient habe. Aber diese Menschen haben es nicht verdient, dass ihr sie zum unsichtbaren Turm bringt.“
„Wie bist du auf das Schiff gekommen?“, rief Elias. „Wie hast du – du verfluchte Hexe!“
„Es ist mein Schiff“, zischte Teresa. „Ich kann es betreten, wann immer ich möchte. Ihr hingegen habt kein Recht dazu, es an euch zu nehmen. Und ihr habt kein Recht, die Menschen auf diesem Schiff dem unsichtbaren Turm auszuliefern.“
„Was redest du da?“, entgegnete Ruben. „Wir sind überhaupt nicht auf dem Weg zum unsichtbaren Turm. Wir wissen nicht einmal, wo er liegt, und wieso sollten wir –“
„Ihr seid auf dem Weg zu einer Insel nahe der Irrlicht-Inseln, zu einem Hügel auf dieser Insel, zu einem Platz aus weißem Quarz. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber es steht ein Turm auf diesem Platz. Ein unsichtbarer Turm.“
Ruben wusste nicht, was er denken sollte. Sagte Teresa wirklich die Wahrheit? War es dieser verhassteste aller Orte, zu dem sie die Kugel hatte entsenden wollen?
„Du versuchst, uns zu verwirren“, schnaufte Elias. Er war näher getreten, und seine rechte Hand hatte sich zur Faust geballt. „Du wolltest von Anfang an verhindern, dass wir Miriam finden! Deswegen hast du uns die Kugel gestohlen, deswegen wolltest du uns nicht in deine Kajüte lassen, und nur deswegen bist du jetzt hier!“
„Ihr wisst selbst, welches Unheil der unsichtbare Turm gebracht hat“, sagte Teresa. „Geht nicht dorthin. Tut es euch selbst nicht an, und nicht diesen Menschen, die ihr nicht kennt und die euch nichts getan haben.“
„Was kümmern dich schon irgendwelche Menschen?“, brüllte Elias. „Du bist diejenige, die das Unheil gebracht hat! Du allein!“
Elias’ Faust zuckte empor, und Ruben sah den dunklen Runenstein zwischen seinen Fingern aufblitzen. Plötzlich wusste er mit größter Bestimmtheit, dass ihnen eine Katastrophe bevorstand.
„Elias – !“
Ein heftiger Schlag zerriss die Luft und schleuderte Ruben von den Füßen. Bretter splitterten, Späne und Staub wirbelten hoch, und eine gewaltige Druckwelle schmetterte ihn an die Reling. Er hörte, wie das Holz hinter ihm brach, und panisch suchten seine Hände Halt im aufgerissenen Holzboden. Mit letzter Kraft hielt er sich an Bord des Schiffes und zerrte sich ein Stück vorwärts, bis das Tosen ein Ende hatte und die Stille zurückkehrte.
Einige Sekunden lang lag Ruben keuchend und hustend auf den ramponierten Dielen, dann richtete er sich langsam auf und klammerte sich an einem heil gebliebenen Stück der Reling fest. Die Druckwelle hatte ein großes Loch in die Reling hineingerissen, der Boden des Oberdecks war an vielen Stellen aufgerissen, und Bretterreste lagen kreuz und quer über das Deck verstreut. Elias stand schweigend dort, die Rune noch immer in der Hand. Neben ihm die vierzehn Erstarrten, ihrer Kleidung entrissen und bis auf wenige verbliebene Fetzen ganz und gar nackt – aber noch immer aufrecht und unverletzt, beinahe so als ob gar nichts geschehen wäre. Teresa hingegen war nicht zu sehen, und Ruben fragte sich, ob der Zauber sie über Bord geschleudert hatte – aber was seine Aufmerksamkeit auf sich zog, war etwas ganz anderes.
Panik stieg in ihm auf, als er auf wackeligen Beinen den Weg zum Kajütenhäuschen zurücklegte. Das Dach war an der vorderen Seite eingestürzt, und vor dem Eingang lag ein langes Brett, aber Ruben schaffte es, sich daran vorbei ins Innere zu quetschen.
Matilda schaute ihn aus schreckgeweiteten Augen an, neben ihr die unberührt blinzelnde Klarissa. Und am Boden...
Ein umgeworfener Tisch.
Ein verbogenes Drahtgestell.
Und Scherben. Schwarze Scherben.
-
▨
Noch bevor sie erwachte, hörte Miriam die Melodie.
Eine fließende Abfolge schneller Töne, aufsteigend und abfallend in wiederkehrenden Wellen. Ein klarer, kristallener Klang, wie sie ihn nie zuvor vernommen hatte. Keine Harfe und keine Laute, die sie kannte, kamen dieser Musik nahe, und obgleich sie gedämpft war, so als erreichte sie Miriams Ohren erst, nachdem sie sich durch mehrere dicke Mauern hindurch geschwungen hatte, obgleich sie so leise war wie ein bloßer Nachhall des Traums, den Miriam gerade vergaß, so war sie in ihrem Empfinden doch von einer ungekannten Kraft. Miriam fühlte sich von ihr bei der Hand genommen und hinausgetragen in die Welt außerhalb ihrer Nachtgedanken. Die Melodie stieg an, und als der höchste Ton erklang, langsam verhallte und einer ungewissen Stille Einlass gewährte, da schlug Miriam die Augen auf und atmete nicht, bis die Melodie von Neuem einsetzte, tiefer und ein wenig langsamer.
Die weißen Kissen und Laken, unter denen sie begraben lag, waren so wunderbar flauschig, dass sie geneigt war, sich hineinzukuscheln und die Augen gleich wieder zu schließen, in der wohligen Wattigkeit des Halbschlafs zu verweilen und nichts zu tun als der Musik zu lauschen. Sie spürte, auch wenn sie es noch nicht in Worte zu fassen wusste, dass diese Momente leicht zu den glücklichsten ihres Lebens geraten konnten. Aber zu schnell kamen ihr die bohrenden Zweifel und brachten ein drängendes Gefühl der Unruhe mit sich. Und schließlich der eine Gedanke, der sie auffahren ließ – die eine, panische Frage, die alle Wohligkeit zunichte machte: Wo war die Kugel?
Miriam saß aufrecht im Bett, blickte hinab auf ihre leeren Hände, kaum weniger bleich als der weiße Stoff des Bettlakens, auf dem sie ruhten. Das weiße Nachthemd, das sie trug, hatte sie nie zuvor gesehen. Jemand musste es ihr angezogen haben, jemand musste sie in dieses Bett gelegt haben, und – jemand musste ihr die Kugel genommen haben. Ein grässliches Gefühl der Hilflosigkeit kam in ihr hoch und vertrieb die abklingende Betäubung. Sie fühlte sich auf einmal wie beraubt und liegen gelassen gleich nach der Entbindung.
Miriam schlug das Laken zur Seite und wollte nichts als heraus aus dem Bett, das viel zu breit war für eine einzelne Person, aber sie spürte im gleichen Augenblick, dass ihre Beine eingewickelt waren und sich nicht voneinander lösen ließen. Sie drückte das schwere Laken von sich weg, schob es auf die linke Seite des Bettes, und darunter kamen mehrere ebenso weiße Wolldecken zum Vorschein. Bei dem Anblick begriff sie erst, wie heiß ihr war, dass ihr ganzer Körper schwitzte, wie er sonst nur in der Werkstatt der Glasmacher geschwitzt hatte. Hastig drückte sie das Deckenknäuel von ihrem Unterkörper weg, bis sie die untersten dünnen Tücher sehen konnte, die man um ihre Beine und Füße gewickelt hatte. Eine Falle, dachte sie, und der Gedanke ließ sich nicht abschütteln. Sie rechnete halb damit, dass die Tücher verklebt und verschraubt waren mit ihren Beinen, dass sie sich nicht lösen lassen würden, nicht mit bloßen Händen und vielleicht niemals mehr – aber es waren nichts als gewöhnliche, lose Tücher, und es dauerte nur wenige Sekunden, bis Miriam sich von ihnen befreit hatte und zum Rand des Bettes gekrochen war. Ein vages Gefühl der Erleichterung entfaltete sich in ihr, und als sie sich auf den Bettrand setzte und den Schweiß von der warmen Stirn wischte, da wurde ihr die Melodie wieder bewusst. Diesmal aber konnte sie sich nicht in den Bann schlagen lassen von ihr. Zu deutlich fühlte sie die Fremdartigkeit dieser Klänge, zu drängend waren die Fragen danach, was mit ihr geschehen war und wo sie sich überhaupt befand.
Der Raum war gerade groß genug, um das Bett in sich aufnehmen zu können, und alle vier leeren Wände trugen das gleiche Weiß wie die Kissen und die Decken und das Nachthemd – aber obwohl es ein völlig reines Weiß war, fühlte sie sich nicht geblendet davon. Auf dem Boden, der aus spiegelglatten, weißen Fliesen gelegt war, stand ein ebenso weißes Paar Stoffpantoffeln für sie bereit. Miriam fühlte eine Abneigung gegen den Gedanken, diese Pantoffeln zu tragen, so wie man es für sie vorgesehen hatte. War es nicht ein wenig, als tappte sie erneut in die Falle, diesmal aber bei vollem Bewusstsein? Aber ihre Füße waren nackt, und die Pantoffeln am Ende bloß Pantoffeln. Sie schlüpfte hinein, richtete sich auf und wollte gehen, als sie begriff, dass sie keine Tür gesehen hatte, bloß vier weiße Wände. Gerade als sie der Gedanke packen wollte, dass sie gefangen war in einem Raum ohne Ausgang, dass sie womöglich einem grausamen Tod durch Hunger oder Durst entgegenblickte in schrecklicher Ahnungslosigkeit bis an ihr Ende, da sah sie doch eine Tür: schmale Einkerbungen, die ein großes, langes Rechteck bildeten, und in der Mitte dieses Rechtecks ein kleiner weißer Knauf, der auf den ersten flüchtigen Blick nicht mehr als ein schwacher Schatten gewesen war. Miriam atmete aus, sammelte sich kurz, und dann ging sie darauf zu, umfasste den Knauf und drückte die Tür vorsichtig auf.
Nun war die Melodie überall – und kein Weiß mehr, nirgends.
Sie war in einen großen, lichtdurchfluteten Raum getreten, der keine Wände kannte. Fensterscheiben hatten ihren Platz eingenommen. Nach allen Seiten hin war der Raum verglast, und sogar die kuppelförmige Decke über ihrem Kopf war aus dem durchsichtigen Material gefertigt. Ein tiefblauer Himmel lag darüber, und eine gleißende Sonne brachte sie zum Blinzeln. Sie schirmte ihre Augen mit der rechten Hand ab und ließ den Blick schweifen über das, was durch die seitlichen Fensterwände zu sehen war: ein ewiger, niemals endender Wald, den sie aus weiter Höhe überblickte, und der sich in sämtliche Richtungen bis an alle Horizonte erstreckte. Der Ausblick war so atemberaubend und mit einer solchen Plötzlichkeit über sie gekommen, dass sie für einige Zeit nicht anders konnte, als durch die Gläser dieser gewaltigen Fenster zu blicken und die strahlend bunten Vögel zu beobachten, die weit unten über den Wipfeln ihre Bahnen zogen. Es war schwer, Details auszumachen, aber es war offensichtlich, dass die Bäume gänzlich andere Blätter trugen als alle, die sie bislang gesehen hatte. Lang und schlangenhaft hingen sie von den Ästen herab, schienen verwachsen und verschlungen zu sein mit den Blättern der benachbarten Bäume und vielleicht auch mit sich selbst. Wie ein einziger grüner Teppich lag dieser Wald unter ihr, und wäre nicht der grünliche Fliesenboden unter ihren Füßen und der ebenso grüne Kasten hinter ihr gewesen, aus dem sie gerade getreten war, sie hätte geglaubt, in der freien Luft zu schweben.
Aber sie war in einem Raum, zweifellos, und sie war in diesem Raum nicht allein.
Ein großes, gläsernes Objekt befand sich in seiner Mitte, gleich unterhalb des höchsten Punktes der Kuppel. Seine Form war ganz gerade an der einen Seite, an der anderen hingegen weit ausladend und wellenförmig geschwungen. Es stand auf vier dicken Beinen aus Glas, und es hatte einen Deckel, der hochgeklappt war und von einem langen gläsernen Stab offen gehalten wurde. Im Inneren waren dutzende lange Stränge aus einem feinen, fast ebenso durchsichtigen Material angebracht, an deren Ende kleine glänzende Hämmerchen saßen. Am auffälligsten aber waren die vielen, kurzen Riegel in zwei unterschiedlichen Größen, die entlang des geraden Endes in einer langen Reihe angebracht waren. Ein gut gebräunter Mann saß auf einem Hocker vor dem Glasobjekt, mit freiem und vor Schweiß glänzenden Oberkörper, und immer wenn einer seiner unablässig tanzenden Finger einen der Riegel hinunterdrückte, fuhr eines der Hämmerchen hinab und die Melodie wurde einen weiteren Ton lang fortgeschrieben.
Er musste Miriam längst bemerkt haben, denn als sie ein wenig näher herantrat, da blickte der Mann auf, während seine Finger ungestört fortfuhren, und lächelte sie an ohne jede Spur von Überraschung.
„Willkommen“, sagte er mit einer tiefen und angenehmen Stimme, die so gut zum Klang der Musik passte, dass Miriam fast glauben wollte, die Begrüßung wäre Teil des Liedes gewesen, das der fremde Mann spielte. Aber er schaute ihr unverwandt in die Augen, und Miriam schaute zurück in das freundliche, stoppelbärtige Gesicht.
„Wo bin ich?“, fragte sie, weder fähig noch willens, die Freundlichkeit zu erwidern. „Wo ist die Kugel?“
„Ich weiß von keiner Kugel.“ Das warme Sonnenlicht spiegelte sich sanft auf der schweißnassen Haut des Mannes, auf der glatten Stirn wie auf den muskulösen Armen. „Ihr hattet nichts bei Euch außer den Resten Eurer Kleidung, als Ihr hier ankamt. Alles andere wäre auch sehr ungewöhnlich gewesen.“
„Ich hatte sie bei mir, ganz sicher“, sagte Miriam. „Eine schwarze Kugel aus Glas. Ihr könnt sie unmöglich übersehen haben.“
„Schwarzes Glas?“ Die Melodie veränderte sich, kreiselte nun um ein kurzes Motiv aus wenigen Tönen. „Also hatte ich recht mit meiner Vermutung, dass Ihr nicht zufällig hierher gefunden habt.“
„Ich habe überhaupt nicht hierher gefunden“, widersprach Miriam, während sie sich bemühte, ihre Gedanken zu ordnen. Es gab zweifellos eine Erklärung für das, was ihr widerfahren war. „Jemand muss mich hierher gebracht haben. Ihr wart das, nehme ich an.“
Der Mann, der den Blick nicht von ihr gelöst hatte, schüttelte lächelnd den Kopf, während seine Finger zunehmend energischer auf die gläsernen Blöcke hinabfuhren. „Oh nein, Ihr irrt Euch. Ich kenne Euch nicht, und weder weiß ich, woher Ihr gekommen seid, noch wie ich Euch von hier aus an diesen Ort hätte bringen können. Ihr selbst habt Euch her gebracht.“
„Aber... wo bin ich? Was ist das für ein Wald? Für ein... Ort?“
Eine kurze Schwäche durchfuhr ihren Körper, als sie das Wort Wald aussprach, denn es war dieser Moment des Aussprechens, in der ihr die Endlosigkeit und die Fremdartigkeit des Waldes erst vollends bewusst wurde. Nie hatte sie von einer solchen Landschaft gelesen. Sie konnte überall auf der Welt sein – oder nirgendwo. In jedem Fall war sie weit fort von Irdorath.
„Ein Ort der Zusammenkunft“, sagte der Fremde. „Ein Ort des Lernens, des Forschens... ein Ort der Magie.“
Die anschwellende, bald dröhnende Musik schmerzte in ihrem Schädel, aber gleichzeitig fräste sich die Melodie klarer und unwiderstehlicher denn je in ihr Bewusstsein. Ein dünn gewobener Schleier aus Dumpfheit legte sich über den weißen Knochen ihres Kopfes, während sie sich von den Tönen packen ließ.
„Aber wo...?“ Sie ließ die Frage unvollendet, wollte die Augen schließen und das Denken aufgeben, nur noch der Musik zur Verfügung stehen.
„Sucht Ihr nach einem Namen? Jeder wird Euch einen anderen geben, und jeder ist genauso gut wie der andere. Ich werde Euch –“
Ein harscher, desolat verkehrter Ton zertrümmerte die Magie der Melodie. Miriam fuhr zusammen, als hätte sie jemand geschlagen. Der Mann versuchte noch ein paar Takte lang, die Melodie zu retten und weiterzuführen, aber schon verspielte er sich erneut und brach ab.
„Schaut mich nicht so an“, sagte er mit einem Schulterzucken und erhob sich von seinem Hocker. „Gleichzeitig Gespräche führen und die richtigen Tasten treffen, das ist eben nicht so einfach.“
Sie sagte nichts, und er streckte sich mit zusammengekniffenen Augen im Sonnenlicht. Dieser Mann hatte den Körper eines Arenakämpfers, dachte Miriam. Eines Kriegers. Was fehlte, waren die Narben.
„Ich verstehe, dass Ihr durcheinander seid“, fuhr er fort, nachdem er sie ein paar Wimpernschläge lang aufmerksam angeschaut hatte. „Und vielleicht glaubt Ihr noch immer, jemand hätte Euch entführt ganz gegen Euren Willen. Lasst mich versuchen, Euch vom Gegenteil zu überzeugen. Aber bevor wir gehen, müsst Ihr Euch etwas anziehen. Ihr wollt sicher nicht im Nachthemd herumlaufen.“
Er wandte sich von ihr ab, um sich nach etwas zu bücken, und während in Miriams Ohren noch die letzten schrägen Reste der zerstörten Melodie verhallten, drehte er sich auch schon wieder zu ihr um und hielt ihr ein wallendes, strahlend weißes Kleid entgegen. Miriam hatte das Gefühl, etwas verpasst zu haben, aber das Gefühl hielt sie nicht lange in Beschlag. Vielleicht hatte das Kleid tatsächlich die ganze Zeit dort gelegen, aber selbst wenn nicht – an einem Ort der Magie war ein solcher besserer Taschenspielertrick wohl das Geringste, mit dem sie rechnen durfte.
Der halbnackte Mann reichte ihr das Kleid, das einen angenehm frischen Seifenduft verströmte. Miriam drückte es an sich und blieb etwas unschlüssig inmitten des verglasten Raumes stehen.
„Nun?“, fragte er nach kurzem Warten. „Wollt Ihr es nicht anziehen?“
Sie nickte, noch immer nicht ganz klar im Denken, und wandte sich dem grünen Kastenraum zu, in dem sie erwacht war. Der Fremde jedoch hielt sie zurück.
„Dorthin dürft Ihr nicht zurückkehren.“ Trotz aller freundlichen Wärme, die nach wie vor in dieser Stimme lag, verstand Miriam sofort, dass dieses Verbot ein absolutes war. „Dieser Raum ist nur für das erste Erwachen bestimmt. Ihr werdet eine andere Unterkunft erhalten.“
„Ah“, machte Miriam, und dann kehrte wieder Stille ein, bis sie sagte: „Nun, dann... wo ist diese Unterkunft?“
„Alles zu seiner Zeit.“ Der Mann verschränkte die Arme vor der blanken Brust. Sie wusste nicht recht zu sagen, ob es ein Zeichen von Ungeduld war. „Zuerst solltet Ihr das Kleid anziehen.“
„Hier?“
„Wieso nicht?“, erwiderte er und schien tatsächlich nicht zu verstehen.
„Ich meine... vor Euch...?“
„Oh, nun, wenn Ihr wünscht, dann werde ich mich natürlich abwenden“, sagte er schmunzelnd, und seine Augen blitzten belustigt auf, bevor er sich umdrehte. Miriam fühlte sich von einem heißen Frösteln ergriffen, als sie diesen Blick sah. Natürlich, er hatte sie längst nackt gesehen. Wahrscheinlich war er es gewesen, der ihr das Nachthemd angezogen hatte.
Der Gedanke machte es leichter, es wieder abzustreifen. Einige stille Sekunden verstrichen, vielleicht eine ganze Minute, bis Miriam das Kleid angelegt hatte. Zuerst fürchtete sie, es alleine nicht zu schaffen und um Hilfe bitten zu müssen, aber dann waren ihre Arme und ihre Hände plötzlich wie von allein an den richtigen Stellen gelandet, und ihr Kopf schlüpfte durch einen engen, aber mit weichem Stoff gepolsterten Kragen. Das Kleid war sehr hübsch, dachte sie, als sie an sich herab sah. Ein Sommerkleid, bloß ohne die Farben. Als Kind hatte sie so etwas tragen wollen, noch ohne sich eine rechte Vorstellung davon machen zu können. Sie hatte es nur aus Büchern gekannt, aber das Wort Sommerkleid hatte ihr immer gut gefallen. Jetzt, da sie zum ersten Mal eines trug, fühlte es sich merkwürdig unangemessen an. Da war die vage Ahnung, dass es eine andere geben musste, der dieses Kleid eigentlich gehörte und die es an ihrer Statt tragen sollte.
„Gehen wir“, sagte der Mann, ohne sich zu ihr umzudrehen, und deutete auf einen Punkt am Boden des Raumes hinter dem großen Musikinstrument, an dem Miriam nun eine runde Aussparung in den Fliesen bemerkte. Als sie näher trat, erkannte sie die obersten Stufen einer gewundenen Wendeltreppe, die hinab in einen dunkleren Bereich des Gebäudes führte; in ein Gewölbe, das in ein rötliches Licht getaucht war. Die Treppe selbst war aus schmucklosem, grauem Gestein gefertigt und hatte etwas auffällig Schmutziges an sich, das in Miriams Augen nicht im Geringsten zum Rest des Ambientes passen wollte.
„Vielleicht sollte ich Euch warnen“, sagte er, während sie nebeneinander die Stufen der Treppe hinabstiegen. „Es sind nicht alle Stockwerke so ruhig wie das oberste. In den meisten wird gearbeitet, und das geht nicht ohne Lärm vonstatten. Passt besser auf, dass Ihr nicht in etwas hinein stolpert.“
Miriam wusste nicht, was er mit dieser letzten Bemerkung meinte, aber sie war das Nachfragen leid geworden. Sie kam sich schrecklich dumm dabei vor, all diese Fragen zu stellen und sich nach jeder Antwort bloß noch ein bisschen verlorener zu fühlen. Wenigstens nach seinem Namen allerdings hätte sie gerne gefragt, doch die deutliche Ahnung, dass sie auch auf diese Frage keine eindeutige Antwort bekommen würde, hielt sie davon ab.
„Ihr habt mir noch gar nicht Euren Namen genannt“, sagte er plötzlich, und vor Schreck wäre sie beinahe ins Stolpern geraten. Er konnte doch nicht etwa... Gedanken lesen?
„Miriam“, platzte es etwas zu hastig aus ihr heraus, während sie versuchte, die beängstigende Vorstellung abzuschütteln. „Und Ihr seid...?“
„Laurin“, kam es prompt zurück. „Oder Oliver, wie Ihr mögt. Aber Laurin klingt besser, findet Ihr nicht?“
Sie überlegte noch, was sie darauf antworten sollte, als sie das Ende der Wendeltreppe erreichten, das sich allerdings bloß als Anfang einer ganzen Reihe weiterer Treppen herausstellte. Zögerlich folgte Miriam ihrem Führer auf die steinerne Plattform jenseits der untersten Stufe, von der aus sechs gerade Treppen, die aus unterschiedlichsten Materialien bestanden, in die rötlich schimmernde Dunkelheit zu ihren Füßen hinabführten. Der kreisrunde Raum, der sich nach unten hin erstreckte, war so tief, dass kein Boden zu erkennen war. Bei genauerem Hinsehen allerdings erkannte Miriam, dass zumindest einige der Treppen zu weiteren Plattformen führten, die inmitten des Raumes zu schweben schienen. Neuerliche Treppen gingen aus diesen steinernen Scheiben hervor, die ihrerseits in der Tiefe versanken; eine der Plattformen jedoch war durch einen Steg aus dunklem Fels mit der Wand verbunden, die aus merkwürdig gebogenen schiefergrauen Ziegelsteinen zusammengesetzt war und dem Raum die Form einer endlos langen, ausgehöhlten Säule verlieh. Gleich über der Stelle, an der der Steg auf die Wand auftraf, waren im schummerigen Licht deutlich die Umrisse einer Tür zu erkennen. Miriam konnte nur erahnen, dass sich in der Tiefe, am Ende all dieser Treppen, viele weiterer solcher Türen befinden mussten.
„Das Treppenhaus“, sagte Laurin, und das Wort vibrierte fremdartig in Miriams Kopf. „Es ist der Kern dieses Ortes und wird Euch in jedes Stockwerk bringen, wenn Ihr vorsichtig seid.“
„Wenn ich vorsichtig bin? Was meint Ihr damit?“ Miriam ärgerte sich ein wenig darüber, dass sie nun doch wieder ins Fragen verfallen war, aber die Verblüffung über die der Länge nach gewaltigen Ausmaße des Raumes, in dem jedes Wort vielfach an den gebogenen Wänden widerhallte, stellte diese Gedanken zurück. In einem solchen Raum musste das Fragen erlaubt sein.
„Nun, es gibt keine Geländer an den Treppen, aber sehr wohl einen Boden ganz unten, auch wenn es von hier aus vielleicht nicht danach aussehen mag. Ihr solltet also besser nicht ausrutschen.“
Nicht zum ersten Mal hatte Miriam das Gefühl, dass er sich über sie lustig machte. Doch vielleicht, dachte sie dann, war der Hinweis – so banal er auch sein mochte – an einem solchen Ort der Magie tatsächlich einer der entscheidendsten. Es war bekannt, dass Magier gern an Kleinigkeiten zugrunde gingen, insbesondere wenn sie die größeren Herausforderungen des Universums bereits erfolgreich gemeistert hatten.
„Folgt mir einfach und achtet auf Eure Schritte.“
Er entschied sich für die hellste der Treppen, die aus einer Substanz gefertigt war, die Miriam an die kleinen Figürchen erinnerte, die sie vor Jahren einmal im Angebot eines reisenden Händlers in Khorinis gesehen hatte. Damals hatte sie ihm geglaubt, als er von dem riesigen Troll berichtet hatte, den er erlegt und aus dessen Hauern er die winzigen Statuetten geschnitzt haben wollte. Diese Treppe jedoch... sie wollte sich den dazugehörigen Troll lieber nicht vorstellen.
Obwohl die Treppe breit genug war, um einen ausreichenden Abstand einzuhalten zu dem Abgrund unter ihren Füßen, fühlte sich Miriam nach Laurins warnenden Worten mit jedem weiteren Schritt noch ein bisschen wackeliger auf den Beinen. Dazu kam, dass es in diesem vom Sonnenlicht abgeschotteten Teil des Gebäudes deutlich kühler war als noch zuvor unter der Glaskuppel. Sie glaubte sogar, auf den nackten Armen des Fremden eine leichte Gänsehaut zu bemerken und fragte sich plötzlich zum ersten Mal, wieso er sich eigentlich nicht auch etwas angezogen hatte. Nach wie vor trug er nichts außer zwei weißen Sandalen und einer kurzen, weißen Stoffhose, die ihm gerade einmal bis zu den Kniekehlen reichte.
Als sie die schwebende Plattform am Ende der Treppe erreicht hatten und Miriam einen Blick hinab wagte, bestätigte sich ihre Vermutung: Viele weitere Treppen waren im schwachen, roten Glühen sichtbar geworden, und auch drei, vier weitere Türen hatten sich an verschiedenen Stellen der gekrümmten Ziegelwand aus der Dunkelheit geschält. Laurin begann mit dem Abstieg der nächsten Treppe, die eine sehr lange und leider weniger breite war, und Miriam sah, dass sie genau zu einer dieser Türen führte. Sie hatte gerade den Fuß auf die oberste Stufe gesetzt, da drang aus der Tiefe ein hohes, feines Klirren an ihr Ohr, wie von winzigen Gläsern, die unablässig aneinander gestoßen wurden. Ehe sie sich versah, waren drei kleine bunte Vögel zu ihr aufgeschossen, umkreisten sie nervös und klapperten dabei mit ihren roten Schnäbelchen. Erst als sich eines der Tiere einen kurzen Moment lang flatternd vor ihrem Gesicht in der Schwebe hielt, erkannte Miriam, dass diese Vögel nicht aus Fleisch und Blut waren. Ihre Haut war dünn und brüchig, und die bunte Farbe war an einigen Stellen abgeblättert. Darunter kam glänzend und durchsichtig der Stoff zum Vorschein, aus dem sie geschaffen waren: Weißes Glas. Sie waren fliegende, lebendige kleine Glasgeschöpfe.
„Beachtet sie gar nicht“, sagte Laurin, als er bemerkt hatte, dass Miriam stehen geblieben war. „Sie sind als Wächter hier, aber Euch werden sie nichts tun.“
„Wer hat sie geschaffen?“, fragte Miriam fasziniert und hob die rechte Hand, aber keiner der Vögel wollte sich auf ihren Handrücken setzen. Rastlos umkreisten sie ihren Körper, klirrend und klappernd, und dann plötzlich, als hätte ihnen jemand ein Zeichen gegeben, ließen sie von ihr ab und tauchten wieder hinab in die lodernde Finsternis.
„Irgendjemand hier“, sagte er und klang dabei fast ein bisschen gelangweilt. „Welche Rolle spielt es? Sie sind nützlich, also behalten wir sie.“
Miriam fühlte sich an den Ausblick erinnert, den sie im obersten Stockwerk genossen hatte, und fragte: „Sind es die gleichen Vögel, die draußen im Wald herumfliegen?“
„Draußen im Wald?“, erwiderte er stirnrunzelnd, aber dann schien er zu begreifen und sagte schmunzelnd: „Ach so. Nein, nein, das sind andere Vögel. Ganz sicher.“
Damit wandte er sich ab und setzte den Abstieg fort. Miriam folgte ihm, aber in Gedanken war sie noch ganz bei den seltsamen Glastieren, denen eine ihr unbekannte Magie Leben eingehaucht hatte. Insbesondere ein Gedanke ließ sie nicht los: Konnte es ein Zufall sein, dass so vieles an diesem rätselhaften Ort aus Glas gefertigt war?
Als sie die mit der Wand verwachsene Steinplatte am Ende der Treppe erreichten und Miriam die Tür zum ersten Mal aus der Nähe sah, war sie beinahe ein wenig überrascht davon, dass sie eine ganz gewöhnliche Holztür vor sich hatte. Keine Zauber war vonnöten, um sie zu öffnen. Laurin nahm einfach den Türknauf in die Hand, drehte ihn kurz und zog die Tür auf.
Miriam folgte ihm in einen schmalen, langen Raum, der ihr wie eine Art Korridor vorkam. Die lange Wand, auf die sie schaute, war wieder einem riesigen Fenster gleich aus Glas gefertigt, und was dahinter lag... war Wasser. Dunkles, gräuliches Wasser, in dem sich vereinzelte farblose Quallen treiben ließen und träge pulsierten. Eine Wasseroberfläche war nicht zu erkennen, ebenso wenig wie ein Grund. Es war wie mitten in ein endloses Meer hineinzublicken.
„Wartet!“, hielt sie ihren Begleiter auf, der bereits vorangegangen war. „Wie ist das möglich? Gibt es einen unterirdischen See unter dem Wald, oder... aber wir sind nicht so weit hinabgegangen. Wir können unmöglich unterhalb des Meeresspiegels sein.“
Er hielt inne und musterte sie mit zusammengezogenen Brauen, als ob er ihr gerade zum ersten Mal über den Weg gelaufen wäre. „Man möchte meinen, dass Ihr eine Magierin seid, wenn Ihr hierher gefunden habt. Wieso also haltet Ihr Euch mit den langweiligsten Erklärungen auf? Wo bleibt Eure Phantasie?“
„Hört zu“, sagte sie, und ihre Stimme bebte zu ihrem Ärger deutlich mehr vor Unsicherheit als vor angemessenem Zorn angesichts der Überheblichkeit, mit der sie behandelt wurde. „Es ist mir ganz gleich, was Ihr von mir denkt, aber ich möchte endlich wissen, wo ich bin und wieso Ihr mich hergebracht habt! Es ist ein Ort der Magie, ja, ich verstehe schon, aber –“
„Ruhig, ruhig.“ Plötzlich wirkte sein Lächeln wieder ehrlich und freundlich. „Die Antwort ist gleich dort drüben.“
Er deutete zum Ende des Korridors, wo Miriam eine weitere Tür neben einem kleinen Fenster erkennen konnte, das in die Wand eingelassen war. Sie sagte nichts und setzte sich strammen Schrittes in Bewegung, freute sich über die zumindest kleine Befriedigung darüber, dass er es einmal war, der ihr hinterher laufen musste.
„In diesem Raum habe ich Euch gefunden“, berichtete Laurin. „Ihr wart nicht bei Bewusstsein, aber das ist nichts Ungewöhnliches für Neuankömmlinge. Es kostet Kraft, außerhalb der festen Routen zu reisen.“
Schon im Näherkommen erkannte Miriam, dass in dem Raum hinter dem Fenster offenbar eine Reihe von Apparaturen aufbewahrt wurde, aber erst als sie nur noch wenige Schritte vom Ende des Flurs trennten, fiel ihr auf, dass sie eine dieser Strukturen schon häufiger gesehen hatte. Zwischen einem großen, würfelförmigen Kasten aus schuppenartig ineinander gelegten Bronzeplättchen und einer verschnörkelten Kreidezeichnung auf dem Boden stand eine alte, runde Steinplatte, an deren Rand vier nach innen gekrümmte, spitz zulaufende Steinpfosten angebracht waren, die wie die langen Reißzähne eines riesigen Raubtiers aussahen.
„Das ist einer der Teleporter des alten Erbauervolks“, sagte Miriam. „Sie sind über ganz Khorinis verteilt, aber... es gibt keinen auf Irdorath. Wie sollte ich mit einem von denen...?“
„Ihr seid auch nicht mit diesem angekommen. Tretet näher an das Fenster und schaut hinab.“
Sie folgte der Aufforderung, und als sie das Gesicht ganz nah an das Glas hielt und den Blick senkte, da sah sie am Boden, gleich neben der Wand, eine glänzende, runde Scheibe, gefertigt aus einem unruhig schimmernden Metall. Sie erkannte sie im ersten Moment wieder. Einer solchen Scheibe war sie zuvor schon begegnet, das letzte Mal erst kurz vor ihrem Verschwinden von Irdorath.
„Das... ist auch ein Teleporter?“ Sie hatte sich, bevor sie schließlich das Interesse daran verloren hatte, einige Gedanken gemacht über das merkwürdige Objekt am Boden einer der größten Hallen des Beliartempels von Irdorath, hatte geglaubt, die am Rand eingeritzten Symbole in einem alten Buch über den vergessenen Zauber des Lebensentzugs wiedererkannt zu haben und eine Theorie gesponnen, die ihr selbst von Anfang an eine Spur zu abenteuerlich vorgekommen war. An die Möglichkeit, dass die Metallscheibe Trägerin eines Teleportzaubers sein konnte, hatte sie allerdings nie gedacht.
„Natürlich“, erwiderte er. „Alles, was Ihr dort seht, dient der Teleportation von Lebewesen. Wir haben sichergestellt, dass es für jede uns bekannte Form des magischen Reisens einen Zielpunkt gibt in diesem Raum. Damit die Leute zu uns finden, Ihr versteht?“
„Nein, ich verstehe nicht“, gab sie ehrlich zu. „Ich bin schon früher über diese Scheibe gelaufen, ohne dass etwas passiert ist. Und der Beliartempel, aus dem ich gekommen bin, ist eine Ruine. Wieso führt ein Teleporter von dort hierher? Habt Ihr einmal in Kontakt gestanden mit den Nekromanten von Irdorath?“
„Nur ein wenig, und das ist schon lange her. Weit vor meiner Zeit. Aber das ist nicht der Punkt, wisst Ihr? Die Schwarzmagier haben solche Plattformen benutzt, um von einem ihrer Tempel oder Türme zum nächsten zu reisen, genau wie die Erbauer von Jharkendar ihre eigenen Plattformen dazu benutzt haben, um weite Strecken über die Insel Khorinis zurückzulegen. Niemand hat einen Teleporter erbaut mit dem Ziel, hierher zu gelangen. Aber derartige Magie ist keinesfalls unveränderlich. Wir haben den astralen Labyrinthen dieser Welt gewissermaßen einen neuen Ausgang hinzugefügt. Allerdings einen, zu dem keine Route führt. Zu dem jeder seine eigene finden muss.“
Unschlüssig, was sie davon halten sollte, starrte Miriam durch das klare Fensterglas. Manche der Gerätschaften wirkten wie aus uralten Tempeln geborgen, aber es waren keine Spuren von Staub oder Verwitterung an ihnen zu erkennen. Sie waren Replikate, zweifellos. An einem der größten blinkten von Zeit zu Zeit blaue und gelbe Lichter auf.
„Aber ich habe mich gar nicht bemüht, irgendeine Route zu finden“, versuchte Miriam ihre Verwirrung in Worte zu fassen. „Ich war wegen... wegen einer ganz anderen Sache im Tempel. Wenn ich über diese Metallscheibe gegangen bin, dann nur zufällig.“
Plötzlich blitzte das schwarze Bild wieder vor ihren Augen auf, zum ersten Mal seit dem Erwachen. Das Bild, das ihr die Kugel gezeigt hatte, gleich nach der Erkaltung, im ersten Blick.
Teresa.
Sie hatte Teresa in den unterirdischen Tempelgewölben nicht angetroffen, aber das Bild im Glasnebel war eindeutig gewesen: Teresa mit bleichem Haar und fahlem Blick, wie sie eingebunden in schwarze Bänder durch die dunklen Hallen Irdoraths schlich. Gleich neben der glänzenden Scheibe war Teresa stehen geblieben, in der Hand eine flackernde Laterne. Vielleicht hätte sie keine Nacht verstreichen lassen sollen, bevor sie nachgesehen hatte, ging es Miriam jetzt durch den Kopf. Vielleicht hätte sie es Elias nicht verschweigen dürfen, nicht auf seine Abreise warten sollen. Aber sie war noch immer davon überzeugt, dass es nicht gut ausgehen konnte, wenn Elias erneut auf Teresa traf. Er sprach nicht über sie, aber sie wusste, besser als er selbst vielleicht, dass sein Hass auf sie über die Jahre nur gewachsen war. Sie hatte allein mit Teresa reden wollen, nach den Gründen für ihre heimliche Ankunft auf Irdorath fragen wollen. Keine Versöhnung, natürlich nicht, aber auch kein Streit, keine endlose, sinnlose Feindschaft. Sie hatte versucht, vernünftig mit der Situation umzugehen.
Aber Teresa war nicht dort gewesen. Vielleicht war sie am Abend zuvor dort gewesen, vielleicht würde sie auch erst in fünf Jahren einen Fuß in den Tempel setzen. Die Kugel hatte ihr ein Bild der Zukunft gezeigt, daran hatte Miriam keinen Zweifel. Bloß den genauen Zeitpunkt dieser Zukunft, den hatte sie für sich behalten. Nun war die Kugel fort, und Miriam konnte nicht mehr versuchen, ihr dieses Geheimnis zu entlocken.
„Ihr wärt nicht hier, wenn Ihr Euch nicht selbst hergebracht hättet“, behauptete Laurin zum wiederholten Male. „Der Zauber, der den Weg hierher geebnet hat, er ist in Eurem Kopf.“
Miriam löste sich vom Fenster und blickte ihm in die Augen. „In meinem Kopf?“
Er nickte. „Auf diese Weise finden die meisten zu uns. Die Magie dieses Ortes ist in Büchern und Schriftrollen über die Bibliotheken dieser Welt verteilt. Wir wollten, dass jeder, der sie ausgiebig genug studiert, auch die Möglichkeit hat, selbst hierher zu finden – an den Ort, an dem sie geschaffen wurde, an dem noch immer an ihr gearbeitet wird. Deswegen ist in den Büchern und Schriftrollen, die wir in die Welt schicken, ein geheimer Zauber versteckt... kleine, unsichtbare Zeichen zwischen den Buchstaben, verborgene Runen, die an einen verborgenen Ort führen... Ihr habt diese Runen in Eurem Kopf. Ohne, dass Ihr es gemerkt habt, sind sie ein Teil von Euch geworden. Und als die Gelegenheit kam, als Ihr den Teleporter betreten habt... da habt Ihr die Runen gewirkt und die Reise auf Euch genommen. Vielleicht habt Ihr es nicht bewusst getan, aber glaubt mir: Ihr wärt nicht hier, wenn Ihr nicht hier sein wolltet.“
„Dies ist... der Ort...?“ Der Verdacht hatte schon seit geraumer Zeit unter der Oberfläche gebrodelt, nicht erst seit sie die gläsernen Vögel gesehen hatte. „Der Ort, an dem die erste der schwarzen Kugeln erschaffen wurde?“
Laurin legte den Finger an die Oberlippe und machte ein Gesicht, als ob er darüber erst einmal eine ordentliche Weile lang nachgrübeln müsste. „Hm, die schwarzen Kugeln, ja... Das ist sehr lange her. Ihr habt gesagt, dass Ihr im Besitz einer solchen Kugel wart?“
„Ja, ich... ich habe sie bei mir getragen, als ich...“
„Dann liegt sie sicher noch in diesem Tempel, von dem Ihr gesprochen habt. Ein Glück, dass sie dem Anschein nach nicht vom Teleportzauber erfasst wurde. Die Magie der Schwarzmagier ist in vielerlei Hinsicht beachtlich, aber der Transport unbelebter Materie gehört nicht gerade zu ihren Stärken. Von Eurer Kleidung war nicht viel übrig, als ich Euch gefunden habe, aber ich kann Euch beruhigen: Ich habe keine Glassplitter entdeckt. Die Kugel ist sicherlich unversehrt.“
„Dann lasst mich zurück“, sagte Miriam, plötzlich ganz ungeduldig beim Gedanken an die einsam zurückgebliebene Kugel. „Ich muss wieder durch den Teleporter, zurück nach Irdorath. Bevor sie jemand findet und...“
Bevor Teresa sie findet.
Der Gedanke bereitete ihr körperliche Schmerzen. Sie wusste nicht wann, aber irgendwann würde Teresa Irdorath erreichen und eben jenen Tempelraum betreten, in dem nun die Kugel lag. Es war eine Gewissheit, sie hatte es gesehen. Vielleicht würde dieser Moment erst in Monaten oder Jahren kommen, vielleicht aber auch noch heute. Jede Sekunde, die sie hier in der unbekannten Ferne verbrachte, konnte diejenige sein, in der Teresa sich nach der Kugel bückte.
„Ich fürchte, das ist nicht möglich.“ Er setzte eine bedauernde Miene auf, aber Miriam konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er nicht ganz unglücklich darüber war. „Die Teleporter, die wir erbaut haben, sind bloße Ausgänge. Sie kennen keine Ziele, an die sie Euch bringen könnten.“
Ein Schwall heißer Panik stieg ihr in den Kopf. „Das heißt, Ihr – Ihr sorgt mit Euren versteckten Zaubern dafür, dass die Leute hier ankommen und – lasst sie dann nicht mehr gehen?“
„So ist es nicht.“ Laurin hob abwehrend beide Hände. „Es gibt viele Wege, die von hier wegführen – Ihr werdet mehr Ausgänge finden als an jedem anderen Ort. Aber was ist es, das Euch so schnell wieder fort treibt? Ihr habt so viel Zeit verbracht mit den Schriften, die in diesen Räumen entstanden sind... seid Ihr gar nicht neugierig?“
Sein Blick wurde ihr plötzlich unangenehm, und sie schaute zur Seite. Jenseits der Glaswand drückte sich ein blassgelber, schwammiger Fisch an die Scheibe, ganz so als wollte er das Wasser hinter sich lassen und in die Welt des Trockenen vordringen. Über ihm bildeten drei Quallen eine Dreiecksformation, blähten sich mit zitternden Nesseln immer wieder im Takt einer unhörbaren Musik auf. Miriam blieb einen Moment zu lange hängen an diesem Bild, denn in der nächsten Sekunde sah sie noch etwas anderes in der dunklen See. Ein länglicher Schatten, der ganz langsam hinabsank...
Sie trat näher, bis sie direkt vor der Scheibe stand. Zuerst glaubte sie, in dem Schatten ein merkwürdig verwachsenes Ungetüm auszumachen, ein Monster der Meere, erlegt vielleicht oder auch nur schlafend. Aber gleich darauf wurde ihr bewusst, dass es zwei Menschen waren, die dort trieben. Der eine hatte Rubens schmale Gestalt, aber ein totes und leeres Gesicht, und hielt den anderen Menschen von hinten umklammert. Gemeinsam sanken sie in der Umklammerung hinab, und dann, als sie Miriams Augenhöhe erreicht hatten und sie nichts als die Scheibe von ihnen trennte, da sah sie das Gesicht des zweiten Menschen. Es war aufgedunsen und von dicken, schwammigen Falten durchsetzt. Beide Augenhöhlen waren schwarz und leer. Aber dennoch, es war und blieb ihr eigenes Gesicht.
Miriam riss sich los davon, wandte sich ab mit Gewalt, und ein schrecklich juckender Hustenreiz kroch ihr den Hals hoch, der sich erst nach einigem hilflosen Gekrächze wieder lösen wollte. Sie wankte, suchte vergeblich nach Halt an der glatten Glaswand, und schaffte es nur mit Mühen, sich auf den Beinen zu halten.
„Laurin?“, brachte sie mit leiser Stimme hervor, aber der Korridor war leer. Ihr Begleiter war fort. Hinter dem Glas war wieder nichts als dunkles Blau und der Tanz der Quallen zu sehen. Nicht einmal der sehnsüchtige Fisch war noch irgendwo auszumachen.
Sie war überrascht darüber, wie sehr es sie schockierte, plötzlich allein zu sein. So wenig sie Laurin über den Weg traute, so verloren fühlte sie sich ohne seine Hilfe. Dieser Ort schien riesig zu sein – woher sollte sie wissen, wohin sie sich zu wenden hatte? Hatte ihr Laurin nicht etwas von einer Unterkunft gesagt, die sie erhalten sollte? Aber er konnte doch unmöglich von ihr erwarten, dass sie ganz allein dorthin finden würde?
Der Drang, diesen ganzen schrecklichen Ort wieder zu verlassen, war plötzlich stärker als je zuvor. Sie lief zu der Tür zum Teleporterraum und rüttelte am Knauf, versuchte vergeblich durch Drehen und Ziehen und Pressen etwas zu erreichen. Die Tür war versperrt, und selbst wenn sie es schaffen sollte, das Fenster einzuschlagen, so war es doch viel zu klein, um hindurch zu klettern.
Ein anderer Ausgang, dachte Miriam. Es musste einen anderen Weg geben – Laurin hatte selbst gesagt, dass es viele andere Wege gab. Sie musste bloß einen finden.
Das Treppenhaus war still, als sie es erneut betrat. Von den Vögeln war nichts zu hören, und von keiner der vielen Treppen unter und über ihr hallten Schritte zu ihr herüber. Es war ganz leer und einsam, und plötzlich packte sie der Gedanke, dass sie vielleicht völlig allein war in diesem sonderbaren Gebäude, dass es überhaupt niemanden mehr gab außer ihr selbst. Vielleicht würde sie für den Rest ihres Lebens durch Glasscheiben starren müssen.
Nachdem Miriam die lange, schmale Treppe erklommen hatte und wieder bei der schwebenden Steinplattform angelangt war, entschied sie sich aus dem Bauch heraus für eine der vier übrigen Treppen, die von hier aus in die Tiefe führten – nicht für die breiteste und einladendste, denn diese kam ihr wie eine schlecht getarnte Falle vor, aber doch für eine der weniger gefährlich wirkenden. Die Treppe war mit dunkelgrüner Farbe bemalt, und erst als sie schon einige Stufen genommen hatte, erkannte Miriam am Klang ihrer Schritte, dass es sich um eine Holztreppe handeln musste. Sie drängte die heraneilenden Bilder von morschem Holz und splitternden Brettern zur Seite und konzentrierte sich auf den Abstieg. Von der Plattform aus hatte die Treppe wie eine der kürzesten gewirkt, aber nun zog sie sich lange hin, wechselte mehrmals in rechtwinkligen Abbiegungen die Richtung und führte weiter und weiter in die Dunkelheit hinab. Schließlich aber war Miriam wieder an einer Tür angelangt.
Passt besser auf, dass Ihr nicht in etwas hinein stolpert.
Sie hatte das Gefühl, dass alles hinter diesen Türen liegen konnte. Aber wenn es wirklich gefährlich war, dann hätte sie Laurin sicher nicht alleine herumlaufen lassen. Oder?
Einen Moment lang stand sie unschlüssig auf dem steinernen Vorsprung, aber schließlich begann ihre eigene Furchtsamkeit sie zu ärgern. Sie mochte ihre Runensteine, die wohl im Teleport verloren gegangen oder ihr vielleicht auch abgenommen worden waren, nicht dabei haben, aber sie war noch immer eine Magierin. Wieso also hatte sie solche Angst vor einem Ort der Magie?
Sie fasste den Knauf, drehte ihn einmal nach links und zog die Tür auf. Der leere Raum, der dahinter lag, war nicht besonders groß und die Decke ungewöhnlich niedrig, doch als Miriam durch das Glas der gegenüberliegenden Wand blickte, fühlte sie die Gewissheit einer unermesslichen Weite. Draußen, hinter der Scheibe, wuchs ein dichtes, hohes Getreide, dessen Ähren auf den ersten Blick denen des Weizens ähnelten, der auch auf Khorinis angebaut wurde, aber ungleich größer und von einem strahlenden Gelb waren. Nach unten hin wurden die Halme zudem dicker als es Miriam vom Weizen her kannte, und nahmen eine bräunliche Farbe an, sodass sie im Boden steckten wie kleine Baumstämme. Genau in der Mitte des Fensterausschnitts befand sich inmitten der hohen Wand aus Gräsern ein enger Pfad im Getreidefeld, und Miriam konnte entlang dieses Weges bis an den Horizont blicken, wo sich ein leuchtend roter Hügel erhob. Sie fragte sich, was es wohl war, das auf diesem Hügel angebaut wurde, aber es war zu weit entfernt, um etwas erkennen zu können.
Langsam trat sie näher und fühlte, wie es ihr warm wurde unter ihrem weißen Kleid. Sie konnte nicht sagen, ob es tatsächlich wärmer war in diesem Raum, oder ob das gleißend helle Sonnenlicht, das aus dem Land jenseits des Glases zu ihr herein strahlte, sie bloß glauben ließ, dass es heiß sein musste. Aus den Augenwinkeln nahm sie die Türen wahr, sie zu beiden Seiten aus dem Raum heraus führten, aber als sie gerade überlegte, ob sie sich für eine von beiden entscheiden sollte, kam für einen winzigen Moment Bewegung in das Getreidefeld. Halme zuckten, Gräser wogten, und eine dunkle, schattenhafte Gestalt huschte einen Wimpernschlag lang durch das Dickicht.
Miriam kniff die Augen zusammen, starrte auf die Stelle, an der sie den Schemen gesehen hatte, aber nun war wieder alles ruhig und unauffällig. Dennoch: Sie war sich ganz sicher, jemanden gesehen zu haben. Es war eine menschliche Gestalt gewesen, die nun dort draußen im Feld kauern musste. Sie trat näher, suchte die Halme und Ähren mit den Augen ab, lauerte auf jede kleine Bewegung. Aber nicht einmal ein sanfter Wind wehte nun über das Feld, und dieser schattenhafte Mensch, den sie gesehen hatte, wagte sich nicht aus ihrem Versteck. Vielleicht war er weiter gegangen, schlug sich durch das Getreide hindurch bis zu dem leuchtenden roten Hügel in der Ferne. Vielleicht musste sie ihm folgen. Es war ja schon ein Weg für sie vorbereitet, und alles was sie tun musste, war ihn zu beschreiten.
Sie tat den ersten Schritt, dann den zweiten, und beim dritten war sie schon mitten zwischen den Ähren. Sie wandte den Kopf, und da war kein Glas mehr und kein Raum, nur noch Getreide zu allen Seiten, wohin das Auge schaute, und als sie sich umdrehte, sah sie den Pfad, wie er sich auch in die andere Richtung bis in die Unendlichkeit erstreckte.
Ein Rascheln schreckte sie auf, und sie fuhr herum. Da war es wieder, das fremde Wesen – nur wenige Schritte weit entfernt stand es vor ihr auf dem Weg, aber gerade als sie glaubte, dass sich die Konturen der Gestalt schärften, da huschte die Kreatur erneut zur Seite, mitten in das Getreide hinein. Miriam eilte ihm hinterher, schwitzend unter der brennenden Mittagssonne, die über ihr am dunkelblauen Himmel hing. Bald hatte sie die Stelle erreicht, an der die Gestalt verschwunden war – und erst jetzt erkannte Miriam, dass dort ein weiterer Pfad quer ins Feld hinein geschlagen war. Dieser jedoch war nicht so gerade wie der erste, sondern verlief kurvig und verschlungen, und nachdem sie ihm ein paar Schritte weit gefolgt war, eröffneten sich weitere Abzweigungen, während das Getreide um sie herum eine dunklere Farbe annahm. Ein Gefühl beschlich sie, dass sie zurück musste, dass sie den falschen Weg genommen hatte, aber als sie sich umwandte, sah sie sich mit einer Weggabelung konfrontiert und wusste nicht zu sagen, aus welcher der beiden Richtungen sie gekommen war. Hastig entschied sie sich für die linke und eilte voran, aber sie erkannte bald, dass sie sich falsch entschieden haben musste, denn dieser Weg verlief in Form einer Spirale und wurde dabei enger und enger, bis sie sich hindurch quetschen musste zwischen den gierig um sich greifenden Ähren, die sich in ihrem Kleid verhakten, die auf ihrer Haut kratzten und sie ins Fleisch stachen. Zurück, blitzte es in ihr auf, sie musste zurück, ein weiteres Mal, bloß nicht weiter in diese Richtung – aber sie konnte sich nicht mehr drehen oder wenden, sie steckte fest, und um sie herum raschelte es in den Halmen. Die schwarze Kreatur war wieder in der Nähe, sie zog langsam ihre Bahnen, umkreiste sie – und –
– packte sie an der Schulter –
– packte sie und riss sie heraus –
„Glotzt da mal lieber nicht zu lange rein.“
Verständnislos starrte sie in das füllige Gesicht des Mannes, der sie mit seinem Griff zurück in den Raum geholt hatte. Jenseits des Glases lag das Getreidefeld wieder ruhig und unbewegt, durchbrochen nur von einem einzigen langen Pfad, der zu einem leuchtend roten Hügel führte.
„Sonst landet Ihr am Ende noch auf der anderen Seite.“
Der Mann war in ein sauberes, weißes Gewand gekleidet, machte davon abgesehen aber einen ungepflegten Eindruck. Aus seinem dichten, strubbeligen Vollbart standen einzelne lange Haare wirr und verzwirbelt ab, und seine teigige Stirn machte den Eindruck, als könnte man ohne Weiteres genug Wachs für eine kleine Kerze davon abkratzen. Vor allem aber stank er nach billigem Bier, oder nach einem noch schlimmeren Gesöff.
„Was... war das gerade?“, stammelte Miriam. „Ich war in diesem Feld... ich meine, ich war mittendrin, und...“
„Ich sag’s ja, Ihr habt zu lange rein geglotzt.“ Der Mann klopfte ihr auf die Schulter und lächelte ein etwas schiefes Lächeln. „Aber ist ja nochmal gut gegangen, ja?“
„Was ist das hinter diesen Glasscheiben?“ Miriam drehte sich weg, bis sie mit dem Rücken zum Glas stand. Auf einen weiteren Ausflug in das Getreidefeld konnte sie gut verzichten.
„Eine andere Welt“, sagte er, als ob es gerade ums Mittagessen ginge. „Durch das Glas kann man reingucken, aber wenn man zu lange guckt... tja, dann landet man am Ende selber da drüben. Und zurückkommen, das wird dann schwierig.“
„Ist das schon häufig passiert? Dass Leute auf der anderen Seite gelandet sind?“
„Na klar“, bestätigte er. „Magier sind neugierig, das wisst Ihr doch sicher. Wenn’s was zu gucken gibt, dann wird auch geguckt. Falls Ihr mal auf die Etage mit dieser Aschenwelt kommen solltet... da sieht man Morten und Hanjo immer noch manchmal rumlaufen. Die halten ganz schön lange durch, dafür dass es da gar nix zu trinken gibt.“
„Also ist das alles, was man durch das Glas sieht... gar nicht wirklich dort draußen? Es sind bloß Einblicke in...“
„In andere Welten, sag ich doch. Passt auf, Ihr seid neu hier, und Laurin hat Euch anscheinend keine ordentliche Einweisung verpasst – wäre auch das erste Mal gewesen. Wieso kommt Ihr nicht einfach mit, und ich erzähle Euch ein bisschen was über den Turm hier?“
Miriam nickte. Zwar wurde ihr zunehmend übel von dem unangenehmen Geruch nach ranzigem Alkohol, den der Bärtige verströmte, aber wenigstens schien ihr dieser Mann Antworten zu geben, mit denen sie auch etwas anfangen konnte.
„Bin übrigens Bernhard“, stellte er sich vor und reichte ihr die Hand.
„Miriam“, sagte sie und drückte sie kurz. „Dieser Laurin ist für alle zuständig, die hier neu ankommen, oder?“
„Ja, leider ist das so.“ Bernhard öffnete die linke der beiden Türen, und sie traten in einen Flur ein, an dessen rechter Seite sich weiterhin das Getreidefeld hinter einer langen Glasscheibe erstreckte. Miriam versuchte, im Laufen nur die andere Wand anzuschauen, die aus ganz normalen Ziegelsteinen bestand, aber sie konnte nicht verhindern, dass sich aus dem Augenwinkel heraus immer wieder verhuschte Blicke in die gefährliche Richtung verirrten.
„Er will es unbedingt so“, fuhr Bernhard fort, während sie Seite an Seite durch den Korridor gingen, der mit mehreren hübschen Teppichen in bunten Mustern ausgelegt war. „Hat sich das oberste Stockwerk reserviert, um die Neuankömmlinge im Empfang zu nehmen. Und dann erzählt er ihnen nicht mal die wichtigen Sachen.“
Miriam fragte sich plötzlich, wohin sie eigentlich unterwegs waren, aber es schien ihr nicht von großer Bedeutung zu sein, solange sie endlich mehr darüber erfuhr, was an diesem Ort vor sich ging.
„Ist Laurin hier so etwas wie der Anführer?“
Bernhard lachte trocken auf. „Anführer, ach was. ’N Wichtigtuer ist das, unter uns gesagt. Kommt nicht damit klar, dass er keine Rolle mehr spielt.“
„Was wollt Ihr damit sagen, dass er keine Rolle mehr spielt?“, hakte Miriam verwundert nach. „Für was spielt er keine Rolle mehr?“
„Nicht für was – für wen“, korrigierte sie Bernhard. „Für den, der uns alle hergebracht hat. Für den wir das hier alles machen.“
Miriam horchte auf. Von so jemandem hatte Laurin überhaupt nichts gesagt.
„Wer ist das? Ein mächtiger Magier, nehme ich an? Oder ein... Herrscher?“
„Kein Mensch aus Fleisch und Blut.“ In Bernhards Stimme war bei diesen Worten ein neuer, ernsthafterer Ton geraten. „Manche hier nennen ihn einen Gott, aber ich weiß nicht, ob’s das wirklich auf den Punkt trifft. Mit Innos und den Brüdern hat er nichts am Hut, so viel steht mal fest.“
„Dann seid Ihr so etwas wie eine Kirche? Oder ein Kult?“
Sie bereute es sofort ein wenig, den letzten Satz noch angefügt zu haben. Wer ließ sich schon gerne einen Kultisten nennen? Bernhard allerdings schien sich nicht daran zu stören.
„Kann schon sein, dass wir irgendsowas sind“, nuschelte er schulterzuckend in seinen Bart. „Aber was ist schon so wichtig daran, ob’s nun ein Gott ist oder ein Geist aus der Unterwelt oder – ein Bewusstsein aus einer anderen Welt, oder was sie alles erzählen. Er hat uns alle hergebracht, und er hat uns tausend verschiedene Sachen gezeigt, an denen wir arbeiten können, die wir entdecken können und erschaffen können. Hat unserem Leben eine Richtung gegeben, oder einen Sinn, kann man so sagen. Meinem jedenfalls.“
„Was meint Ihr damit, er hat Euch hergebracht? Seid Ihr nicht auch über einen Teleporter gekommen?“ Miriam fand es schwer, sich Bernhard als Magier vorzustellen, der sich jahrelang so intensiv in die Glasmagie vertieft hatte, dass er ähnlich wie sie mithilfe der verborgenen Runen einen Weg hierher gefunden hatte. Aber sie kannte ihn erst seit ein paar Minuten und mahnte sich selbst dazu, ihn lieber nicht zu unterschätzen.
„Nee, ich bin mit dem Schiff gekommen.“ In der ersten Sekunde war sich Miriam unsicher, ob das womöglich eine süffisante Bemerkung gewesen war – vielleicht war es ja ganz selbstverständlich, dass hier jeder per Teleporter anreiste. Aber sie merkte rasch, dass er es offenbar ernst gemeint hatte.
„War damals auf ’ner Galeere von der königlichen Marine in den Gewässern hier unterwegs. Als Matrose, wisst schon. Sind vor den verfluchten Irrlicht-Inseln auf Grund gelaufen, und ich dachte schon, das war’s jetzt. Hier häng ich jetzt fest, gute Nacht. Aber im Turm haben sie mich aufgenommen, und auch ein paar von meinen Kollegen. Die meisten von denen sind schon wieder weg, aber ich bin geblieben.“
Miriam wartete auf eine Fortsetzung der Erklärung, aber es kam nichts mehr.
„Und Euer... Gott? Was hatte der nun damit zu tun?“
„Na, er hat mich hergebracht“, sagte Bernhard, als ob es sich um eine Selbstverständlichkeit handelte. „Wenn Ihr länger hier wärt, dann wüsstet Ihr, was ich meine. Die Leute begreifen’s nicht immer sofort, aber jeder, der ein bisschen länger bleibt, und der hier auch was zu suchen hat, der wurde von ihm hergeschickt. Er sorgt dafür, dass die richtigen Leute hier landen.“
Sie hatten das Ende des Korridors erreicht, und Bernhard öffnete die Tür in den nächsten Raum. Miriam rechnete bereits mit einem weiteren leeren Gewölbe oder einem weiteren nicht enden wollenden Flur, aber was sie hinter der Tür erwartete, war eine zwar große, aber überraschend gewöhnlich wirkende Bibliothek. Zwischen dutzenden vollgestellten Bücherregalen und allerlei Abstellschränkchen, auf denen sich die Pergamente stapelten, saßen mehrere in die Lektüre vertiefte Männer in weißen Gewändern an vereinzelten kleinen Tischen, auf den sie zumeist Unmengen an Lesematerial vor sich ausgebreitet hatten. Nur einer von ihnen, ein junger Mann mit rötlichen krausen Haaren, schien ihre Ankunft bemerkt zu haben und nickte ihnen zu, wobei Miriam vermutete, dass der Gruß in erster Linie Bernhard galt, der ihn leise murmelnd erwiderte.
Erst auf den zweiten Blick sah Miriam, dass sich am anderen Ende des Raumes, im Schatten des größten Regals, ein weiterer Tisch befand, an dem ebenfalls jemand saß. Es war ein kleiner Mann mit einem grauen Haarkranz und einem Gesicht, das vom Alter bräunlich und faltig geworden war. Er schaute genau in ihre Richtung, und nachdem er sie eine, zwei Sekunden lang reglos gemustert hatte, griff er nach etwas, das an einer Kette um seinen Hals hing und hielt es sich vor die Augen. Ein kleines, schwarzes Plättchen, das im warmen Licht der Fackeln und Kerzen leicht glänzte.
„Was macht er da?“, murmelte Miriam, die es äußerst unbehaglich fand, so offen angestarrt zu werden.
„Das ist Sigurd“, sagte Bernhard und wirkte dabei plötzlich angespannt. „Er beobachtet Euch durch das Monokel.“
„Durch das...?“ Und dann begriff sie endlich. Schwarzes Glas. Dieser Mann betrachtete sie durch eine runde Scheibe aus schwarzem Glas.
„Es hatte mal zwei Gläser, und man konnte durch beide gleichzeitig gucken. Aber eines ist uns verloren gegangen. Jetzt ist nur noch dieses übrig, und nur einer darf es tragen.“
Sigurd ließ das Monokel wieder sinken und schaute noch einen langen Moment lang mit unbewegter Miene zu ihnen herüber. Dann neigte er den Kopf hinab und schenkte ihnen keine Beachtung mehr.
„Und er ist dieser Jemand?“, fragte Miriam mit weiterhin gedämpfter Stimme. „Wieso ausgerechnet er?“
„Das entscheiden nicht wir, sondern... er. Unser, naja, nennt ihn Gott, wenn Ihr wollt. Vorher hat Laurin das Monokel getragen, aber vor ein paar Monaten musste er es weiterreichen. Seitdem trägt es Sigurd.“
Bernhard führte sie zu einem leeren Tisch, schob einen zweiten Stuhl heran und bedeutete ihr, sich neben ihn zu setzen.
Miriam nahm Platz und stützte das Kinn auf die rechte Hand. „Welchen Zweck hat es?“
„Es schickt seine Bilder... Zeichen... Hinweise...“, flüsterte Bernhard, „an denjenigen, der’s trägt. Das Monokel sagt uns, was wir tun sollen. Manchmal sagt es auch gar nichts, ’ne ganze Weile lang, aber manchmal eine Menge.“
„Euer Gott zeigt Euch Bilder auf dem Glas?“, vergewisserte sich Miriam. Es kam ihr bekannt vor, und sie glaubte nicht an einen Zufall.
„Ja, aber nur einer darf sie sehen. Und gerade ist das eben Sigurd. Ich durfte noch nie reingucken, wenn Ihr Euch das fragt. Aber ist schon in Ordnung, mir wär das sowieso zu viel. Wichtig ist nur, dass Ihr Sigurd nicht stört, ja? Ist die wichtigste Regel hier: Wer das Monokel trägt, darf nicht gestört werden.“
„Hm“, machte Miriam. Das war also der Ort, an dem all die Schriften entstanden waren, die sie zehn Jahre lang in Atem gehalten hatten? Der ihren einzigen Lebensinhalt hervorgebracht hatte, seit dem Tag, an dem Ruben in Merdarions Haus – in ihrem gemeinsamen Haus – das alte Tagebuch entdeckt hatte – dieses alte, zerfledderte Ding, in dem sie zum ersten Mal etwas von der Kugel und ihren Kräften gelesen hatte. Trotz all der faszinierenden Merkwürdigkeiten um sie herum machte sich ein Gefühl der Enttäuschung in ihr breit. Sie hatte geglaubt, eine vergessene, geheime Errungenschaft aus alten Zeiten ins Leben zurückzuholen – dabei gab es nach wie vor einen ganzen Turm voller Leute, die diese Magie betrieben. Leute, für die ihre Kugel nur eine Kuriosität war, an der sie längst das Interesse verloren hatten, weil sie ganz andere, aufregendere Dinge kannten, die sie beschäftigten. Zehn Jahre Forschung... und nun saß sie an einem Tisch mit einem stinkenden Matrosen, für den alles, was sie sich mühsam erarbeitet hatte, längst ein alter Hut sein musste.
Sie sah auf, um das Gespräch mit Bernhard fortzusetzen, bemerkte aber sofort, dass etwas nicht stimmte. Bernhards Lippen zitterten zwischen all den Barthaaren, und sein Blick war erstarrt vor Überraschung, oder vielleicht auch vor Ehrfurcht.
Miriam brauchte eine Sekunde, bis sie begriff, dass jemand an den Tisch herangetreten war. Sigurds Miene war steinern, seine Lippen eine einzige strenge Linie. In seinen Augen aber hatten sich Tränen gebildet.
„Nehmt es“, sagte er, und es war ihm anzusehen, dass ihm jedes dieser Worte eine Qual war. „Ihr sollt es tragen.“
In seiner ausgestreckten Hand ruhte das Monokel.
▥
Ein letztes Mal fuhr sein kleiner Finger über den kalten Stein, fügte dem einfachen Symbol eine abschließende schmale Linie hinzu. Dann war er zufrieden. Er hatte sich nicht ganz entscheiden können, ob er einen stilisierten Feuerball oder eine Sonne hatte malen wollen, sodass schließlich irgendetwas dazwischen herausgekommen war. Aber so war es genau richtig, fand er. Bei echten Runen ließ sich schließlich auch selten einmal sagen, was genau sie eigentlich darstellen sollten. In jedem Fall sah es lodernd aus, flammend... feurig. Eine würdige Rune des Feuers für einen würdigen Magier des Feuers.
Rubens Schmunzeln wurde zu einem Husten, und er legte den bemalten Runenstein rasch auf den Dielenbrettern ab, um sich die Hand vor den Mund zu halten. Das fehlte ihm gerade noch, dass er sein Werk nach gelungener Fälschung mit dem widerlichen Zeug vollsprühte, das in seinem Körper brodelte. Er zog eines seiner Tücher unter dem Deckenbündel hervor, das ihm als Kopfkissen diente, und suchte vergeblich nach einer sauberen Stelle. Schließlich wischte er seine Hand an einer Ecke des Tuches ab, an der wenigstens noch ein kleines Bisschen Weiß zu sehen war. Wenn er doch bloß eine Gelegenheit finden könnte, sie zu waschen, oder an ein paar frische Tücher zu kommen... aber an beides war natürlich nicht zu denken. Und wahrscheinlich würde es ohnehin in ein oder zwei Tagen nicht mehr nötig sein. Ruben gab sich keinen Illusionen hin: Diese Fälschung war mit Sicherheit seine letzte gewesen.
Denk an das, was du in der Kugel gesehen hast, sagte er sich, zum hundertsten, zum tausendsten Mal. Aber mit jedem Mal war der Satz ein bisschen schaler geworden, und nun war er nur noch ein hohles Ritual, das ihn in seinen letzten Tagen begleiten würde.
Die Kugel war zerbrochen und konnte ihm nicht mehr helfen – und vielleicht hatte sie das nie gewollt. Wer wusste schon, ob sie wirklich die Zukunft zeigte? Hätte er sich auf sich selbst verlassen und sie einfach mitgenommen... wäre er einfach auf Varyans Schiff gegangen und zurück nach Vengard gefahren... hätte er die Kugel einfach Pete gegeben... wer wusste schon zu sagen, ob er dann nicht längst geheilt wäre. Geheilt oder tot, und beides schien ihm besser als sich quälend langsam in schwarzen Schleim aufzulösen.
Vielleicht hatte er das Zeug dazu gehabt. Wenn er gewollt hätte, dann hätte er Elias austricksen können. Er hatte schon dutzende riskante Pläne erdacht, und sie hatten alle funktioniert. Aber kein Plan konnte funktionieren, der gar nicht erst in die Tat umgesetzt wurde.
Bring diese Scheißmagier um.
Ruben hatte viel Zeit gehabt, um nachzudenken, und mittlerweile war er sich fast sicher, dass es Pete selbst gewesen war, der ihn mit den letzten Worten seines Auftrags von der Umsetzung des Plans abgehalten hatte. Ruben hatte gestohlen und betrogen, ohne dass ihn jemals ein schlechtes Gewissen um den Schlaf gebracht hatte, aber töten wollte er nicht. Schon gar nicht Elias. Er hatte nie getötet und er würde nie töten. Niemals.
Er schämte sich bei diesem Gedanken, aber vielleicht war ja doch etwas Wahres daran. Ruben hatte für sich beschlossen, bei dieser Wahrheit zu bleiben. Wenn er schon zugrunde ging, dann wenigstens mit einem freundlichen Bild von sich selbst.
Knarzende Schritte waren auf der Treppe zu hören. Ruben schob das Schälchen mit der hellrötlichen Farbe rasch zurück unter die lose Planke und steckte den Runenstein in eine Tasche seines Mantels. Er wusste, dass die Farbe schnell trocknete, und hoffte, dass die paar Minuten gereicht hatten.
„Meister Ruben. Ich habe gehofft, dass Ihr schon wach seid.“
Es war Matilda, die zu ihm heruntergekommen war. Natürlich. Elias kam immer nur am späten Abend in den Lagerraum, wenn Ruben ihn ablöste. Dann legte er sich schweigend in seine Ecke und starrte nach oben, bis Ruben das Unterdeck verlassen hatte.
„Hallo, Matilda“, grüßte er die junge Frau. „Na, wie sieht’s aus, da oben?“
„Um ehrlich zu sein“, sagte sie mit leiser Stimme, die im Knarren des Schiffsbauches fast unterging, „ich mache mir Sorgen. Meister Elias hat die Kajüte seit Stunden nicht verlassen. Ich versuche, den Kurs zu halten, aber es ist schon den ganzen Tag über neblig.“
„Ich werde mir das gleich mal anschauen“, versprach Ruben, obwohl er von Navigation genauso wenig Ahnung hatte wie Matilda. Er konnte auch nichts weiter tun als auf den Kompass zu schauen, um sicherzustellen, dass sie noch immer in die gleiche östliche und leicht nördliche Richtung fuhren, die sie von Irdorath aus eingeschlagen hatten.
„Danke“, sagte Matilda mit gesenktem Blick. Anfangs hatte es Ruben ganz fuchsig gemacht, dass sie ihm nie in die Augen schaute, aber nun war es ihm sehr recht so. Er konnte die Rötungen in seinem Gesicht auf die raue Seeluft schieben, wenn ihn jemand darauf ansprach, aber noch lieber war es ihm, wenn einfach niemand hinsah. Bei Elias musste er sich in dieser Hinsicht natürlich ohnehin keine Sorgen machen.
Sie blieb einen Moment lang unschlüssig auf der untersten Treppenstufe stehen.
„Da ist noch etwas, Meister Ruben. Ich vermisse seit einigen Tagen das Puderschälchen für Fräulein Klarissa. Ich... habe vermutet, dass Meister Elias es mit in den Lagerraum genommen und hier vergessen haben könnte, aber er... er sagt...“
„Verstehe schon“, brummte Ruben. „Er sagt natürlich, dass es eine Unverschämtheit ist, ihm so etwas zu unterstellen und so weiter und so fort.“
Matilda schwieg ein etwas unbehagliches Schweigen.
„Soll ich einmal nachsehen, ob es hier irgendwo steht?“, bot Ruben an, um sie zu erlösen. „Es kann ja eigentlich nicht verschwunden sein, oder? Wenn es nicht gerade jemand über Bord geworfen hat.“
„Das wäre sehr freundlich von Euch, Meister Ruben“, sagte Matilda. „Meister Elias vermisst die natürliche Rosigkeit ihrer Wangen.“
„Ich werde gleich einmal nachschauen, versprochen.“
„Dankesehr.“
Matilda deutete eine Art Verbeugung an, wandte sich ab und eilte wieder zurück auf das Oberdeck. Ruben fragte sich, wie lange sie mit sich gerungen hatte, bevor sie den Besuch bei ihm gewagt hatte. Leider würde er ihr das Puderschälchen nicht zurückgeben können, allein schon weil er den Inhalt längst mit ein wenig Wasser zu einer klebrigen Masse verdickt hatte. Er bewunderte sich selbst ein wenig für den guten Einfall, musste sich aber auch eingestehen, dass ihm eine große Portion Glück dabei geholfen hatte, die Vergiftung während der mittlerweile schon knapp zehn Tagen auf See geheim zu halten. Der schwarze Fleck hatte sich nicht weiter großflächig über die Haut ausgebreitet, sondern war zum überwiegenden Teil ins Fleisch gefahren. Er hatte es gespürt, noch bevor es von der linken Seite her in den unteren Teil seines Mundes vorgedrungen war und das Zahnfleisch unter der Zunge schwarz gefärbt hatte. Bloß einzelne Äderchen hatten die dunkle Farbe der Vergiftung angenommen und zogen sich über seine linke Wange. Am Tag wäre die Paste aus Puder und Wasser, mit der er die schwarzen Adern verbarg, sicherlich aufgefallen, aber er hatte vom zweiten Tag der Reise an die Nachtschicht übernommen. Und zumindest dieser Teil war kein Glück gewesen, sondern gute Vorausplanung.
Wäre er doch bloß in der Lage gewesen, sich über all das angemessen zu freuen. So aber fühlte es sich nur wie das Hinauszögern des Unausweichlichen an. Der schwarze Fleck, der sich an der linken Seite seines Halses bis unter die Schulter hin zum Herzen zog, hatte von Tag zu Tag eine weichere und zunehmend klebrige Konsistenz angenommen. Er hatte den Schal schon seit vorgestern nicht mehr abgenommen, aber er konnte sich ausmalen, wie es darunter jetzt aussehen musste. Vermutlich konnte ihn nicht einmal mehr das Gegenmittel retten, das ihm Pete versprochen hatte, geschweige denn das Trugbild der verfluchten zerschlagenen Kugel. In manchen Momenten dachte er darüber nach, Elias einfach alles zu erzählen, wenigstens einmal noch ehrlich mit ihm zu sein kurz vor dem Ende. Was hatte er schon noch zu verlieren? Aber Elias war nur mit sich selbst beschäftigt, und es war ohnehin nicht Rubens Art, eine Täuschung aufzugeben, bevor sie ganz und gar vergebens war.
Er musste erneut husten, aber diesmal trat keine Beruhigung ein, als der Hustenreiz verklungen war. Etwas Größeres drückte von unten auf seinen Hals, presste sich durch die Speiseröhre hinauf und ließ ihn würgen.
Ruben sprang auf, hielt sich die Hand vor den Mund und rannte zur Treppe. Hastig spurtete er die Stufen hinauf bis auf das Oberdeck, wo ihn der kühle Abendnebel erwartete. Er stolperte hinüber zur Reling, gleich neben die Stelle, an der sie ein großes Loch notdürftig mit ein paar Brettern zugenagelt hatten, und übergab sich in das Meereswasser. Schwarze, gallige Schleimklumpen tropften in das Wasser und trieben wie Pocken auf der Oberfläche, und gerade als Ruben glaubte, es sei vorbei, da brach es noch einmal aus ihm hervor als dunkle, beinahe flüssige Masse. Er wusste nicht, was es war, das warm und stinkend aus seinem Mund quoll. Er hatte seit gestern morgen nichts mehr gegessen. Waren es Teile seines eigenen Körpers, die die Vergiftung verdorben hatte?
Er spuckte die letzten Reste hinab und wischte sich den Mund mit dem Ärmel seines Mantels ab, weil er nichts anderes hatte. Es war widerlich, dachte er, aber zumindest sah man kaum einen Unterschied. Der Mantel war selbst dunkel genug.
„Meister Ruben?“
Es überraschte ihn nicht, dass Matilda seinen unfreiwilligen Ausflug an die Reling beobachtet hatte. Zum Glück war das alles sehr unverdächtig, solange niemand sah, was genau er da eigentlich erbrach. Und wer wollte bei so etwas schon genau hinschauen?
„Mach dir keine Sorgen, Matilda“, rief er zurück. „Die Seekrankheit werde ich wohl so schnell nicht mehr los, aber ich werde es schon überstehen.“
Aber dann, als er den Kopf hob und sich von der Reling lösen wollte, sah er, was Matilda wirklich gemeint hatte.
Im hellgrauen Nebel war noch immer nicht viel zu erkennen, aber die Umrisse einer Insel waren deutlich auszumachen. Nicht einer Insel, korrigierte sich Ruben in Gedanken: zweier Inseln.
Zwei Inseln, verbunden durch eine natürliche Brücke aus Stein.
Wenn es Irrlichter gab auf den Irrlicht-Inseln, dann leuchteten sie nicht in dieser Nacht. Aus der Ferne war nichts zu sehen, das an die Legenden erinnerte, von denen Varyan berichtete. Keine verlassenen Schiffe, keine Wahnsinnigen auf dem Fels. Und keine Irrlichter. Spätestens als sich der Nebel legte und die Inseln am frühen Morgen vom hellen Sonnenlicht aller Unheimlichkeit beraubt wurden, war es offensichtlich: Zumindest von dieser Seite aus gesehen waren es bloß zwei Inseln, die auf kuriose Weise miteinander verbunden waren.
Schon am Abend hatten sie geglaubt, in einer größeren Silhouette jenseits der Irrlicht-Inseln das eigentliche Ziel ihrer Reise auszumachen, aber Elias hatte in Dunkelheit und Nebel nicht zwischen den Inseln navigieren wollen und die Segel eingeholt. Erst am Morgen setzten sie ihre Reise fort, fuhren einmal um die Irrlicht-Inseln herum und waren sich schnell einig, dass das dahinterliegende Eiland, welches aus nicht viel mehr bestand als einem großen grünen Hügel und einem sandigen Küstenstreifen, unzweifelhaft der Ort sein musste, den sie beide in der Kugel gesehen hatten.
Ruben war in einer sonderbaren Stimmung an diesem Morgen. Es war angenehm, mit Elias einmal wieder mehr als nur ein paar knappe Worte zu wechseln, und natürlich hatte der Anblick dieses grünen Hügels, der aus dem Meer in einen wolkenlosen Himmel hineinragte, von Neuem eine vage, konturenlose Hoffnung in ihm geweckt. Die Kugel hatte nicht völlig gelogen, wenn zumindest das Wetter stimmte. Aber konnte er wirklich darauf hoffen, plötzlich geheilt zu sein, wenn er diesen Hügel bestieg? Er hatte viel darüber nachgegrübelt, was Teresa gesagt hatte... dass der unsichtbare Turm auf diesem Hügel stand, und dass sie das Unheil kannten, das von ihm ausging. Aber selbst wenn sie recht hatte, so war der unsichtbare Turm doch zumindest ein Hort magischer Kräfte. Kräfte, von denen er kaum etwas verstand. Vielleicht, ganz vielleicht...
Aber dann sah er hinauf auf den Hügel, und die Vorstellung, dass sich auf dieser harmlosen, idyllischen Kuppe irgendetwas von Bedeutung befinden sollte, kam ihm wieder völlig absurd vor. Natürlich, man nannte diesen Turm den unsichtbaren Turm, aber konnte das wirklich wörtlich gemeint sein?
Es war beinahe Mittag, als sie den Strand der Insel erreichten. Ruben wurde schwindelig im prallen Sonnenlicht, dem er während der Reise bislang immer aus dem Weg gegangen war, und es begann vor seinen Augen zu flimmern. Während Elias sich in der Kajüte mit Matilda besprach und sich von Klarissa verabschiedete, spazierte Ruben nervös vor den erstarrten Menschen auf und ab und versuchte sich abzulenken, indem er die Mienen in ihren gefrorenen Gesichtern studierte. Jedes Mal, wenn er in die Richtung dieser Leute schaute, war da auch die leise Befürchtung, Teresa könnte plötzlich wieder zwischen ihnen auftauchen, aber sie war fort seit der Sekunde, in der Elias seinen verhängnisvollen Zauber gewirkt hatte. Zunächst hatte er ständig mit ihrer Rückkehr gerechnet, aber mit jedem Tag war der Verdacht stärker geworden, dass sie vielleicht doch tot war, ertrunken und angespült an der Küste Irdoraths. Er wollte nicht darüber nachdenken, was das bedeutete. Nicht so kurz vor seinem Tod. Welchen Zweck hatte es schon?
Ruben schlenderte zur Reling hinüber und prüfte zum zehnten oder elften Mal an diesem Morgen, ob in seinem Gesicht etwas Verdächtiges zu bemerken war. Aber in den Wellen, die auf den Strand niedergingen, war kaum etwas zu erkennen. Es war längst zu einer seiner liebsten Beschäftigungen an Bord des kleinen Segelschiffs geworden, sich leidenschaftlich darüber zu ärgern, dass er Miriams Handspiegel nicht eingesteckt und auf das Schiff geschmuggelt hatte.
Als er sich wieder von der Reling entfernte, sah ihm Elias entgegen, der gerade unter dem zweckmäßig reparierten Dach der Kajüte ins Freie getreten war. Er nickte ihm zu mit entschlossenem Blick, aber Ruben hatte das Gefühl, dass auch etwas anderes in seinem Ausdruck lag. Ruben sagte sich, dass er unmöglich etwas bemerkt haben konnte aus dieser Entfernung. Matilda hatte schließlich auch nie etwas bemerkt, und die hatte zumindest sehr häufig nah an ihm vorbei gesehen. Er würde einfach vorangehen, damit Elias nicht jedes Mal in sein Gesicht sehen konnte, indem er sich einfach zu ihm umdrehte. Er würde dafür sorgen, dass er die meiste Zeit über nur seinen Hinterkopf zu sehen bekam, dann würde schon alles glatt laufen. Er musste nur so lange durchhalten, bis sie oben auf der Hügelkuppe angekommen waren. So lange bis... irgendetwas geschehen würde.
Während er auf Elias zuging, der gerade einen Teil der Reling nach innen einklappte, sodass sich ein bequemer Ausstieg aus dem Schiff ergab, tastete Ruben unruhig mit der Zunge in der faserigen Ecke unten links in seiner Mundhöhle herum. Er hasste den bitteren Geschmack des Gifts, den das verdorbene Fleisch verströmte, aber er konnte auch nicht anders, als ihn ständig mit der Zungenspitze zu erschmecken. Erst recht nicht wenn er angespannt war – und obwohl er in jeder einzelnen Sekunde der letzten zehn Tage angespannt gewesen war, war es nie so schlimm gewesen wie in diesen entscheidenden Augenblicken am Ende der Reise.
Nun war er Elias ganz nah, aber noch sah er nicht in seine Richtung. Als sich der Magier noch einmal nach Matilda umdrehte, quetschte sich Ruben rasch an ihm vorbei und sprang durch die Öffnung in der Reling hinab in den feuchten Sand. Es war ganz gewöhnlicher Sand, gelb und von vereinzelten dunklen Steinchen durchzogen. Kein weißer Sand, wie sie ihn in der Kugel gesehen hatten – Quarz, wie Teresa behauptet hatte. Aber noch waren sie nicht auf der Hügelkuppe angekommen, und vom Schiff aus hatten sie nicht sehen können, ob dort oben etwas ausgestreut war.
Ruben stapfte durch den Sand, bis er den trockenen Bereich des Strandes erreicht hatte. Er hörte, wie Elias hinter ihm vom Schiff sprang, und dann hörte er ihn sagen: „Ist dir nicht warm, Ruben?“
Er antwortete nicht sofort, ging vorher noch ein paar Schritte weiter und fühlte die ersten Grashalme unter den Sohlen seiner zerschlissenen Lederschuhe.
„Wieso?“, gab er dann zurück, ohne sich umzudrehen.
„Die Sonne scheint vom Himmel, und du trägst noch immer diesen Schal.“
„Du trägst ja auch noch immer deine Robe.“
„So warm ist sie nicht. Und ich trage ganz sicher keinen Schal dazu.“
Ruben schwieg, und auch Elias sagte nichts weiter. Sie waren nun am Fuße des Hügels angekommen. Vom Schiff aus hatte die Steigung gar nicht so steil gewirkt, aber Ruben spürte rasch, dass nun jeder Schritt ein bisschen anstrengender war als der vorige. Er hoffte, dass es anstrengend genug war, um Elias vom Reden abzuhalten – und am besten auch vom Denken. Obwohl Elias jedoch weiterhin schwieg, schien ihm der Aufstieg weniger Mühe zu bereiten als ihm selbst. Natürlich, dachte Ruben. Er hatte schließlich auch keinen Körper, der gerade in der lebendigen Verwesung begriffen war, und seine letzte Mahlzeit lag auch keine zwei Tage zurück. Mehrmals war Elias kurz davor, ihn zu überholen, aber immer, wenn er plötzlich neben ihm auftauchte, biss Ruben die Zähne zusammen und beschleunigte seinen Schritt, zwang seine schmerzenden Beine dazu, ihn vorne zu halten. Anfangs achtete er noch darauf, sein Gesicht ein wenig zur Seite zu drehen, so dass Elias von hinten möglichst wenig davon erkennen konnte, aber bald verwirrten ihm Schwindel und Erschöpfung die Gedanken, und er war zu sehr damit beschäftigt, nicht den Halt zu verlieren, um noch daran zu denken.
Der Aufstieg schien Stunden zu dauern, aber die Sonne am Himmel veränderte ihre Position nicht. Es war noch immer Mittag, und keine Wolke war aufgezogen. Mit zittrigen Händen wischte sich Ruben wieder und wieder den Schweiß von der Stirn, damit er nicht auf die Wange rinnen und seine Tarnung vernichten konnte. Aber bald war der Schweiß schneller als seine erlahmende Hand, und er ließ ihn fließen, konnte sich nur noch Schritt für Schritt vorwärts schleppen. Das Rauschen der Wellen wurde schwächer, und eine Stille nahm ihren Platz ein, in der bloß sein eigenes Keuchen und Elias’ Atmen hinter ihm zu hören waren. Und schließlich, als die flackernden weißen Flecken vor Rubens Augen die Wirklichkeit längst überstrahlt hatten, waren sie angekommen.
Es war, wie er es in der Kugel gesehen hatte, nur größer. Viel größer. Die flache Hügelkuppe nahm eine durchaus beachtliche Fläche ein, und der Platz aus weißem Sand, der in der Kugel noch wenig beeindruckend ausgesehen hatte, bildete einen Kreis von gewaltigem Umfang. Langsam ging Ruben darauf zu, setzte die ersten Schritte auf den Sand, und wartete schwer atmend darauf, dass etwas geschah.
„Ruben“, schnaufte Elias hinter ihm. „Ruben, schau mich an.“
Es geschah nichts. Der Platz war nur ein großer Platz aus weißem Sand. Nichts weiter.
Ruben fühlte nichts als Schmerz und Erschöpfung. Keine Magie, keine Heilung. Er blieb stehen und beobachtete die weißen Flecken vor seinen Augen dabei, wie sie mit dem Weiß des Sandes verschmolzen.
„Ruben, du verheimlichst mir etwas.“
Er hörte Elias’ knirschende Schritte im Sand. Jetzt hatte er ihn also erreicht. Den Zeitpunkt, an dem alle Täuschung vergebens war.
„Wieso schaust du mir nicht ins Gesicht, Ruben? Wieso willst du deinen Schal nicht ablegen?“
Elias war gleich hinter ihm zum Stehen gekommen. Er fühlte seinen Atem im Nacken.
Als Ruben den Blick aus dem Weiß des Sandes löste und voran blickte, da sah er sich selbst.
Sich selbst, und hinter sich Elias, wie sie beide auf einem Platz aus weißem Sand standen.
„Was – ist – unter deinem Schal –“
Eine Spiegelung.
Er sah das Bild aus der Kugel im Spiegel einer unsichtbaren Glasscheibe. Er sah sein eigenes, verschwommenes Gesicht, er sah Elias, der über seine Schulter schaute. Der nach seinem Schal griff – der den Schal packte, an der rechten Seite packte, und ihn herunterzog.
Saubere, blasse Haut.
Eine Spiegelung.
Es war beinahe erleichternd, als die letzte Hoffnung im zersetzenden Weiß des Sandes verging.
Die Kugel hatte nicht gelogen. Sie hatte ihm ein Bild aus der Zukunft gezeigt. Aber sie hatte das richtige Bild gewählt, um ihn zu täuschen, mit der einfachsten aller Täuschungen.
Unsichtbar, fast unsichtbar, glitt eine Glasscheibe lautlos zur Seite, und eine Frau im weißen Kleid trat hervor.
Hinter der Tür war ein Palast.
Zuvor hatte Ruben geglaubt, dass die Verwesung sein Gehirn erreicht hatte, dass sie seinen Verstand zersetzte und ihn im Sterben letzte verzweifelte Bilder des Wahnsinns produzieren ließ. Das war gewesen, als er die Treppen gesehen hatte. Schwebende Treppen ohne Halt, in der Luft verankerte Plattformen aus massivem Stein, und ein niemals endendes Oben, das in rot glimmender Finsternis verging. Nun, da er hinter die Tür getreten war, an die sie ihn geführt hatte, glaubte er beinahe, bereits gestorben zu sein. Der Raum erinnerte ihn an das Jenseits, von dem die Leute aus Varant manchmal sprachen, wenn sie in Plauderlaune waren: Prachtvolle Marmorsäulen und in allen Farben blühende Blumen, die von hoch schwebenden Schalen hinabhingen. Drei Tische aus funkelndem Kristall, zwei Sitzecken aus bunten Kissen und Decken. Und in der Mitte ein sachte sprudelnder Springbrunnen in der Form eines bronzefarbenen Fisches. Die gegenüberliegende Wand war von großen weißen Vorhängen verdeckt, aber durch die Spalten zwischen den Vorhängen strahlte ein kraftvolles, rötliches Licht zu ihnen hinein und tauchte den Raum in eine warme Stimmung. Eine halb geöffnete Tür führte in einen Nebenraum, und durch die Öffnung war ein Teil eines großen Himmelbettes zu erkennen, von dem verschiedene bunte Stoffe hinab hingen.
Miriam schloss die Tür hinter ihnen, durch die sie gekommen waren, und dann, erst dann, nahm sie Elias in den Arm und drückte ihn an sich. Ruben hatte bereits ein paar Schritte auf den Springbrunnen zugemacht, aber nun kam Miriam ihm nach, fasste ihn an der Schulter – zum Glück an der rechten Schulter, dachte Ruben – und schenkte auch ihm eine Umarmung. Es war eine lange Umarmung, und keiner der beiden sagte etwas, solange sie andauerte. Ruben wurde sie etwas unangenehm, da er den Verdacht hatte, dass seine Wunde einen schrecklichen Gestank verströmte, und er auch aus dem Mund fürchterlich miefen musste, aber wenn dem so war, dann ließ sich Miriam nichts anmerken. Sie fasste ihn bei den Händen und lächelte ihn an.
„Ich wusste, dass du kommen würdest“, sagte sie und strich mit den Fingern über seinen Handrücken. „Nach Irdorath, meine ich. Und nun bist du mir sogar hierher gefolgt.“
„Wir haben uns Sorgen um dich gemacht“, sagte Ruben. „Wir dachten schon, du liegst in irgendeinem Abgrund unter dem Tempel begraben.“
„Wenn ich gekonnt hätte, dann hätte ich euch eine Nachricht hinterlassen. Aber ich wusste ja selbst nicht, wie mir geschah.“
Erst jetzt fiel ihm auf, dass unter dem dick gepolsterten Kragen ihres Kleids etwas Glänzendes auf ihrer Haut lag. Eine Kette, die fast vollständig unter dem weißen Stoff verschwand.
„Ruben.“ Sie löste die Berührung und blickte ihn erstaunt an. „Was ist denn mit deiner Wange?“
„Ach, die Haut hat sich nur ein bisschen entzündet. Ich glaube, die raue Seeluft hat mir nicht gut getan.“
„Eigentlich war es ein sehr angenehmes Klima in den letzten Tagen“, ging Elias mit scharfem Tonfall dazwischen. „Aber das hat dich ja auch nicht davon abgehalten, weiterhin die ganze Zeit diesen Schal zu tragen.“
„Ich bin seekrank“, verteidigte sich Ruben und bedachte den Magier mit einem Blick, in den er so viel von dem Gift legte, das sich in ihm angesammelt hatte, wie er nur konnte. „Und ich habe Halsschmerzen. Wenn du dich während der Reise auch nur einmal mit mir unterhalten hättest, dann wüsstest du das auch.“
„Bitte streitet euch nicht, jetzt wo wir endlich wieder zusammengefunden haben“, sagte Miriam, und tatsächlich ließ sich Elias von ihren Worten für den Moment von seinem Misstrauen abbringen. Die Freude darüber, Miriam wiederzusehen, war ihm allerdings noch immer nicht anzumerken, und Ruben wusste natürlich, woran das lag. Elias hatte noch nichts von der Kugel erzählt.
Miriam führte sie zu einem der Tische und goss ihnen aus einer großen Karaffe ein kaltes Getränk ein, das nach frischen Kräutern schmeckte und in Rubens Verstand für den Moment ein wenig Klarheit zurückbrachte. Die Erschöpfung allerdings wurde rasch zur Müdigkeit, und so lehnte er meist schweigend im Stuhl und lauschte dem Gespräch zwischen Miriam und Elias, hörte davon, wie Miriam im Bild der Kugel Teresa gesehen hatte, wie sie über einen Teleporter und verborgene Runen – was immer das schon wieder bedeuten mochte – an diesen Ort gelangt war, und wie sie davon erfahren hatte, dass es eben dieser Turm gewesen war, an dem die erste der schwarzen Kugeln in die Welt gebracht wurde.
Elias’ Finger verkrampften sich am Rand der Tischplatte, als Miriam von der Kugel sprach. Er hatte noch immer nichts gesagt, aber nun ließ es sich nicht mehr vermeiden.
„Miriam“, sagte er mit tonloser Stimme. „Miriam, die Kugel...“
„Ich weiß“, sagte Miriam und lächelte sanft. „Sie ist zerbrochen. Aber wir brauchen sie ohnehin nicht mehr. Sie hat ihren Zweck erfüllt, indem sie uns alle hergebracht hat.“
„Du weißt es?“, entfuhr es Elias, und auch Ruben schaute verblüfft auf. „Aber... wie kannst du davon wissen?“
„Weil er es mir gezeigt hat.“ Miriams Tonfall hatte plötzlich etwas Feierliches, aber da war auch der Hauch eines verzückten Lächelns auf ihren Lippen. Ruben konnte sich nicht daran erinnern, sie jemals so gesehen zu haben. „Der Gott im Glas.“
Sie griff an ihren Hals und zog die Kette hervor, an der eine kleine runde Scheibe aus schwarzem Glas angebracht war. Mit vorsichtigem Griff hob sie die Scheibe vor ihr Gesicht und klemmte sie vor ihr rechtes Auge.
„Er hat mir gezeigt, was geschehen würde. Wie ihr Teresa finden würdet, im Tempel, und wie ihr die Kugel benutzen würdet, um mich zu finden. Wie ihr die Insel erreichen würdet, auf Teresas Schiff. Ich habe seit Wochen auf diesen Tag gewartet. Seit dem Tag meiner Ankunft.“
Ruben konnte nicht anders, als sie anzustarren, so absonderlich sah sie aus mit diesem schwarzen Glasplättchen vor dem Auge. Sie wirkte kaum älter als damals, dachte er. Natürlich, da waren ein paar kleine Fältchen um die Augen herum, aber der Blick in diesen Augen war voller Jugendlichkeit. Entweder hatte ihr Irdorath nicht so sehr zugesetzt wie Elias, oder aber dieser Ort hatte etwas in ihr wieder zum Erblühen gebracht. Der Ort, oder... oder dieser Gott, von dem sie sprach.
„Du siehst Bilder?“, fragte Elias. „Wie in der Kugel? Aber diesmal... auf dieser Glasscheibe?“
„Es ist ein Monokel“, erklärte Miriam und faltete ihre Hände auf der Tischplatte. „Und es ist nicht wie bei der Kugel. Diese Bilder kommen nicht bloß aus der Zukunft, sondern... von überall her. Und sie sind klarer. Deutlicher. Ich weiß, was er mir mitteilen möchte. Wohin er mich leiten möchte.“
Plötzlich bildete sich ein Kloß in Rubens Hals, und diesmal war nicht bloß der Schleim daran schuld. Er fragte sich auf einmal, was Miriam wohl noch alles im schwarzen Glas gesehen haben mochte. Wusste sie längst, was er noch immer mit letzter Sturheit zu verbergen versuchte? Hatte sie... seine Vergiftung gesehen?
„Miriam, dieses Artefakt, das du da hast... ist es...“, setzte Elias an und atmete noch einmal tief ein, bevor er mit gesenkter Stimme sagte: „Stimmt es, dass dieser Ort der unsichtbare Turm ist?“
„Natürlich ist er es“, bestätigte Miriam. „Ihr habt doch selbst gesehen, wie unsichtbar er von außen ist. Aber die Magie, die hier gewirkt wird, ist nicht schädlich.“
„Nicht schädlich?“, fuhr Elias auf, nun wieder deutlich lauter. „Wie kannst du das sagen?“
„Beruhige dich, Elias. Was damals geschehen ist, ist nicht die Schuld der Menschen hier. Im Turm wird an den unterschiedlichsten Zaubern gearbeitet, und alles, was zum Guten geschaffen wurde, kann auch zum Schlechten eingesetzt werden. Vergiss nicht, dass auch die Kugel an diesem Ort zum ersten Mal erschaffen wurde. Dass die Magie, der wir beide unser Leben gewidmet haben, in diesen Räumen ihren Ursprung hat. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, Klarissa zu heilen, dann hier.“
Elias hatte es für einen Moment die Sprache verschlagen. „Hast du auch das gesehen? Hat... dieser Gott... dir das auch gezeigt?“
Miriam senkte den Blick und schüttelte leicht der Kopf. „Es ist nicht so, dass er die ganze Zukunft vor mir ausbreitet. Ich kann ihn nicht dazu zwingen, mir etwas zu zeigen. Aber es war sein Wille, dass ihr mit Klarissa hierher kommt... dass ihr alle zusammen hierher kommt. Er hat dafür gesorgt, dass wir an diesem Ort wieder zusammenfinden. Und ich bin davon überzeugt, dass es einen guten Grund dafür gibt.“
Ruben wusste nicht, was er von Miriams Worten halten sollte. Gab es diesen Gott wirklich, von dem sie sprach? Er hätte all das vermutlich als wirres Gerede abgetan, wenn es nicht Miriam gewesen wäre, die diese Worte sprach, und wenn er nicht längst am eigenen Leib erfahren hätte, dass Blicke in die Zukunft sehr wohl im Bereich des Möglichen lagen. Wenn es die göttliche Instanz gab, von der sie redete, und wenn es stimmte, dass ihn dieser Gott nicht ohne Grund hergebracht hatte... dann musste es bedeuten, dass es noch eine Möglichkeit auf Rettung für ihn gab. Welchen Sinn hätte es schon, ihn in den Turm zu locken, nur damit er hier jämmerlich verreckte? Er konnte sich nicht dazu bringen, mit Herz und Seele daran zu glauben, aber wenn eine neue Hoffnung auftauchte, dann konnte er nicht anders, als sich an sie zu klammern.
„Miriam?“, erhob er aus einer plötzlichen Idee heraus die Stimme. „Kann ich selbst einmal hineinsehen? In dein Monokel, meine ich?“
Ruckartig drehte sie den Kopf in seine Richtung. In ihr Gesicht war ein ganz merkwürdiger Ausdruck getreten, und Ruben fragte sich irritiert, ob sie diese harmlose Anfrage wohl auf irgendeine Weise beleidigt hatte.
„Es darf immer nur einer das Monokel tragen“, sagte Miriam, als ob sie aus einem Buch voller Gesetze zitierte. „Und das bin derzeit ich.“
„Ich will es ja gar nicht tragen“, versuchte es Ruben noch einmal. „Ich meine – nur einmal hineinschauen. Damit ich verstehe, was du meinst.“
„Es tut mir leid.“ Miriam löste das Monokel aus ihrem Gesicht und verbarg es erneut unter ihrem Kleid. „Es gibt immer nur einen, der hineinschauen darf. Und wer das ist, bestimmt allein er.“
Ruben hatte begriffen, dass es keinen Zweck hatte, weiter nachzubohren, aber er kam ohnehin nicht dazu, noch etwas zu sagen. Miriam richtete sich plötzlich vom Tisch auf und ging zur Tür hinüber.
„Entschuldigt bitte, aber ich möchte unseren Besucher nicht länger vor der Tür warten lassen.“
Verwundert beobachtete Ruben, wie sie die Tür öffnete und ein muskulös gebauter Mann den Raum betrat. Er trug eine weiße Hose und ein ebenso weißes Hemd, dessen Knöpfe allerdings unverschlossen waren, sodass seine breite Brust zum Vorschein kam, die vor Schweiß glänzte. Ruben fragte sich, ob dieser Mann tatsächlich schon seit Längerem vor der Tür gestanden und wieso er dann nicht einfach angeklopft hatte.
„Nett, Euch auch einmal wieder zu Gesicht zu bekommen, Laurin“, begrüßte ihn Miriam, klang aber nicht besonders freundlich dabei. „Nachdem Ihr mir wochenlang aus dem Weg gegangen seid.“
„Wer das Monokel trägt, darf nicht gestört werden“, erwiderte der Mann mit einem etwas steifen Lächeln. „Und Ihr wisst doch, dass es meine Aufgabe ist, mich um die Neuankömmlinge zu kümmern. Ihr hingegen wart schon sehr schnell kein Neuankömmling mehr.“
„Zu kümmern, ja?“, sagte Miriam scharf. „Ihr habt mich einfach allein gelassen, als ich noch ganz ohne Orientierung war.“
„Nun, ich hatte das Gefühl, dass Ihr ein wenig Zeit für Euch selbst brauchtet“, erklärte sich Laurin. „Aber all das ist doch schon lange her, und ich möchte Euch nicht mit Gesprächen über längst Vergangenes langweilen. Ohnehin bin ich nicht wegen Euch hier, wie Ihr Euch sicher denken könnt.“
Miriam verschränkte die Arme vor der Brust. „Was wollt Ihr von meinen Freunden?“
„Sie willkommen heißen, was sonst?“ Laurin zuckte mit den Achseln. „Sie sind neu hier.“
„Heute sind sie meine Gäste“, entgegnete Miriam. „Ihr könnt morgen mit ihnen sprechen.“
Der braun gebrannte Mann mit dem Stoppelbart sah kurz so aus, als wollte er Protest einlegen, dann aber seufzte er leise und sagte: „Nun gut. Da ist noch etwas.“
„Ja?“
„Das Schiff, mit dem die Neuankömmlinge eingetroffen sind“, sagte Laurin. „Es sind noch andere an Bord. Ich schlage vor, sie ebenfalls in den Turm aufzunehmen.“
„Nein“, rief plötzlich Elias dazwischen. Überrascht richteten die Übrigen ihre Blicke auf ihn. „Klarissa wird den Turm nicht betreten, bevor ich mir nicht ganz im Klaren darüber bin, was sie hier erwartet. Die Reise hat ihr schon mehr als genug zugesetzt.“
Gerade deshalb musste ihr ein luxuriös ausgestatteter Raum wie dieser hier doch mehr als angenehm sein, ging es Ruben durch den Kopf. Aber er konnte Elias verstehen: Er wusste ja selbst noch nicht so richtig, was er von diesem merkwürdigen Turm halten sollte, deren Bewohner er bislang kaum zu Gesicht bekommen hatte.
„Ihr habt ihn gehört“, wandte sich Miriam wieder an Laurin, schlug dann aber einen versöhnlicheren Ton an. „Gebt mir etwas Zeit, mich mit meinen Freunden zu besprechen. Für diese Nacht können sie bei mir bleiben, und morgen früh werden wir alles weitere klären.“
Laurin schwieg für einen Moment, dann nickte er erst Miriam und anschließend Ruben und Elias zu, bevor er sich abwandte.
„Nun gut. Morgen früh also.“
Ruben fand keinen Schlaf in dieser Nacht.
Von seinem Hals aus schossen abwechselnd kalte und heiße Wellen aus bohrendem Schmerz durch seinen Körper, und sein Magen wurde von heftigen Krämpfen heimgesucht. Er hätte vielleicht doch etwas essen sollen, dachte er jetzt. Miriam hatte ihnen feinste Speisen aufgetischt, von frischem Obst aus südlichen Gefilden über süßlich duftenden Kräuterreis bis hin zu Filetscheiben aus dem Fleisch ihm unbekannter Tiere. Offenbar trieben sie im unsichtbaren Turm Handel mit allen Teilen der Welt, und an einem anderen Tag hätte er bei diesem reichhaltigen Angebot nur zu gern zugegriffen. Aber jedes Mal, wenn er bloß eine der Trauben ein wenig zu lange angesehen hatte, da hatte es gleich wieder von unten gegen seinen Hals gedrückt und ihm jeden Gedanken ans Essen ausgetrieben. Er hatte es auf seine Seekrankheit geschoben, und Miriam hatte ihm eine klare Suppe angeboten, an der er ein wenig genippt hatte. Eine Weile lang waren sie noch gemeinsam am Tisch geblieben, während Elias von dem Handel mit Varyan berichtet hatte. Aber gerade als Ruben gehofft hatte, dass nun Miriam ihrerseits das Gespräch an sich reißen und von all den Absonderlichkeiten des Turms erzählen würde, da hatte sie es für nötig befunden, sich erneut das Monokel aufzusetzen, um sich kurz darauf zu entschuldigen und sie alleine in ihrem Gemach zurückzulassen. Was auch immer es war, das sie für den Gott im Glas hatte tun sollen, sie war jedenfalls erst am späten Abend zurückgekehrt. Bis dahin hatten Ruben und Elias allein miteinander verbringen müssen, eine Aufgabe, die sie leidlich gut bewältigt hatten. Als Miriam zurückkehrte, hatte sie ihnen aus den beiden Sitzecken gemütliche Schlafplätze hergerichtet, in denen sich zwischen Decken und samtigen Kissen gut ruhen ließ. Wenn, ja wenn es der eigene Körper denn zuließ, dass man zur Ruhe kam.
Abwechselnd fror und schwitzte Ruben, hatte zuerst gleich zwei Paar der weißen Pantoffeln, die ihnen Miriam angeboten hatte, übereinander angezogen, sie aber bald wieder abgelegt und die Socken gleich mit ausgezogen. Sein dicker Schal und der Mantel, den er auch im Schlaf trug, waren ihm bald verhasst, aber er konnte sie unmöglich ablegen. Wenn ihn am Morgen jemand so liegen sah, durfte er auf keinen Fall die Vergiftung sehen.
Schließlich glaubte Ruben doch, hinabsinken zu können in einen leichten Schlummer. Die Krämpfe hatten sich etwas gelöst, und das Pulsieren des Giftes war zum beinahe einlullenden Rhythmus der Schmerzen geworden. Aber gerade, als Ruben eine Entspannung über sich kommen fühlte, da schoss ihm der Schleim in den Rachen.
Er presste die Hand vor den Mund und fuhr hoch, stolperte ein paar panische Schritte vorwärts. Der leise plätschernde Springbrunnen, rot beleuchtet von dem Licht, das durch die schmalen Schlitze zwischen den Vorhängen hereindrang, war nur einen langen Schritt entfernt, aber – jeder würde es sehen, wenn er sich dorthin übergab, jeder würde die schwarzen Klumpen an der Oberfläche treiben sehen –
Verzweifelt würgte er einen neuerlichen Klumpen hinunter, während die klebrige Masse zwischen seinen Fingern hervorquoll. Er konnte es nicht mehr zurückhalten. Plötzlich hatten die Finger seiner freien Hand einen der Vorhänge gepackt und rissen ihn zur Seite. Ein großes Fenster kam dahinter zum Vorschein, und gleißendes Rot blendete ihn von jenseits des Glases. Er blinzelte, fühlte ein Stechen durch seine Gedanken fahren und erbrach sich an die Glasscheibe. Erbrach sich erneut, erbrach sich ein drittes Mal. Hinter dem Fenster flossen Ströme aus heißer Lava, glühendes Gestein trieb durch flüssiges Feuer. Und davor, an der Scheibe, klebten die verfaulten schwarzen Reste seines Lebens.
Kurz hatte Ruben das Gefühl, bis zum Ende in diese Lavamassen blicken zu können, sich gar nicht mehr abwenden zu wollen. Aber dann wandte er sich doch ab und rieb seine schmutzige Hand an der Innenseite des Vorhangs, bis nur noch ein dünner und unzerstörbarer Schleimfilm an der Oberfläche verblieb. Als er den Vorhang wieder zugezogen hatte und sich umschaute, rechnete er fest damit, dass Elias erwacht sein musste. Aber der Magier lag noch immer langsam und ruhig atmend inmitten der Decken und hatte den Kopf in ein dunkelblaues Kissen gepresst.
Ruben starrte hinüber zu seiner eigenen Schlafstätte, aber er wollte nicht liegen. Wenn er sich jetzt hinlegte, das spürte er ganz deutlich, dann würde er niemals mehr aufstehen.
Der Gedanke traf ihn mit einer schrecklichen Klarheit: Er war gerade dabei, zu sterben. Draußen warteten die höllischen Feuergründe Beliars auf ihn, und er würde sterben in diesem Raum, vielleicht noch bevor die Sonne wieder aufging – wann immer sie aufging, wo immer sie aufging.
Es gibt einen guten Grund...
Aber dafür konnte es keinen Grund geben! Der Gott im Glas hatte ihn hergebracht, Miriam hatte es selbst gesagt. Er musste etwas anderes mit ihm vorhaben, als ihn hier sterben zu lassen!
Und doch...
Und doch war er dabei, zu sterben.
Ich muss es mit eigenen Augen sehen, hallte es durch Rubens vergehende Gedanken. Ich muss sehen, was mir der Gott im Glas zeigen will.
Die Tür zu Miriams Schlafgemach war unverschlossen. Ruben stieß sie auf, viel unachtsamer, als er je in seinem Leben in Heimlichkeit eine Tür aufgestoßen hatte. Aber sie quietschte kaum, ganz so als wollte sie sein Komplize sein in seinem allerletzten, verzweifelten Verbrechen.
Das Himmelbett war von bunten Vorhängen verschlossen, und Ruben verblieb in der Starre, bis er sich sicher war, Miriams regelmäßiges Atmen zu hören. Sie schlief, sie musste schlafen.
Er fand die Stelle, an der sich der Vorhang öffnen ließ, und schob das rot und blau bemalte Tuch zur Seite. Miriam lag auf dem Rücken, den Kopf zur Decke gerichtet, und hatte die Augen geschlossen. Eine Strähne ihres braunen Haars war ihr über das Gesicht gefallen und hatte sich in ihrem Mund verfangen, und im Traum knabberte sie leicht daran, schob die Zähne vor und zurück, deren sanftes Weiß zwischen ihren schmalen Lippen hervor schien. Aber alles, worauf Ruben schauen konnte, war die Kette, die um ihren Hals hing, und die daran festgemachte kleine runde Scheibe aus schwarzem Glas, die neben die rechte Achsel gerutscht war.
Ganz unvermittelt überkam Ruben erneut das Würgen. Er schwankte, musste sich am Stoff des Vorhangs festkrallen, und schluckte den schmerzhaften Brocken, der sich seinen Hals hinauf gebahnt hatte, mit Gewalt wieder hinunter. Miriam schnaufte im Schlaf, und zwei Finger ihrer linken Hand beugten sich. Aber sie öffnete ihre Augen nicht, und als die flimmernden Fleckchen vor Rubens Augen wieder zum großen Teil vergangen waren, da war auch Miriam wieder ganz ruhig in ihrem tiefen Schlaf.
Ruben löste die Hand vom Vorhang und suchte nach einer Möglichkeit, das Glas von der Kette zu entfernen. Doch die schmale silberne Fassung, in der die Scheibe ruhte, war fest verbunden mit dem größten Glied der Kette. Es gab nur eine Möglichkeit: Er musste das ganze Monokel stehlen, Kette und Glas.
Vorsichtig bewegte er seine bebenden Hände auf Miriams Hals zu, beugte sich langsam und mit angehaltenem Atem zu ihr hinab. Ihr warmer Atem kitzelte sein Gesicht, und leise raschelte das Kissen, auf dem ihr Kopf ruhte, als er mit den Fingern der rechten Hand um ihren Hals griff und nach dem Verschluss der Kette tastete. Aber da war nichts. Leise ausatmend löste er die rechte Hand von ihrem Hals, vergewisserte sich, dass sie noch schlief, dass seine leichten Berührungen nicht zu ihr durchgedrungen waren, und fühlte an der linken Seite nach. Und tatsächlich, dort war etwas. Er nahm die andere Hand zur Hilfe, und als er spürte, dass er den Verschluss nicht recht zu fassen bekommen würde, wagte er es, einen leichten, ganz leichten Zug auf die Kette auszuüben, um den Verschluss zu sich heranzuziehen. Nun konnte er ihn mit bloßem Auge im schwachen roten Licht sehen. Miriam murmelte etwas im Schlaf, kurze, unverständliche Wörter, und Ruben ahnte, dass er nicht mehr viel Zeit hatte. Sie träumte etwas, und aus dem Traum erwachte man immer leicht.
Es dauerte fünf, sechs, vielleicht auch zehn Sekunden, aber dann hatte er den Verschluss gelöst. So vorsichtig er konnte, zog er das rechte Ende der Kette hinter ihrem Hals hervor, und dann, endlich, griffen seine Finger nach dem eingefassten Glasplättchen, und er hielt das Monokel in den Händen. Miriam brummte und drehte sich zur Seite, als Ruben vom Bett wegtrat und das Schlafgemach verließ.
Er hatte es geschafft. Er hatte das Monokel – nun musste er nur noch hineinsehen.
Hinter die Vorhänge, schoss es ihm durch den Kopf. Er musste hinter einen der Vorhänge treten und das Glas vor die Lava halten. Dann würde er es endlich sehen – dann würde er sehen, was der Gott im Glas ihm zeigen wollte, vor dem roten Feuerlicht.
Elias schlief, in der gleichen Position wie zuvor.
Aus Miriams Schlafzimmer drang kein Geräusch.
Nur der Springbrunnen plätscherte. Es war so still, wie es die ganze Nacht über gewesen war.
Bis zu der Sekunde, in der mit Wucht die Tür zum Treppenhaus aufgeschlagen wurde und ein klirrender und klappernder Schwarm winziger Vögel auf ihn zuschoss.
Ruben stürzte zur Seite, kam hart an der Kante eines der Kristalltische auf, und fühlte, wie die Vögel auf seinen Rücken niederfuhren. Schreiend wirbelte er herum und schlug nach ihnen, nach den kleinen, rasend schnellen Geschöpfen, und als er eines erwischte, zerstieb es in der Luft in einer Wolke aus Splittern. Aber schon waren sechs, sieben weitere in den Raum geflogen, und von allen Seiten hackten sie nun mit ihren scharfkantigen gläsernen Schnäbeln auf ihn ein, bohrten Löcher in seinen Mantel und zerrten an seinen Haaren. Verzweifelt versuchte er sich loszureißen, stolperte zur Türschwelle hinüber, während er mit den Armen nach den Angreifern schlug, wankte vorbei an Elias, der aus dem Schlaf gefahren war. Gerade hatte er das Gefühl, dass die Attacken der Glasvögel an Kraft verloren hatten, da zischte plötzlich aus der dunkelroten Finsternis des Treppenhauses ein gutes Dutzend weiterer von ihnen heran, und ehe er sich versah, hatten sie seinen Mantel gepackt und ihn daran durch die Tür gerissen, bis an die Treppe, die hinauf führte zu einer der schwebenden Plattformen.
Ruben stolperte, kam auf den untersten Stufen zum Liegen und wälzte sich auf der Treppe, um die Glasvögel unter seinem Körper zu zertrümmern. Aber da fühlte er schon wieder, wie sie ihn packten, wie sie ihre kleinen gläsernen Krallen in seinem löchrigen Mantel vergruben und ihn daran in die Höhe trugen.
Sie wollten ihn zu Tode stürzen.
Hastig schlüpfte er aus dem rechten Mantelärmel, dann aus dem linken, und noch bevor die Vögel ihn weit hatten bringen können, fiel er wieder hinab auf die Treppenstufen, stürzte mit dem Gesicht voran. Ein berstender Schmerz durchschnitt seinen Schädel, er konnte nichts sehen für einige lange Sekunden, fühlte wie sein rechtes Bein in der Luft schwebte, gleich über dem Abgrund, und wie die Vögel schon wieder daran zerrten, wie sie seine Hose fetzenweise von der Haut rissen im Versuch, ihn in die Leere zu ziehen. Keuchend richtete er sich auf, kroch auf der Treppe weiter nach oben, als drei der kleinen Tiere nach seinem Schal griffen, um ihn daran zurückzuzerren. Mit gefletschten Zähnen stemmte er sich gegen die enorme Stärke der gläsernen Kreaturen, bis der Schal riss und sich die Vögel mitsamt ihrer Beute in die Tiefe fallen ließen. Die übrigen hatten nun von seinen Beinen abgelassen, vergruben ihre Schnäbel im schwarzen Fleisch des Halses, pickten die letzten Reste des Schals heraus, während sich Ruben auf den Rücken drehte und versuchte, sie mit den Fäusten zu zerdrücken. Aber mit jedem Vogel, den er vernichtete, kamen fünf weitere heran geflogen, und die Splitter der Zerstörten steckten zu Hunderten in seiner Haut. Und dann, als ihn die Kraft in den Armen verließ – packten die Vögel seine Haare.
Er fühlte seine Kopfhaut reißen, verlor den Boden unter den Füßen, schwebte hinauf, weiter hinauf, vorbei an Treppen und Plattformen, während es um ihn herum zischte und klirrte und klapperte. Fünf Vögel umkreisten ihn, in den Klauen sein zerfetzter Mantel. Ein weiterer hatte das Monokel gepackt, und als Ruben versuchte, danach zu greifen, da schoss er hinab in die Tiefe und war verschwunden.
Der Abgrund unter ihm war endlos und die Schmerzen in seinem Kopf ließen ihn brüllen und kreischen. Aber als die Vögel ihn ganz nah an einer der Plattformen vorbeischweben ließen, da sammelte er seine letzten Kräfte, griff nach der Kante und hievte sich hoch auf den kühlen Stein, schlug die Glastiere aus seinen Haaren, bis die Vogelsplitter seine Hand rot gefärbt hatten.
Die fünf Vögel, die seinen Mantel hatten, stoben kreischend auseinander und zerfetzten den Stoff in der Luft. Etwas Kleines, Rundes fiel heraus. Klappernd kam sein Runenstein gleich neben ihm auf dem Boden der Plattform auf.
Seine Finger tasteten zitternd danach, und gerade als sie ihn umschlossen hatten, da prasselten die Schnäbel wieder auf ihn ein, stachen in seine Haut und rissen, nun da sie die Kleidung vernichtet hatten, Fetzen seines Fleisches aus dem nackten Körper. Seine Finger verkrampften sich um den Runenstein, während die Vögel auf sie einpickten. Er presste sein Gesicht auf den Stein, ließ den Schmerz geschehen und wartete auf das Ende.
Und dann, mit einem Mal, ließen sie von ihm ab und zischten zu allen Seiten davon, verloren sich in der Finsternis über und unter ihm, bis ihr Klirren verhallt war wie ein übler Traum.
Ein groß gewachsener, glatzköpfiger Mann schritt eine der Treppen hinab, die zu der Plattform führten, hinter ihm zwei weitere Männer und eine grauhaarige, ältere Frau. Sie alle trugen weiße Gewänder, und ihr Anblick allein schmerzte in Rubens Augen.
„Nur einer darf das Monokel tragen“, sagte der glatzköpfige Mann, als er vor Ruben zum Stehen gekommen war. „Und Ihr seid es nicht.“
Ruben presste die schmerzenden Lippen zusammen, während er fühlte, wie der schwarze Sud, der aus seinem Innersten quoll, zwischen seinen Zähnen heraus tröpfelte. Er hob die Hand mit dem Runenstein, und zitternd richtete er sie auf den Fremden im weißen Gewand.
„Ich bin – ein Magier des Feuers!“, krächzte er. „Ich bin ein Gesandter Innos’!“
Der Mann beugte sich zu ihm herab, und dann, als Ruben seinen Finger auf der Stirn spürte, hatte ihn die Schwärze endlich besiegt.
Geändert von Laidoridas (03.04.2017 um 21:31 Uhr)
-
▩
Am Vormittag des elften Tages nach ihrer Abreise aus dem Kloster, dem dritten Tag nach ihrer Ankunft am großen See, wurde ihr bewusst, dass sie verfolgt wurde. Schon am frühen Morgen hatte sie beim Blick über die Schulter einen flimmernden Fleck am Horizont bemerkt, eine winzige Unreinheit in der weißen Ebene. Sie hatte ihr zunächst keine Bedeutung beigemessen, aber als sie sich eine oder zwei Stunden später erneut umgeblickt hatte, da war der Fleck zu einer kleinen grauen Gestalt herangewachsen. Und diese Gestalt folgte ihr, hatte ihre Fährte aufgenommen. Bald konnte sie deutlich Arme und Beine ausmachen, wie sie im entschlossenen Gleichschritt durch den gefrorenen Schnee marschierten, zielstrebig auf das Seeufer zu, ohne Unterlass und ohne Rast. Als es soweit war, dass die dunklen Höhlen unter der Stirn des grauen Schädels sichtbar wurden, da wusste sie schon längst, wer ihr auf den Fersen war.
Sie hatte im Kloster von den Wiedergängern gelesen. Vor Jahrzehnten war dieses verlassene, namenlose Gebiet südlich der Fjorde mehrmals zum Schlachtfeld zwischen Kriegern der Orks und des Feuerclans geworden, und die Opfer dieser Kämpfe lagen noch immer zu Hunderten unter der verkrusteten Schneedecke begraben. Es mochten noch immer alte Schamanenzauber am Werk sein oder bloß der unerklärliche Wille Beliars – niemand wusste so genau, was dazu führte, dass es von Zeit zu Zeit einen Toten gab, der es nicht mehr aushielt in seinem kalten Grab unter der Erde. Der sich aus dem Schnee grub, um ziellos über die Ebenen zu wandern, bis er irgendwann, nach Tagen oder Jahren, jemand Lebendiges in der Ferne sah, den er verfolgen konnte. Eine einsame, bewegliche Insel aus Wärme, auf die jeder zusteuern musste, der in einem kalten, toten Meer segelte.
Zunächst war sie guter Hoffnung, dass ihr Verfolger sie nicht einholen würde, bevor sie gefunden hatte, was sie suchte. Den größten Teil des gefrorenen Sees war sie bereits abgegangen. Sie wusste, dass es nicht mehr lange dauern konnte. Irgendwann an diesem Tag würde sie es finden, und dann würde er ihr nicht folgen können.
Aber dann, schon am Mittag, hatte er sie doch eingeholt.
Als sie die Eisdecke unter dem Druck der Knochenfüße knirschen hörte, da drehte sie sich um, ließ ihren Rucksack mit den aufgebundenen Decken zu Boden sinken und löste ihr Messer vom Gürtel. Ihr Atem ging schneller, während sie wartete, und in immer kürzen Abständen stiegen die dichten Wölkchen vor ihr in der Luft auf.
Der Wiedergänger war beinahe nackt, nur ein paar feuchte Stofffetzen hatten sich zwischen seinen Rippen verfangen. Kein Helm, keine Waffe. Nichts als der blanke Tod, der es auf sie abgesehen hatte.
Ich bin noch nicht bereit für den Tod, dachte sie. Es ist erst Mittag, und ich werde es noch finden.
Sie stürzte nach vorn, noch bevor der Untote die Gelegenheit zum Angriff bekommen hatte, und hieb mit dem Messer nach seinen Halswirbeln, in der Hoffnung, den Schädel vom Rumpf zu trennen. Aber ehe die Waffe ihr Ziel erreicht hatte, da fühlte sie schon den scharfen Griff der Knochenfinger um ihr Handgelenk. Schon hatte ihr der Wiedergänger die Waffe aus den Fingern gezogen, stieß sie mit Gewalt zurück und setzte dann gleich mit dem Messer nach. Sie taumelte, als die Klinge ihre Haut zerschnitt. Einmal, zweimal. Ein Schnitt über die Wange, ein Schnitt über die Stirn.
Der Wiedergänger machte keinen Laut. Zum ersten Mal stand er still und starrte aus schwarzen Höhlen, während das Blut von der Messerspitze zu Boden tropfte. Sie wusste, dass sie ihn nicht überwinden konnte, dass jeder Versuch von der ersten Sekunde an töricht gewesen war. Weitaus kräftigere Krieger als sie waren daran gescheitert, und weitaus mächtigere Magier. Sie konnte nur versuchen, wegzulaufen, und das tat sie. Sie wandte sich ab und rannte, stürmte voran über das spiegelglatte Eis, weiter hinaus auf den See.
Sie rannte, bis sie stürzte, und als ihr Kopf auf dem Boden aufkam, da verging ihr für ein paar kurze Momente das Sehen. Aber die Sonne kam zurück. Der graue Wolkenhimmel über dem See brach auf. Sie sah den Wiedergänger, wie er ohne Hast den Weg zu ihr zurücklegte, wie sich seine harten Zehenknochen bei jedem Schritt in den eisigen Untergrund bohrten, um ihm Halt und Sicherheit zu verleihen. Und als der helle Sonnenschein sie umgab, da sah sie plötzlich auch noch etwas anderes. Etwas unter der Oberfläche. Tief unter dem Eis lauerte ein gewaltiger dunkler Schatten.
Ich habe es gefunden, dachte sie kraftlos. Immerhin, ich habe es noch gefunden.
In diesem Moment war sie überzeugt davon, dass dieser Gedanke zu ihrem letzten geraten würde, aber es war der gleiche Moment, in dem Bewegung in den Schatten kam. Sie spürte, wie das Eis unter ihrem Körper erzitterte, wie es knirschte und knackte. Ein dunkles, fernes Dröhnen drang aus den Tiefen des Sees zu ihr herauf, und als es anschwoll, als es immer lauter und schmerzhafter wurde, da erstarrte der Wiedergänger, fünfzehn oder zwanzig Schritte bevor er sie erreicht hatte, und senkte den Kopf.
In der nächsten Sekunde riss es ihn entzwei. Das Eis barst, Wasser spritzte, und eine Pyramide aus Stein drang mit Macht an die Oberfläche.
Hastig krabbelte sie auf dem glatten Boden zurück, als tiefe Risse das Eis zum Zersplittern brachten, aber es dauerte nicht lange, da war das große steinerne Objekt wieder zum Stillstand gekommen. Hoch wie zehn Bäume ragte es aus dem See hervor, und unterhalb des Eises musste es noch weit tiefer reichen. Seine Wände waren ebenso glatt wie das Eis, das er durchstoßen hatte, und sie waren aus einem hellen Sandstein gefertigt. In der Mitte der ihr zugewandten Seite befand sich eine Öffnung, nur wenig oberhalb des Bodens, durch die ein letzter Schwall Wasser zurück in den See floss.
Es dauerte eine Weile, bis sich ihr Atem soweit beruhigt hatte, dass sie sich traute, näher heranzutreten. Zunächst hatte sie geglaubt, dass noch etwas geschehen würde, dass vielleicht jemand heraustreten würde. Aber es geschah nichts mehr. Die Stille und die Einsamkeit der letzten Tage waren zurückgekehrt. Die ungestörte Ruhe, die sie begleitet hatte, bevor der Wiedergänger sie aufgespürt hatte. Nun jedoch war sie nicht mehr allein.
Vorsichtig trat sie an die Pyramide heran, prüfte vor jedem Schritt mit dem Fuß, ob das Eis ihrem Gewicht noch standhalten würde. Das große Loch klaffte erwartungsvoll in der Wand, dahinter nichts als Dunkelheit. Sie hatte diese Dunkelheit erwartet und Fackeln mit auf die Reise genommen, aber die lagen nun viel zu weit entfernt in ihrem Rucksack, und sie wagte es nicht, die Pyramide auch nur für ein paar Minuten zurückzulassen. Zu groß war die Angst, dass das immense Bauwerk wieder hinabsinken würde in das Wasser, wenn sie nicht handelte. Wenn sie ihm nicht zu verstehen gab, dass sie die Einladung annehmen würde. Natürlich, sie konnte dann immer noch ihren ursprünglichen Plan verfolgen, sich mit der Spruchrolle in ihrem Rucksack für ein paar Minuten in einen Lurker verwandeln und hoffen, schnell genug tauchen zu können – den Eingang erreicht zu haben, bevor der Zauber seine Wirkung verlor. Doch der ursprüngliche Plan war zu einem guten Teil Irrsinn gewesen, und als sie nun blutend und zitternd über das rissige Eis schritt, da jagte ihr die Vorstellung, in den tiefen kalten See unter ihren Füßen hinabzutauchen, einen Schauer über den Rücken.
Es brauchte nur einen beherzten Schritt, um die Öffnung zu betreten, aber als sie diesen ersten Schritt getan hatte, da blieb sie unschlüssig am Eingang des großen Steinkorridors stehen, der sich von hier aus in das Innere hinein erstreckte, und wusste nicht so recht, ob sie tatsächlich eintreten sollte in die unbekannte Finsternis. Das Bauwerk war offensichtlich von gewaltigen Ausmaßen, und es war unmöglich vorauszusagen, wie lange sie sich würde voran tasten müssen, bis sie in einen beleuchteten Teil vorgedrungen war. Aber was war die Alternative? Sie war so weit gekommen, sie würde auf keinen Fall wieder abspringen und riskieren, dass ihr entglitt, wonach sie so lange gesucht hatte.
Der Boden unter ihren Füßen war merkwürdig trocken, wurde ihr bewusst, als sie den Weg in die Finsternis eingeschlagen hatte. Natürlich musste es eine Vorrichtung geben, die dafür sorgte, dass das Innerste der Pyramide nicht mit Eiswasser geflutet wurde, aber wenn es so etwas gab, dann war es für sie jedenfalls nicht sichtbar. Es dauerte allerdings nicht lange, da war überhaupt nichts mehr sichtbar für sie, und auch die hartnäckigsten der mittäglichen Sonnenstrahlen schafften es nicht mehr zu ihr herein. Mit der Hand strich sie im Gehen über die Steinwand zu ihrer Rechten und entsann sich des Ratschlags, den sie von einer alten Geschichte über das längst verfallene Labyrinth von Al Ayen in Erinnerung behalten hatte: Immer an der rechten Seite halten. Immer rechts abbiegen.
Aber es gab keine Abbiegungen, und bisher deutete nichts darauf hin, dass sie sich überhaupt in einem Labyrinth befand. Der Korridor verlief geradeaus und immerzu geradeaus und schien gar kein Ende nehmen zu wollen. Längst hatte sie das Gefühl, dass sie schon vor Minuten auf der anderen Seite der Pyramide hätte herauskommen müssen, denn so groß war der oberirdische Teil, den sie von außen hatte sehen können, ganz sicher nicht gewesen. Plötzlich rutschten ihre Finger ab, und als sie hastig versuchte, wieder die Wand zu ertasten, da fand sie nichts mehr. Sie atmete tief ein, atmete tief aus. Machte ein paar ruhige Schritte rückwärts und tastete erneut. Aber es war nichts mehr da. Die Wand war fort, und damit ihr einziger Halt an diesem Ort. In alle Richtungen war nichts als Schwarz, und kaum hatte sie sich ein wenig gedreht, da bereute sie es sofort, denn jetzt wusste sie nicht einmal mehr mit Sicherheit zu sagen, aus welcher Richtung sie gekommen war.
Mit schmerzhaft hämmerndem Herzen beugte sie sich hinab und legte die Hand auf den Boden, um sich zu vergewissern, dass da noch etwas Fassbares verblieben war. Echter Stein mit rauer Oberfläche.
Als sie sich wieder aufgerichtet hatte und nach einer Richtung suchen wollte, in die sie sich wenden konnte – in irgendeine dieser endlosen schwarzen Richtungen ins Nirgendwo – da flammte es plötzlich heiß in ihrem Schädel auf, und sie erinnerte sich an die Wunden, die ihr der Wiedergänger versetzt hatte. Erst jetzt kam sie auf den Gedanken, ihr Gesicht abzutasten. Es war feucht vor Blut, und jede der Berührungen brannte sich in ihr Bewusstsein, entflammte weiße Lichter in der Dunkelheit, die vor ihren Augen tanzten. Aber eines dieser Lichter war dunkler als die anderen, es hatte einen rötlichen Schein und es wechselte nie die Position. Es war mit den übrigen gekommen, aber es verließ sie nicht mehr.
Es war das Licht einer klappernden, alten Laterne, und das Klappern wurde begleitet vom Geräusch sich nähernder Schritte. Erleichterung kam in ihr hoch, aber sie war dicht verwoben mit einer neuen Angst, einer anderen Art von Anspannung. Es war ein Mensch, der mit der klappernden Laterne auf sie zukam, und er sah beinahe so aus, wie sie es in den Büchern gelesen hatte. Das Rot der Bänder war selbst im warmen Licht der Laterne blasser, als sie es sich vorgestellt hatte, und an vielen Stellen war es von dunklen Flecken durchsetzt. Der Blick in den Augen des haarlosen knittrigen Kopfes, der aus diesen Bändern hervorschaute, war auch ganz sicher kein stechender Habichtblick, und erst recht kein wahnsinniges Harpyienglotzen. Aber auf diesen Teil der Erzählungen hatte sie ohnehin wenig Wert gelegt. Er war einer von ihnen, darauf kam es an, und er war nicht bloß Teil von Legenden und Gerüchten. Er war echt, er war Teil ihrer Welt, und sie hatte ihn gefunden.
„Wie heißt du?“, fragte er mit der rauen Stimme eines alten Mannes. Das Gold seiner Zähne schimmerte wie Honig im flackernden Laternenschein.
„Celine“, sagte sie.
„Celine?“, wiederholte er langsam und verengte die Augen, die über dicken, faltigen Tränensäcken saßen. „Ich glaube nicht, dass du Celine heißt. Bist du auf der Suche nach einem neuen Namen?“
„Ich bin...“ Sie brach ab und formulierte ihre Worte mit Bedacht. „Ich bin auf der Suche nach einer neuen Aufgabe.“
Der Mann in den roten Bandagen neigte den Kopf. „Dafür braucht es keinen neuen Namen.“
Sie schwieg, aber als er das Schweigen erwiderte, da wusste sie, dass es zwecklos war, sich zu widersetzen.
„Teresa“, sagte sie im Tonfall der Kapitulierenden. „Das ist mein Name.“
Gierig kratzte sie mit dem Löffel den letzten Rest des etwas zu trockenen, aber schmackhaften Breis aus der steinernen Schüssel. Es war fast zwei Wochen her, seit sie etwas anderes gegessen hatte als das harte, geröstete Brot, dass ihr im Kloster als Reiseproviant verkauft worden war. Der rot gewandete Mann, der sich ihr als Vigor vorgestellt hatte, musste bemerkt haben, dass sie noch nicht satt war, denn er bedeutete ihr mit einem auffordernden Nicken, sich aus dem großen Bottich mehr zu nehmen. Sie zögerte nicht lange und schöpfte mit der Schüssel eine ordentliche Menge ab.
„Danke“, murmelte sie, und bevor sie den Löffel zum Mund geführt hatte, hielt sie in der Bewegung inne und fügte hinzu: „Ich meine, auch danke für vorhin. Ihr habt mich vor dem Untoten bewahrt.“
„Du hast eine entbehrungsreiche Reise hinter dir“, sagte er mit einem Lächeln, während er die Nadel, mit der er ihre Wunden vernäht hatte, an einem Tuch säuberte. „Es wäre doch schade gewesen, wenn sie so kurz vor ihrem Ziel gescheitert wäre.“
Teresa schwieg und aß ihren Brei. Wenn niemand etwas sagte, dann war auch nichts zu hören, denn aus den übrigen Räumen der Pyramide drangen keine Geräusche in diese kleine steinerne Kammer, in die Vigor sie geführt hatte. Es war eine merkwürdige Vorstellung, dass an diesem Ort tatsächlich Menschen lebten, denn es fehlte ihm an jeder Art von Wohnlichkeit. Keine Teppiche, kein Kamin, keine Bilder an den Wänden. Nur kalter Stein, primitive Tische und Hocker, Fackeln und Kerzen. Sie würde sich daran gewöhnen, dachte sie.
„Nun, da du gegessen hast“, sagte Vigor, als sie ihre zweite Schüssel leer gegessen hatte, „sollten wir darüber reden, weshalb du hier bist. Du suchst also nach einer Aufgabe.“
Sie schob die Schüssel ein wenig von sich weg und nickte. „Ich möchte Eurer Gemeinschaft beitreten.“
Er schaute sie ein paar Augenblicke lang interessiert an, und sie versuchte den Eindruck zu verdrängen, dass er dabei ein wenig belustigt wirkte. „Was weißt du denn über unsere... Gemeinschaft?“
„Ich habe viel über Euch gelesen“, versicherte Teresa. „In allen Büchern, die es gibt über Euch. Es sind nicht viele, aber ich habe sie alle gefunden. Ich weiß, dass Ihr eine verborgene Macht seid in der Welt, die im Geheimen die Ordnung aufrecht erhält. Die verhindert, dass... dass das Gefüge der Realität auseinander bricht.“
Sie war stolz auf sich, dass sie diese letzten Worte so gut behalten hatte. Die Woche, die sie damals in der Bibliothek von Geldern verbracht hatte, war also doch nicht ganz umsonst gewesen.
„Und du weißt auch, was das bedeutet?“
Sie zwang sich dazu, den Blickkontakt zu halten, aber es war nicht einfach. Das dunkle Schimmern seiner beiden goldenen Zahnreihen verwirrte sie jedes Mal, wenn er den Mund aufmachte.
„Ich... ich meine, es steht natürlich nichts Genaues über Euch in den Büchern. Es gibt ja nur Gerüchte, Andeutungen... Aber ich weiß, dass Ihr etwas tut, das von Bedeutung ist.“
„Viele Dinge sind von Bedeutung“, sagte Vigor, „für eine bestimmte Zeit, an einem bestimmten Ort. Die meisten Menschen finden ihre Bedeutung selbst. Wieso brauchst du uns dafür, um deine zu finden?“
Teresa biss sich auf die Unterlippe. „Ich... habe kürzlich meine Lehre abgeschlossen, bei einem Magier, und –“
„Es ist wohl am Besten, du fängst ganz vorne an“, unterbrach er sie. „Auf meine alten Tage weiß ich es zu schätzen, wenn die Dinge der Reihe nach geschehen. Also, wo kommst du her? Ein Kind des Krieges, nehme ich an?“
„Ja.“
Sie fühlte ein gewisses Unbehagen dabei, diesem merkwürdigen alten Mann ihre Lebensgeschichte zu erzählen, aber es blieb ihr wohl nichts anderes übrig. Und war er bei aller Merkwürdigkeit nicht freundlicher zu ihr gewesen als sie es hatte erwarten dürfen?
„Mein Vater war ein Kaufmann in Montera. Ich glaube, er hat dort Lederwaren verkauft, die er von den Jägern der Umgebung bezogen hat, und...“ Sie unterbrach sich und atmete einmal tief durch, um die aufkommende Nervosität abzuschütteln. „Ich kann mich nicht an ihn erinnern. Er ist beim ersten Angriff der Orks auf Montera umgekommen, genau wie meine Mutter. Mein Onkel hat überlebt und sich in den Dienst der Orks begeben. Für mich, glaube ich... oder vielleicht auch, um sein eigenes Leben zu retten. Aber er hat für mich gesorgt, als die Orks allein über Montera herrschten. Er war die einzige Familie, die ich gekannt habe.“
Vigor schürzte die Lippen. „Wünschst du dir manchmal, deine Eltern kennen zu lernen?“
„Kennen zu lernen?“, wiederholte Teresa etwas irritiert. „Ihr meint... dass sie nicht tot wären?“
„Entweder das“, sagte er, „oder dass du wach genug im Geiste gewesen wärst, um sie kennen zu lernen, als sie noch lebten.“
Sie zögerte. „Ich weiß nicht. Ich denke nicht sehr oft über sie nach.“
Es war Vigor nicht anzumerken, was er über diese Antwort dachte.
„Und dein Onkel? Ist er noch am Leben?“
„Nein, schon lange nicht mehr. Ich war acht Jahre alt, als er gestorben ist. Ein Unfall bei der Jagd, haben sie gesagt. Aber ich habe nie genau erfahren, was passiert ist.“
„Würdest du es gerne erfahren?“
Teresa zuckte mit den Schultern. „Das ist schon lange her. Es ändert doch nichts mehr, oder?“
Er sagte nichts darauf, rieb sich nur nachdenklich die Lippen, und sie fuhr fort: „Zu der Zeit war der Krieg schon eine Weile vorüber, und ich war alt genug, um auf den Feldern zu arbeiten. Das habe ich getan, ein paar Jahre lang, bis Merdarion mich zu sich genommen hat.“
„Der Magier?“
„Ein Wassermagier, ja. Er ist durch ganz Myrtana gereist, um nach Kindern zu suchen, die er für geeignet gehalten hat, um sie auszubilden. Merdarion hat uns zu sich nach Khorinis gebracht, und dort haben wir gemeinsam in seinem Haus gelebt und von ihm gelernt. So lange bis... unsere Ausbildung abgeschlossen war.“
„Aber du bist keine Wassermagierin.“
„Nein, bin ich nicht. Er hat uns nicht zu Wassermagiern ausgebildet. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt gedurft hätte ohne die Einwilligung seines Ordens, aber ich glaube, dass er es auch gar nicht wollte. Er wollte, dass wir selbst entscheiden, was wir aus unserem Leben machen. Er hat nur versucht, uns die Voraussetzungen dafür mitzugeben.“
„Ein weiser Mann, dieser Merdarion“, sagte Vigor. „Oder ein sehr dummer. Aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu urteilen. Du also hast dich dafür entschieden, dein Leben in den Dienst einer Gruppe zu stellen, von deren Tätigkeit du bestenfalls sehr vage Vorstellungen hast? Von der du nur hier und da einmal etwas Aufregendes in einem alten Schmöker gelesen hast?“
Teresa war fest entschlossen, sich von der Skepsis des alten Mannes nicht verunsichern zu lassen. Sie durfte jetzt auf keinen Fall einknicken, sonst war womöglich alles umsonst gewesen.
„Wenn es etwas gibt, das ich über Euch wissen sollte, dann sagt es mir. Sagt mir alles, was ich wissen muss, und lasst mich dann meine Entscheidung treffen.“
Vigor lächelte, und vielleicht wäre ihr dieses wohlmeinende Lächeln ohne das viele Gold hinter seinen schmalen Lippen sogar angenehm gewesen.
„Zuerst muss ich dir einige Fragen stellen“, kündigte er ihr an. „Antworte mir ehrlich, und du sollst alles erfahren.“
Teresa nickte. „In Ordnung.“
„Bist du zufrieden mit deinem bisherigen Leben?“
„Ich weiß nicht“, sagte sie. „Es... es hätte schlimmer kommen können, denke ich.“
Er schwieg für einen Moment, dann holte er Luft, als ob er zu einem langen Tauchgang ansetzte und fragte: „Welche ist die größte Ungerechtigkeit?“
Sie musste schlucken. War dies eine Art philosophischer Wissenstest? Sie erinnerte sich an eine Anekdote aus einem alten Buch des Gelehrten Barthos von Laran, in der von einer ähnlichen Situation die Rede gewesen war. Damals hatte sie beim Lesen die richtige Antwort gleich im Kopf gehabt und sich heimlich für ganz schön schlau gehalten, aber diesmal schien ihr die Sache bei Weitem nicht so einfach zu sein. Woher sollte sie schon wissen, was Vigor hören wollte?
„Ich... weiß nicht“, begann sie erneut und ärgerte sich sofort darüber. „Also, ungerecht ist... dass einige wenige in den Palästen hausen und so viele draußen auf den Feldern schuften müssen.“
„Natürlich ist das ungerecht“, bestätigte Vigor. „Aber geht es vielleicht auch etwas weniger allgemein? Sag mir eine konkrete Ungerechtigkeit. Eine, die du vielleicht selbst erlebt hast.“
Teresa überlegte fieberhaft, und schließlich, als sie schon glaubte, überhaupt nicht mehr richtig denken zu können, war ihr plötzlich etwas eingefallen.
„Damals, vor ein paar Jahren“, begann sie, „als ich noch bei Merdarion gewohnt habe. Da ist einmal ein Piratenschiff in den Hafen gebracht worden, das die königliche Flotte besiegt und in Besitz genommen hatte. An Bord des Schiffes waren eine Menge wertvoller Schätze, und darunter auch eine ganze Reihe alter Artefakte. Merdarion war zu Ohren gekommen, dass auch ein paar alte Steintafeln der Erbauer darunter waren, und als er sich die Tafeln einmal aus der Nähe angesehen hat, da ist ihm klar geworden, dass es sich um völlig unbekannte alchemistische Texte der Heilerkaste handelte. Er hat beim Statthalter darum gebeten, die Texte auf den Tafeln studieren zu dürfen, und zunächst hat der Statthalter zugestimmt, ihm die Tafeln zu überlassen. Aber noch bevor sie ihm übergeben wurden, da hat plötzlich ein alter reicher Mann eine Unsumme für die Artefakte geboten, und der Statthalter hat sie ihm verkauft. Lutero hieß er. Früher war er wohl mal ein angesehener Händler gewesen, aber zu der Zeit war er nur noch damit beschäftigt, sein Geld für seltene Artefakte und Jagdtrophäen aus allen möglichen Teilen der Welt auszugeben, um sein Haus damit vollzustellen. Sogar ein wildes Tier aus dem Süden hat er einem Händler abgekauft, eine Katze, die durch die Straßen der Stadt gestromert ist und die Kinder erschreckt hat. Dieser Lutero wusste mit den Steintafeln überhaupt nichts anzufangen, er konnte nicht einmal die alte Sprache lesen, in der sie geschrieben waren. Er hat sie bloß irgendwo in seinem Haus abgelegt, wo sie niemandem mehr von Nutzen sein konnten, und er hat Merdarion nicht einmal erlaubt, einen Blick darauf zu werfen. Wenn Merdarion sie bekommen hätte, wenn der Statthalter nicht bloß das Geld im Sinn gehabt hätte, dann hätte er vielleicht neue Heilmittel erschaffen können, die vielen Menschen hätten helfen können. So aber sind sie nutzlos geblieben und haben niemandem mehr geholfen.“
Als sie geendet hatte, war sie sich plötzlich gar nicht mehr so sicher, ob ihre Erzählung wirklich etwas mit Ungerechtigkeit zu tun hatte. War es am Ende nicht bloß ein ganz normaler Handel gewesen? Aber Vigor legte keinen Protest dagegen ein, und nachdem er eine kurze Weile geschwiegen hatte, stellte er ganz unvermittelt die nächste Frage.
„Was ist es, das du anders machen würdest, wenn du an einem einzigen Zeitpunkt in deiner Vergangenheit etwas anders machen könntest?“
Ich würde die Tür nicht öffnen.
„Ich...“
„Du weißt es nicht, natürlich nicht“, sagte er mit funkelndem Lächeln. „Du musst nicht sofort antworten, wenn du nicht sofort eine Antwort weißt. Du kannst dir sicher sein, ich bin kein ungeduldiger Mensch.“
Ich würde die Tür nicht öffnen.
„Ich würde nichts anders machen.“
Er hob eine Hautfalte, die einmal eine Augenbraue gewesen war. „Nichts? Gar nichts?“
„Nein“, sagte sie. „Mir fällt nichts ein.“
„Nichts also“, wiederholte er leise und vergrub seine goldenen Schneidezähne in der kaum sichtbaren Unterlippe. Schließlich blickte er auf und sagte: „Es ist Zeit.“
„Zeit wofür?“
„Zeit zu gehen. Keine Sorge, du musst nicht zurück durch die Schneewüste. Du wirst die Augen schließen, und wenn du sie wieder öffnest, dann wirst du alles vergessen haben, was wir gerade besprochen haben, und du wirst zurück sein in Myrtana, an einem warmem Ofen –“
„Ich will nicht zurück nach Myrtana!“ Teresa war aufgesprungen, entsetzt von der plötzlichen Abweisung. „Ich will Eurer Gemeinschaft beitreten – ich will alles erfahren! Ihr habt es versprochen!“
„Wir nehmen schon seit langer Zeit niemanden mehr in unsere Reihen auf“, sagte Vigor, der am Tisch sitzen geblieben war und mit starrer Miene zu ihr hinauf blickte. „Und ich denke, dass es besser ist, es dabei zu belassen.“
„Aber wieso?“ Sie spürte, wie die Furcht sie packte. Die Furcht davor, dass alles vergebens war, dass sie alles verspielt hatte – oder vielleicht nie eine Chance gehabt hatte. „Was habe ich falsch gemacht? Ich bin bereit, alles zu lernen, alles zu tun –“
„Es ist nicht deine Schuld“, sagte er, aber klang nicht besonders überzeugend dabei. „In der Vergangenheit waren wir sehr leichtfertig damit, neue Menschen zu uns aufzunehmen. Wir waren uns der Verantwortung nicht immer bewusst... wir haben falsche Entscheidungen getroffen. Die eine oder andere dieser Entscheidungen war sehr verhängnisvoll. Also verzeih bitte, dass ich keinerlei Risiko eingehen möchte.“
„Aber welches Risiko geht Ihr denn ein?“ Teresa weigerte sich mit allem, was in ihr steckte, diese Absage einfach hinzunehmen. Es durfte nicht auf diese Weise enden. „Ihr habt selbst gesagt, dass Ihr mich jederzeit alles vergessen lassen könnt. Ihr müsst mich ja nicht sofort aufnehmen – stellt mich auf die Probe, jahrelang, wenn Ihr wollt. Aber schickt mich nicht weg, bevor Ihr überhaupt wisst, wen Ihr vor Euch habt!“
Vigor schwieg, und sie beobachtete seine kleinen Äuglein dabei, wie sie seine Blicke zuckend über ihr Gesicht fahren ließen.
„Du bist zäh, Teresa“, sagte er. „Das muss nicht immer etwas Gutes sein, aber ich erkenne es an.“
Mit angehaltenem Atem wartete sie auf seine Antwort, auf seine Zusage oder Absage, aber als er sich aufrichtete und mit seiner rot bandagierten Hand ihre eigene vom Frost gerötete Hand ergriff, da klangen seine Worte wie die Nacherzählung einer alten Predigt.
„Als Adanos unsere Welt geschaffen hatte, als einen Ort, an dem die Ordnung und das Chaos zugleich herrschen konnten, da sprach Beliar zum Tier und verlieh ihm einen Teil seiner Macht, um es dazu zu verleiten, das Land zu zerstören. Aber das Tier wurde erschlagen. Beliar sprach zu einem weiteren Wesen, um es sich Untertan zu machen, aber das Wesen wurde fortgespült von der Flut Adanos’. Beliar spürte, dass er mit Worten allein nichts erreichen würde, und er sah mit neidischem Blick auf seinen Bruder Adanos, der das Land und das Meer geschaffen hatte, die Bäume, die Tiere und die Menschen. Und so beschloss er, selbst etwas zu erschaffen, ein einziges kleines Ding nur, so unscheinbar, dass es niemand bemerkte, bis es in der Welt war und nicht einmal mehr von Götterhand getilgt werden konnte. Dieses Ding war nichts als ein dunkler Klumpen Gestein, aber es trug das Chaos in sich. Es hielt sich nicht wie alle übrigen Dinge auf der Welt an die Ordnung von Zeit und Ort, die Innos geboten hatte: Es war an vielen Orten zugleich und zu vielen Zeiten zugleich, es war ganz und zerteilt zugleich – und wer es berührte, auf den gab es seine Kraft weiter. Es war, und es ist das schwarze Erz.“
„Ich habe davon gelesen“, sagte Teresa, die sich nicht sicher war, ob sie wusste, worauf er hinaus wollte. „Wenn man lernt, damit umzugehen, dann kann man es benutzen, um die Zeit zu verlangsamen, richtig?“
„Die Zeit verlangsamen. Die Zeit wechseln. Den Ort wechseln. Wer das schwarze Erz beherrscht, für den ist die Ordnung aus Zeit und Raum aufgehoben. Der ist überall und jederzeit, wo und wann immer er will. Eine schreckliche Waffe – ein Gift, um die Welt aus den Angeln zu heben. Beliar wusste, dass die Menschen es einsetzen würden. Und er wusste, dass es zum Chaos führen würde, unausweichlich.“
Vigor blieb an dem Wort hängen, einen kurzen Moment lang, bevor er fortfuhr: „Es gibt nur einen Weg, um etwas gegen dieses Chaos auszurichten. Nur jemand, der selbst Zeit und Raum überwinden kann, hat die Macht dazu. Jemand, der Beliars eigene Waffe gegen ihn selbst einsetzt. Der das Gift zum Gegengift macht.“
„Also benutzt Ihr das schwarze Erz selbst?“
Er führte ihre Hand an die linke Seite seiner Brust. Sie wusste nicht gleich einzuschätzen, ob es an den dicken Bandagen lag, dass sie kein Klopfen fühlte, aber dann begann sie, etwas anderes zu fühlen. Ein leichtes Vibrieren, ein ständiges Zittern unter dem Stoff und unter der Haut.
„Das schwarze Erz ist das Herz unserer Gruppierung. Wir benutzen es, um dafür Sorge zu tragen, dass alles in der Welt am richtigen Ort und zur richtigen Zeit ist. Das ist es, was wir tun. Unsere Aufgabe.“
Er blickte hinab auf ihre Hand, die er noch immer an seine Brust drückte.
„Bist du also weiterhin entschlossen, diese Aufgabe zu deiner eigenen zu machen?“
Etwas Feuchtes weckte sie aus der Bewusstlosigkeit.
Im Schlaf hatte sich das Band voll gesaugt mit dem Schnee, in dem sie begraben lag, und jetzt drückte es auf ihre Haut wie hunderte klamme, kalte Lappen. Aber was sie gefühlt hatte, das war etwas anderes gewesen. Etwas Lebendiges, das ihre gefrorene Wange berührt hatte.
Sie öffnete die Augen und schaute in das große, weiße Gesicht eines Wolfes. Die Augen des Tieres verengten sich, als es bemerkte, dass sie erwacht war. Es senkte die Schnauze, und leise knurrend wich es einen Schritt zurück.
Weiter, flüsterte es durch Teresas Kopf. Weiter...
Der Eiswolf war stehen geblieben, behielt sie aus seinen wachen, grauen Augen heraus im Blick. Es war, als ob er darauf wartete, dass sie sich rührte, dass sie irgendeine Handlung vollzog, die ihm etwas darüber sagen konnte, mit welcher Art von Geschöpf er es zu tun hatte. Beute oder Jäger.
Teresa rührte sich nicht, wagte es nicht einmal den Kopf leicht zu drehen. Rasselnd drang die kalte Abendluft in ihren Rachen.
Weiter... nur noch einmal weiter...
Sie konzentrierte ihre Empfindungen auf das Band, das an ihrem Körper klebte, an fast jeder Stelle ihres Körpers... aber es war nicht mehr als nasser Stoff, nass und wieder halb gefroren, schwer und eisig. In diesem Moment war ihr das Band nichts als eine Belastung. Sie hatte nicht lange genug geschlafen. Ihre Kräfte waren noch nicht zurück.
Der Wolf stieß ein erneutes Knurren aus, tief und drohend. Teresa ahnte, dass er nicht häufig Futter bekam in diesen Gegenden. Dass ihm jede Mahlzeit überlebenswichtig sein konnte. Aber wenn sie dem Blick standhielt, wenn sie ihm zu verstehen gab, dass sie keine Beute war – dass sie eine Jägerin war, ganz so wie er ein Jäger war –
Dann sah sie die anderen.
Hinter dem sehnigen, weißen Körper des Wolfes zeichneten sich weitere Schnauzen vor dem Schnee ab. Sechs, sieben. Graue Augen, lauernde Blicke. Auch Eiswölfe jagten im Rudel, erinnerte sich Teresa.
Weiter... du musst weiter...!
Ein Bellen, und sie preschten voran.
Plötzlich waren sie ganz nah, ihre Schnauzen vor ihrem Gesicht – ihre Zähne, ihre geifernden Zungen – und Fell, stinkendes, nasses Fell –
Sie stürzte auf den Steinboden, glitt über eine Pfütze aus geschmolzenem Eis und prallte mit dem Kopf gegen die Wand. Dröhnende Schmerzen ließen ihren Schädel erzittern, als sich ihre Hände fieberhaft an der Wand entlangtasteten. Heftig atmend presste sie sich entlang der Wand nach oben, mit den Pupillen den Raum absuchend, sich vergewissernd, dass die Wölfe fort waren, der Schnee fort war.
„Du solltest besser auf deinen Körper acht geben.“
Vigor lag auf dem langen, hüfthohen Steinpodest, auf dem er für gewöhnlich ruhte, und hatte sich zur Seite gedreht, um ihr einen gelangweilten Blick zuzuwerfen. Teresa achtete gar nicht auf seine Worte. Sie konnte sich denken, wie sie aussehen musste. Zerstochen, zerbissen, verfroren. Was kümmerte es ihn?
„Ich nehme an, dass du deine Aufgabe erfüllt hast?“
Langsam ging sie auf das Podest zu, während sich ihr Atem beruhigte. Sie bereute es, keinen anderen Raum für ihre Ankunft gewählt zu haben. Einen, in dem sie Zeit zur Erholung gehabt hätte, bevor es zur Konfrontation kam. Aber vielleicht war es besser so. Keine Zeit verlieren.
„Nein“, sagte sie, und obwohl seine Miene ausdruckslos blieb, erkannte Teresa die Veränderung darin. „Ich weiß, was für den Zustand dieser Menschen verantwortlich ist. Ein alter Zauber der Schwarzmagier, gebunden in einem Runenstein aus schwarzem Erz. Jemand muss ihn eingesetzt haben, um sie... aus der Zeit zu heben. Sie altern nicht, sie unterliegen nicht mehr dem Lauf der Zeit. Sie existieren nur noch. Solange, bis sie jemand aus ihrem Zustand befreit. Ich glaube, dass ich dazu den gleichen Zauber einsetzen müsste... ich bräuchte selbst einen solchen Runenstein.“
„Soweit richtig“, bestätigte Vigor. „Und weshalb hast du dir keinen beschafft?“
„Ich habe Hinweise darauf gefunden, dass im alten Tempel von Irdorath an solchen Zaubern geforscht wurde. Aber dort habe ich keine Runensteine gefunden. Ich habe den ganzen Tempel abgesucht, aber... nicht einmal der kleinste Hinweis.“
„Natürlich hast du nichts gefunden.“ Die Schärfe in seinem Tonfall war nicht zu überhören. „Weil du dich stets nur bemühst, am richtigen Ort zu suchen. Aber nur wer am richtigen Ort und zur richtigen Zeit sucht, kann auch etwas finden.“
„Glaubt Ihr, ich habe es nicht versucht?“ Teresa bemühte sich, den Zorn zurückzuhalten, der bei seinen Worten in ihr aufgebrochen war, aber sie schaffte es nicht ganz. „Ich kann es nicht – es geht nicht! Nicht mit diesem – diesem Band!“
Sie zupfte ärgerlich an einem herabhängenden Fetzen des schwarzen Bandes, der sich am linken Arm ein Stück weit vom Rest gelöst hatte. „Ihr wisst ja nicht, wie es ist, damit auskommen zu müssen – wieviel Kraft das jedes Mal kostet, es einzusetzen! Es ist ein Wunder, dass ich es überhaupt hierher zurück geschafft habe!“
Vigor seufzte. In einer langsamen Bewegung richtete er den Oberkörper auf und hievte seine bandagierten Beine über die Kante, sodass er ihr auf dem Podest gegenüber saß.
„Du bist also nicht mit dem Schiff zurückgekehrt“, stellte er fest. „Wo sind diese vierzehn Menschen, um die du dich kümmern solltest?“
„Sie sind – ich konnte nichts tun!“, verteidigte sie sich und spürte, wie ihre angeschlagene Stimme dabei ins Kippen geriet. „Die Magier, die jetzt auf Irdorath sind, sie haben sie mitgenommen. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber – ich bin kraftlos in diesem Band! Ich kann nichts tun als fliehen – von einem Ort zum anderen wechseln, und dann kraftlos zu Boden sinken! Ich hasse es, ich bin es so leid! Ich will endlich aufgenommen werden, so wie Ihr es versprochen habt. Macht mich zu einem von Euch, voll und ganz zu einem von Euch! Ich werde Euch die Vierzehn zurückbringen, und –“
„Schweig!“
Er war gar nicht laut geworden bei diesem einen, entschiedenen Wort, aber Teresa schwieg.
„Du unterrichtest mich über dein Versagen – dein vollständiges Versagen, ein Versagen in allen Belangen – und bittest mich im gleichen Atemzug um die Aufnahme?“
Sie wagte es nicht sogleich, etwas zu erwidern, aber als er nichts mehr sagte und sie nur auffordernd anblickte, da ergriff sie erst leise, dann mit zunehmend festerer Stimme erneut das Wort.
„Ich möchte ja tun, was Ihr verlangt. Ich möchte alle Aufgaben erfüllen. Aber das bisschen Erz in diesem elenden schwarzen Band ist nichts im Vergleich zu der Macht, die Euch zur Verfügung steht. Ich kann mich nicht frei durch Zeit und Raum bewegen, wie Ihr es könnt – aber genau das müsste ich können, um Euren Aufgaben – um unseren Aufgaben gerecht zu werden! Lasst mich in die Herzkammer gehen, lasst mich das Erz empfangen, und ich werde Euch nie wieder enttäuschen!“
Vigors Züge hatten sich verhärtet. Mit dunkel glänzenden Zähnen kaute er auf seiner schmalen, blassen Unterlippe herum.
„Du bist ungeduldig“, stellte er fest. „Das warst du schon immer. Von Anfang an so ungeduldig. Dabei hast du selbst mich darum gebeten, dich auf die Probe zu stellen.“
„Aber nicht –“
„Jahrelang, wenn ich will. Das waren deine Worte. Und wie du siehst, will ich.“
„Aber wieso?“, fragte sie verzweifelt. „Was muss ich tun...? Ja, ich – ich habe versagt, dieses eine Mal, aber doch nur, weil Ihr mir die Kräfte vorenthaltet, die es braucht, um eine solche Aufgabe zu bewältigen! Diese Magier, mit denen ich es zu tun hatte, sie beherrschen dutzende Zauber – und ich? Dieses Band, in das Ihr mich gewickelt habt, ist für nichts gut als einen schwachen Teleportzauber, der die halbe Zeit den Dienst versagt! Ich habe es all die Jahre damit ausgehalten, und ich habe Euch wenig Grund zur Klage gegeben. Jetzt ist es an der Zeit, dass Ihr Euer Versprechen einlöst!“
„Ich habe dir nie ein Versprechen gegeben“, sagte Vigor, aber gleich nachdem er es gesagt hatte, wurde sein faltiges, haarloses Gesicht von einer ungewohnten Milde ergriffen. „Wieso, Teresa, bist du so begierig darauf, deinen Körper dem Erz zu opfern? Du siehst doch, was es schon jetzt mit dir getan hat. Mit den Haaren und den Zähnen fängt es an, aber damit hört es nicht auf. Und wenn du erst einmal dein Herz gegeben und das Erz empfangen hast, dann gibt es kein Zurück.“
Ihr Blick fuhr über Vigors altes, uraltes Gesicht. Seine zusammengefallenen bleichen Wangen, seine dicken Tränensäcke. Die blassen Augen, aus denen ihr in diesen Momenten die größte Müdigkeit entgegenblickte. Und seine Zähne. Sie hatte sich noch immer nicht an seine Zähne gewöhnt.
„Ich habe mich schon längst entschieden“, sagte sie.
„Nun gut.“ Vigor nickte langsam. „Dann soll es so sein. Aber nicht heute. Nicht, bevor du die vierzehn Menschen, die dir geraubt wurden, zurückgeholt hast.“
Im ersten Impuls wollte Teresa protestieren, aber sie wusste es besser. Er würde in dieser Sache nicht mit sich reden lassen.
„Ich weiß nicht, was diejenigen, die sie dir genommen haben, mit ihnen vorhaben“, sagte er. „Aber wenn Menschen aus ihrer Zeit genommen werden, dann ist es immer eine gefährliche Sache. Einen solchen Menschen kann es leicht in den Wahnsinn treiben, aber schlimmer noch, es kann die Welt in den Wahnsinn treiben. Wann immer jemand versucht, aus dem Strom der Zeit zu entkommen – wann immer jemand versucht, gegen den Strom zu schwimmen... in solchen Fällen geschehen schreckliche Dinge, Teresa. Wir dürfen diesen Vorfall nicht auf sich beruhen lassen.“
Sie musste daran zurückdenken, wie sie diese Menschen gefunden hatte, vor einer halben Ewigkeit, wie es ihr nun vorkam. In einem zugemauerten Raum weit unten in den tiefsten Katakomben unter Trelis, dort war sie auf diese vierzehn Leute gestoßen, ganz so wie Vigor es ihr zuvor angedeutet hatte. Wie selbstverständlich hatten sie dort in Reih und Glied gestanden, als ob sie sich gerade erst aufgestellt hätten. Als ob sie auf etwas Wunderbares lauerten, das ihnen gleich widerfahren würde, auf das sie nur noch wenige Minuten – Sekunden vielleicht – würden warten müssen. Einen ganzen Tag lang hatte sie gebraucht, um einen nach dem anderen auf ihr Boot zu bringen. Mit bloßen Händen waren sie nicht zu bewegen, aber die Kraft des schwarzen Erzes, das in ihrem Band schlummerte, konnte nicht nur sie selbst den Ort wechseln lassen. Es wirkte auch bei anderen, und es hatte auch bei diesen vierzehn Menschen gewirkt. Aber gut hatte es sich nicht angefühlt, denn jeder dieser Menschen hatte ausgesehen, als ob er in eben diesem dunklen, feuchten Kellerraum hatte sein wollen, und nirgendwo sonst.
„Diese Leute... die ich aus Trelis mitgenommen habe“, sagte Teresa zögerlich. „Sie sahen nicht so aus, als ob sie jemand gegen ihren Willen aus der Zeit genommen hätte. Sie wollten es, oder?“
„Natürlich wollten sie es“, erwiderte Vigor unbeeindruckt. „Es war ihr Versuch, dem Tod zu entgehen. Sie wussten, dass der Krieg in ihre Stadt kommen würde, und dass sie es in ihrem Versteck nur für sehr kurze Zeit aushalten würden, bevor ihnen die Nahrung ausgegangen wäre. Wie so viele Menschen haben sie sich gewünscht, in einer anderen Zeit zu leben, aber anders als die meisten Menschen kannten sie jemanden, der ihnen diesen Wunsch erfüllen konnte. Jemand in Trelis hatte sich mit den dunklen Künsten befasst, und im Besonderen mit dem schwarzen Erz. Er hat die Rune erschaffen, von der du gesprochen hast. Er hat diese vierzehn Menschen, die seine Familie sein mögen, seine Freunde oder vielleicht auch Fremde, die ihn gut bezahlt haben, aus dem Griff der Zeit befreit. Und wenn die Wirkung des Zaubers endet, in Jahrzehnten oder Jahrhunderten, dann werden sie – so mag er es ihnen versprochen haben – ihr Leben weiterleben können, wieder vereint mit dem Strom der Zeit, aber weiter flussabwärts. In friedlicheren Zeiten.“
„Und wir...?“
„Wir bringen sie wieder in die Zeit zurück, in die sie gehören.“ Vigor schaute ihr fest in die Augen. „So wie es unsere Aufgabe ist.“
„Natürlich“, versicherte sie rasch.
„Wohin also wurden sie gebracht von diesen Magiern?“
„Sie sind unterwegs zum unsichtbaren Turm“, berichtete Teresa. „Vielleicht sind sie auch schon dort angekommen, während ich auf dem Weg hierher war.“
Vigor entließ sie für einen Moment aus der Umklammerung seines Blickes, was sie mit Erleichterung zur Kenntnis nahm. In langsamen Bewegungen rieb er sich die Nase und murmelte: „Der unsichtbare Turm also? Ich habe schon lange nichts mehr von diesem Ort vernommen. In der Tat ein Ort, an den Magier reisen. Du wirst dort auf eine Vielzahl von ihnen treffen, aber du solltest mit ihnen zurecht kommen. Versuch nicht, sie zu bekämpfen. Rede mit ihnen, und du wirst einen Weg finden.“
Teresa war von diesem Ratschlag alles andere als überzeugt, gerade wenn sie daran zurückdachte, wie ihr letzter Versuch ausgegangen war, mit Elias zu reden. Aber als sie gerade etwas erwidern wollte, da blickte Vigor auf und sagte: „Wenn du Erfolg hast und es noch immer dein Wunsch ist, dann werde ich dich zur Herzkammer führen. Ich verspreche es dir.“
Sie erwiderte den Blick und nickte entschlossen.
„Ich werde mein Bestes geben.“
Vigors Augen fielen für einen langen Moment zu, und als er sie wieder öffnete, da wirkten sie wieder müde und abwesend.
„Dann iss etwas, ruh dich für eine Weile aus und kehre zu mir zurück, wenn du bereit bist.“
Er begab sich nun, da er das Gespräch beendet glaubte, wieder in eine liegende Position, die Beine angewinkelt auf dem kalten Steinpodest.
„Da ist noch etwas.“ Teresa hatte kein gutes Gefühl dabei, überhaupt noch etwas zu sagen, aber es beschäftigte sie zu sehr, um es für sich zu behalten. „Diese Magier auf Irdorath... sie hatten eine Kugel aus schwarzem Glas bei sich. Ich hatte sie kurzzeitig in meinem Besitz, und... als ich sie berührt habe... Es hat sich beinahe so angefühlt wie die Berührung des schwarzen Erzes. Wie das Gefühl, wenn mich das Band an einen anderen Ort bringt.“
„Schwarzer Quarz entsteht durch Verunreinigung mit schwarzem Erz“, murmelte Vigor mit geschlossenen Augen, als zitierte er aus einer vor langer Zeit auswendig gelernten Enzyklopädie. „Aber es ist unmöglich, dass du davon etwas gespürt hast. Der Erzanteil ist viel zu gering, um eine Wirkung zu entfalten. Wir haben das alles schon untersucht... vor langer, langer Zeit.“
„Aber ich habe es doch gespürt, ganz sicher“, sagte Teresa, die sich durch Vigors Erklärung nur bestätigt fühlte. „Vielleicht liegt es am Quarz auf Irdorath, vielleicht ist es eine andere... Mischung? Oder sie haben etwas anderes hinzugegeben. Etwas, das die Wirkung verstärkt.“
„Dann bring mir diese Kugel“, brummte Vigor, und es klang wie etwas, das er im Traum vor sich hinsagte. „Bring sie her, und ich werde sie mir anschauen. Aber vorher lass mich schlafen. Weck mich erst, wenn du bereit dazu bist, den unsichtbaren Turm zu betreten.“
▨
Miriam stieß die Tür auf, und die Stimmen dahinter verstummten.
Ein gutes Dutzend Magier in ihren weißen Gewändern hatte sich um einen großen runden Tisch aus hellem Marmor versammelt. Sie erkannte die Gesichter von Arn, Manel und Sigurd, einigen anderen wusste sie keinen Namen zuzuordnen. Hinter ihnen bot sich jenseits der Glasscheibe der Ausblick über eine braune Felsenlandschaft, vor der wie träge Tropfen eines lauen Sommerregens schwarze Objekte zu Boden fielen, die aussahen wie krumme tote Vögel. Miriam war zu aufgebracht, um sich davon ablenken zu lassen.
„Was ist das für eine Versammlung?“, zerschnitt sie die Stille, bevor sie sich gänzlich hatte über den Raum legen können. „Wieso habe ich von dieser Besprechung nichts erfahren?“
Einige Magier wechselten stumme Blicke, dann ergriff die alte Manel das Wort.
„Ich wüsste nicht, dass es eine Verpflichtung dazu gibt, Euch über jedes Gespräch zu informieren, das in einem dieser Räume stattfindet.“ Ihre Lippen formten ein schmales, herausforderndes Lächeln. „Ihr seid nicht die Herrscherin über den Turm.“
„Ich bin die Trägerin des Monokels“, sagte Miriam mit fester Stimme. „Ich habe ein Recht darauf, zu erfahren, was hinter meinem Rücken beschlossen wird. Und ich habe ein Recht darauf, meine Freunde zu sehen. Wie kann es sein, dass ich nicht zu ihnen vorgelassen werde – dass man mich an der Tür abweist, mich, die Erwählte des Gottes im Glas!“
Sie sah das Schmunzeln in den Gesichtern einiger Anwesender, und es ließ sie innerlich erbeben.
„Meisterin Miriam“, begann Arn, dessen Stimme ebenso glatt und poliert klang wie sein Glatzkopf aussah, „Ihr seid die Trägerin des Monokels, das ist richtig. Aber es ist ebenso richtig, dass Ihr es nur noch seid, weil unsere geflügelten Wächter größere Aufmerksamkeit bewiesen haben als Ihr. Es war Euer Vertrauter, der uns das Monokel rauben wollte, das wichtigste – das einzige Artefakt, das wir haben, ohne das all unser Tun zwecklos ist. Ihr habt ihn in Eurem eigenen Schlafgemach hausen lassen. Sicher werdet Ihr verstehen, dass gewisse Zweifel an Eurer Urteilskraft aufgekommen sind. Und Fragen über das Wesen Eurer... Freunde.“
Miriam hatte sich zusammenreißen müssen, um ihm nicht gleich ins Wort zu fallen. „Ich bin mir sicher, dass ein Missverständnis vorliegen muss“, sagte sie, kaum dass er geendet hatte. „Meister Ruben ist ein Feuermagier und seit langer Zeit ein Freund von mir – ich kenne ihn schon seit einer Zeit, als wir beide noch Kinder waren. Er würde niemals etwas von mir stehlen. Ich weiß nicht, wieso er das Monokel an sich genommen hat, aber ich bin mir sicher, dass er es nicht mit böser Absicht getan hat.“
„Euer Freund ist ein Feuermagier, sagt Ihr?“ Manel hob etwas Kleines vom Tisch auf und bedeutete ihr, näher zu kommen. „Dann ist das hier also der Runenstein eines Feuermagiers?“
Sie kam der Aufforderung nach und nahm den Stein entgegen, den ihr die grauhaarige Magierin aus dem Sitzen heraus reichte. Er hatte beinahe die Form eines gewöhnlichen Runensteins, war aber ungeschliffen und wies hier und da kleine Unebenheiten auf. Das Zeichen, das jemand mit hellrötlicher Farbe darauf hinterlassen hatte, hatte sie noch nie zuvor gesehen, aber es sah eindeutig nicht nach einem Runenzeichen aus.
„Eine Fälschung“, übernahm Manel selbst den Kommentar, als Miriam nicht gleich etwas dazu einfallen wollte. „Und nicht einmal eine besonders gute. Ich habe Goblins gesehen, die bessere Feuermagier abgegeben haben als Euer Freund.“
„Hört zu“, setzte Miriam zu einem Erklärungsversuch an, obwohl sie der Anblick des offensichtlich gefälschten Runensteins verunsichert hatte. „Ruben ist vor beinahe zehn Jahren nach Vengard gegangen, um dort Novize des Feuers zu werden. Und vor... ich weiß nicht, es müssen jetzt zwei Jahre gewesen sein, da wurde er im großen Tempel von Vengard zum Feuermagier geweiht. Meister Elias hat ihn selbst dort besucht, nur wegen ihm – wegen uns, wegen meiner Bitte – ist er überhaupt von dort weg gegangen. Es ist völlig ausgeschlossen, dass er uns die ganze Zeit nur etwas vorgemacht hat. Er würde so etwas nicht tun. Ich bin mir sicher, dass es eine vernünftige Erklärung für sein Verhalten gibt, und wenn ich nur einmal mit ihm reden dürfte...“
„Im Augenblick darf niemand mit ihm reden“, sagte Manel, „außer diejenigen von uns, die versuchen, sein Leben zu retten.“
Miriam stockte. „Was meint Ihr? Haben ihn die Vögel...?“
Als sie das Wort Vögel aussprach, da blieb ihr Blick plötzlich wieder an den schwarzen Dingern hinter dem Fenster hängen. In ihrer Verwirrung klammerte sie sich für eine schwerelose Sekunde an den beständigen, fließenden Rhythmus der fallenden Körper.
„Die Wunden, die ihm die Wächter geschlagen haben, sind sein geringstes Problem.“ Manel nahm ihr den Runenstein wieder ab, und Miriam riss sich von dem Anblick los. „Ihr wisst es offenbar nicht, aber Euer Freund leidet an einer schweren Vergiftung.“
„Aber...“
„Aber er hat doch gar nicht vergiftet gewirkt auf Euch?“, fiel ihr Manel mit süffisantem Lächeln ins Wort. „Sieh einer an. Offenbar hat er es verstanden, Dinge vor Euch geheim zu halten.“
„Ich... ich muss ihn sehen“, stammelte Miriam. „Ich muss wissen, was es damit auf sich hat.“
„Wie ich schon sagte, er wird gegenwärtig behandelt. Solange die Behandlung nicht abgeschlossen ist, darf er nicht gestört werden.“
„Aber er wird überleben? Es ist nicht tödlich, oder?“
„Es ist sogar ausgesprochen tödlich“, mischte sich ein jüngerer Magier mit Schnauzbart ein. „Ein äußerst seltenes Gift, vermutlich ersonnen von den Assassinen Varants. Und es muss schon lange in ihm gegärt haben. Wenn Zhareb und die anderen es schaffen, sein Leben zu retten, dann gebührt ihnen mein größter Respekt.“
Miriam hatte es die Sprache verschlagen. War Ruben tatsächlich mit einer schweren Vergiftung hergekommen, so schwer, dass es ihn sein Leben kosten konnte? Aber wieso hatte er ihr dann nichts davon gesagt, wieso hatte er sich ihr nicht anvertraut?
„Ich will ihn sofort sehen, sobald die Behandlung abgeschlossen ist“, sagte sie, weil ihr nichts Besseres einfiel, und versuchte dabei, wieder ein Stückchen ihrer alten Bestimmtheit zurückzugewinnen. „Und ich will Elias sehen – jetzt gleich. Er hat nichts getan, Ihr könnt ihn nicht einfach einsperren.“
„Elias und die beiden Frauen, die mit ihm auf dem Schiff waren, werden bis auf Weiteres in meinen Gemächern verbleiben“, erwiderte Arn in einem Tonfall, als hätte er ihr mit dieser Entscheidung einen Gefallen getan. „Es mag sein, dass sie mit dem Diebstahl des Hochstaplers nichts zu tun haben, aber wir müssen Gewissheit haben. Es gibt einige Merkwürdigkeiten in diesem Zusammenhang, denen wir nachgehen werden.“
„Elias ist mein engster Vertrauter seit... seit mindestens zehn Jahren!“, fuhr Miriam gegen ihn auf. „Ich lege meine Hand für ihn ins Feuer! Welche Merkwürdigkeiten sollen das überhaupt sein?“
„Da wäre zuvorderst die offensichtlichste Merkwürdigkeit in der Gestalt einiger erstaunlich regloser Menschen, die Elias, Ruben und ihre beiden Begleiterinnen auf ihrem Schiff mit sich gebracht haben. Wir wollten sie mit in den Turm nehmen, aber bislang hatten wir keinen Erfolg. Sie scheinen völlig unbeweglich zu sein, beinahe verschmolzen mit dem Schiff. Wir wissen nicht, wer sie in diesen Zustand versetzt hat, aber es ist ein naheliegender Gedanke, dass Eure Freunde eine Rolle in dieser Sache spielen.“
„Ich weiß nichts von solchen Leuten“, sagte Miriam, „aber ich bin mir sicher, dass Elias eine Erklärung dafür hat. Wenn Ihr mich mit ihm reden lasst, dann wird sich alles klären.“
Arn antwortete nicht, und auch die anderen Magier schwiegen. Draußen vor dem Glas fiel Vogel um Vogel zu Boden. Erst jetzt kam in Miriam plötzlich die Frage auf, wieso sich am Boden nicht längst ein großer Berg aus den toten Kreaturen gebildet hatte. Sie versuchte festzustellen, ob sie verschwanden im gleichen Moment, in dem sie den Boden berührten, aber bevor sie sich so recht darauf eingelassen hatte, wurde ihr bewusst, dass sie ihre Aufmerksamkeit an irgendeinen magischen Unsinn aus einer anderen Welt verschwendete – während ihre Freunde sie vielleicht dringender brauchten als je zuvor.
„Lasst mich mit ihm reden“, forderte sie erneut und blickte nacheinander in die betont ausdruckslosen Gesichter der Magier. „Lasst mich mit Elias reden und ihn selbst fragen, was es mit all dem auf sich hat.“
„Ich denke nicht, dass Ihr mit ihm reden werdet“, sagte Manel langsam. „Ich denke, Ihr werdet uns das Reden überlassen und unsere Entscheidung abwarten. Bis dahin werdet Ihr Euch gedulden.“
„Ihr habt nicht das Recht, mir Befehle zu erteilen.“ Miriam zog das Monokel hervor und hielt es den Magiern entgegen, so energisch, dass die Kette in ihrem Nacken schmerzte. „Nicht, solange ich das hier trage!“
„Wer weiß schon, ob Ihr es noch mit Recht tragt?“
Miriam konnte fühlen, wie rund um den Marmortisch der Atem angehalten wurde. Es war der alte Sigurd gewesen, der diese Worte gesprochen hatte.
„Wer weiß schon, ob Ihr wirklich noch etwas seht, wenn Ihr hineinblickt?“, fuhr er fort, mit ruhiger, aber vor Groll bebender Stimme. „Hättet Ihr nicht sehen müssen, was geschehen würde, wenn Ihr wirklich noch etwas sehen könntet? Hätte es das Monokel zugelassen, gestohlen zu werden, wenn es nicht gestohlen werden wollte? Vielleicht habt Ihr längst einen neuen Träger gezeigt bekommen, und wenn Ihr jetzt hineinschaut, dann habt Ihr nur noch das schwarze Glas vor Augen. Vielleicht wollt Ihr nicht einsehen, dass Ihr das Monokel ebenso schnell wieder abgeben müsst, wie Ihr es erhalten habt.“
Das Schweigen, das nach diesen Worten aufkam, war ein vollkommenes. Miriam sah die erwartungsvolle Anspannung in den Blicken der Magier, und sie wusste, dass jeder von ihnen den gleichen unerhörten Verdacht gehegt hatte, auch wenn sich nur einer getraut hatte, ihn auszusprechen. Sie konnte es ihnen nicht einmal verdenken. Es war ihr eigener erster Gedanke gewesen, nachdem sie das Monokel zurückerhalten hatte und die kurze, aber umso schrecklichere Furcht davor, es für immer verloren zu haben, von ihr abgefallen war: Wieso habe ich es nicht gesehen? Und wenn es stimmte, was über Rubens Vergiftung, über seinen gefälschten Runenstein und über die merkwürdigen Menschen an Bord des Schiffes gesagt worden war: Wieso hatte sie nichts davon gesehen? Sie wusste keine Antwort auf diese Frage, aber sie wusste, dass sie den vielen Blicken, die auf sie gerichtet waren, eine geben musste. Nach Sigurds Worten, die einer Anklage gleichgekommen waren, wurde ein Gegenbeweis von ihr verlangt.
Sie versuchte, das Zittern ihrer Finger zu unterdrücken, als sie das Glasplättchen zu ihrem Gesicht führte, aber es wollte ihr nicht ganz gelingen. Mit etwas zu starkem Druck klemmte sie das Monokel vor ihr Auge, und ein dunkler Schleier legte sich vor den äußeren rechten Teil ihres Sichtfelds. Sie wartete eine Sekunde, wartete eine weitere Sekunde, schloss dann das linke Auge, um sich besser auf das Bild konzentrieren zu können, das sie erreichen würde. Aber noch kam kein Bild. Da war bloß das Schwarz des Glases – leer und hohl, summte es durch ihre Gedanken – eine ungenutzte dunkle Leinwand, die vergeblich auf den Pinsel wartete.
Zeig mir etwas, flehte sie in Gedanken, während sie hörte, wie am Tisch leise geflüstert wurde. Irgendetwas. Irgendetwas!
Es war nur ihre Einbildungskraft, die sie kleine graue Schemen und Strukturen erahnen ließ. Sie alle waren verschwunden im gleichen Moment, in dem sie versuchte, sie zu fassen zu bekommen. Keine Bilder, keine Botschaften.
Ein dröhnendes Knarren ließ sie zusammenzucken. Sie fuhr herum und sah, dass sich die Tür geöffnet hatte. Zwei bärtige Magier, deren Namen sie nicht kannte, waren eingetreten, und in ihrer Mitte hielten sie an den Armen gepackt eine dritte Person.
„Entschuldigt die Störung, aber es gibt einen Eindringling.“
Miriam brauchte einen Moment, bevor sie begriffen hatte, wer die dürre Gestalt war, die zwischen den beiden Männern eingeklemmt war. Das rot aufgedunsene und von einer Vielzahl von kaum verheilten Stichen, Rissen und Wunden überzogene Gesicht war kaum wiederzuerkennen, und vom strahlenden Blond ihrer Haare war ihr auch nichts geblieben – aber sie wusste, an wem sie die schwarzen, schmutzigen Bandagen, die sie trug, schon einmal gesehen hatte. Es war Teresa gewesen, die so gekleidet gewesen war, die Teresa im Kugelbild.
„Ein Eindringling?“, erwiderte Manel verständnislos. „Seit wann nennen wir unsere Neuankömmlinge so?“
„Sie ist kein gewöhnlicher Neuankömmling“, sagte einer der beiden Magier. „Sie ist nicht auf dem Seeweg hergekommen, und auch nicht durch einen Teleporter. Wir waren gerade bei der Arbeit im Laboratorium, als sie plötzlich im Raum stand. Es muss geheime Teleportzauber geben, von denen wir nichts wissen, und offenbar hat sie versucht, sich auf diese Weise heimlich bei uns einzuschleichen.“
„Stimmt das?“, richtete Manel das Wort an Teresa. „Seid Ihr über einen solchen geheimen Zauber zu uns gekommen – mit dem Ziel, uns auszuspionieren? Oder... seid Ihr ein weiterer Dieb?“
„Ich brauche keine geheimen Teleportzauber, um dort zu sein, wo ich sein will.“ In Teresas kühle Stimme war eine ungewohnte Rauheit geraten, dachte Miriam, eine Brüchigkeit. „Und ich bin nicht hier, um zu spionieren oder zu stehlen. Ich bin gekommen, um die vierzehn Menschen zu befreien, die an diesen Ort entführt wurden.“
Leises Raunen ging durch den Raum, als einige der Magier miteinander tuschelten.
„Wir sind auf einige bewegungslose Menschen gestoßen, die erst gestern an Bord eines Schiffes zu uns gekommen sind“, erwiderte die alte Magierin. „Sprecht Ihr von diesen Menschen?“
Teresa nickte. „Das Schiff gehört mir. Es wurde mir gestohlen von den Freunden dieser Frau.“
Miriam hatte geglaubt, dass Teresa noch gar keine Notiz von ihr genommen hatte, aber nun deutete sie plötzlich mit einem schwarz eingewickelten Finger auf sie.
„Ihr seht die Verletzungen, die sie mir zugefügt haben. Ich bin nicht auf Rache aus, aber ich muss zurückhaben, was mir gehört. Das Schiff und die Menschen darauf.“
„Einen Moment“, meldete sich ein rothaariger Magier am Tisch zu Wort. „Ich kenne Euch, nicht wahr? Ihr seht verändert aus, aber ich erkenne Eure Stimme... Ihr wart schon einmal hier vor vielen Jahren, habe ich nicht recht?“
Es war unter all der geschwollenen und teils krustigen Haut schwer, Gesichtszüge auszumachen, aber Miriam hatte den deutlichen Eindruck, dass Teresa von dieser Nachfrage verunsichert war.
„Ich... war schon einmal hier, ja“, sagte sie, leiser als zuvor. „Aber das war in einer ganz anderen Angelegenheit.“
„Ihr habt nach einem Heilzauber gesucht, wenn mich nicht alles täuscht. Mara, nicht wahr?“
„Mara?“, entfuhr es Miriam. „Sie heißt Teresa. Ich kenne sie schon seit langer Zeit, und Ihr solltet ihre Worte besser mit großer Vorsicht genießen. Sie –“
Miriam schnappte entgeistert nach Luft, als Teresa urplötzlich direkt vor ihr stand. Es hatte keine Bewegung gegeben, nicht einmal den Ansatz einer Bewegung – sie hatte einfach den Ort gewechselt, von einem Moment auf den anderen. Die beiden Magier, die sie gehalten hatten, waren vor Schreck wie versteinert, und vom Tisch starrte ihnen ein Dutzend überraschter Augenpaare entgegen.
„Du weißt nichts über mich“, zischte Teresa. Sie schien noch etwas hinzufügen zu wollen, aber dann kräuselte sich ihre zerklüftete Stirn, als ihr Blick auf der rechten Seite von Miriams Gesicht hängen blieb. Langsam streckte sie die Hand aus, bewegte sie mit ausgestrecktem Zeigefinger auf ihr rechtes Auge zu...
„Wag es nicht, das Monokel anzufassen!“
Miriam packte ihren Arm und drückte ihn herunter. Das Gefühl bei der Berührung der Bandagen jagte ihr einen Schauer über den Rücken. So musste es sich anfühlen, eine der alten einbandagierten Mumien anzufassen, die manchmal in den ältesten Ruinen Varants gefunden wurden.
Teresa warf ihr – oder dem Monokel – noch einen letzten nachdenklichen Blick zu, dann wandte sie sich von ihr ab und richtete ihre Worte an die am Tisch sitzenden Magier.
„Magier des unsichtbaren Turms“, sagte sie, „ich möchte keinen Streit mit Euch. Ich werde bald wieder verschwunden sein und Euch unbehelligt lassen, wenn Ihr meinen Bitten nachkommt. Gebt mir mein Schiff zurück mit seinen vierzehn Passagieren.“
„Nun“, setzte Arn mit einer gedehnten Silbe ein, „ich denke, dass wir dieser Forderung nachkommen können, sofern sich mit ausreichender Sicherheit feststellen lässt, dass dieses Schiff tatsächlich Eures ist. Wir hatten mit den Leuten, die dieses Schiff hierher gebracht haben, ohnehin schon gewisse Schwierigkeiten, also bin ich geneigt, Euren Worten Glauben zu schenken.“
„Ich habe noch eine weitere Forderung“, brachte Teresa das aufkommende Gemurmel der Magier wieder zum Verstummen. Ohne sich umzudrehen, deutete sie mit dem Finger hinter sich, wo Miriam stand. „Ich möchte das Monokel, das sie trägt.“
Auf einigen Gesichtern war ungläubiges Erstaunen getreten, Sigurd hatte zornig aufgeschnaubt, aber einige andere hatten laut gelacht, und auch auf das Gesicht der grauhaarigen Manel war ein Schmunzeln getreten.
„Ich glaube nicht, dass wir Eurer zweiten Forderung nachkommen können“, sagte sie mit spöttisch erhobener Augenbraue. „Ihr werdet Euch wohl ein anderes Spielzeug suchen müssen.“
„Offenbar wisst Ihr nicht, mit wem Ihr sprecht.“ Teresa beugte sich vor, und kaum hatte sie die Hand auf den Tisch gelegt, da war er plötzlich verschwunden – und im gleichen Moment wieder aufgetaucht, vier Schritte höher, direkt unter der Decke. Bevor die Magier begriffen, was geschah, fiel ihnen der massive Tisch wieder entgegen und kam donnernd auf dem Boden auf. Ein deutlich sichtbarer Riss zog sich über die Oberfläche der Tischplatte.
Teresa trat einen Schritt zurück und schaute in die teils betont unbeeindruckten, teils offen entsetzten Blicke der Magier, von denen einige von ihren Stühlen aufgesprungen waren. Über mehreren Händen waren Feuerbälle und Eiskristalle erschienen, die drohend auf Teresa gerichtet waren. Der Magier mit dem Schnauzbart, der sich bis vor wenigen Sekunden noch auf der Tischplatte aufgelehnt hatte, war zu Boden gefallen und krabbelte sichtlich beeindruckt wieder unter dem Tisch hervor.
„Es muss einige von Euch geben, die von meinen Meistern gelesen haben. Von den Herren der Pyramiden. Noch trage ich nicht das rote Band, von dem Ihr gelesen haben mögt, noch seht Ihr meine eigenen und keine goldenen Zähne in meinem Mund. Noch besitze ich nur einen Teil der Macht, über die mein Meister gebietet, aber Ihr habt selbst gesehen, was diese Macht ausrichten kann. Und solltet Ihr meinen Forderungen nicht nachkommen, dann wird mein Meister auf diesen Turm aufmerksam werden. Mein Meister, der mich mit einer bloßen Berührung hierher gebracht hat – unmittelbar ins Innere Eures unsichtbaren Turms, dessen Eingänge Ihr so gut zu kennen glaubtet. Ein Mann, dem die Zeit selbst Untertan ist.“
Die Worte erreichten Miriams Ohren wie aus einem anderen Leben. Alles war plötzlich so schnell gegangen, dass sie das Gefühl hatte, sie selbst wäre anstelle des Tisches von der Decke gefallen. Der einzige klare Gedanke, den sie fassen konnte, war die felsenfeste Gewissheit, dass sie das Monokel nicht hergeben durfte. So schwarz und leblos es war, sie durfte es nicht hergeben. An niemanden, und um gar nichts in der Welt an Teresa.
„Ihr könnt das Schiff haben“, sagte Arn, dessen glatter Tonfall plötzlich sehr bemüht klang. „Nehmt es, und nehmt alle mit Euch, die an Bord sind. Aber bitte versteht, dass uns das Monokel sehr wichtig ist. Wir können es unter keinen Umständen hergeben. Unter gar keinen Umständen, so leid es uns tut.“
„Ihr werdet Euch wünschen, eine andere Entscheidung getroffen zu haben“, entgegnete Teresa. „Denn wenn mein Meister an diesen Ort kommt, dann wird nichts bleiben, wo es war und wann es war. Dann wird alles in diesem Turm auseinander gehen, in alle Richtungen und in alle Zeiten auseinander gehen. Meinen Meister kostet es nichts als eine Berührung. Euch kostet es alles.“
Miriam sah, wie Arn zu einer Erwiderung ansetzte, sie vernahm auch die Worte, die er sprach – aber sie hörte nicht mehr hin. Denn etwas hatte sie erreicht.
Eine Botschaft.
Sie glaubte, dass ihr Herz für einen Moment aussetzte, als sie das Bild sah.
Nicht sie, dachte sie. Nein... nicht an sie...
Aber dann wurde das Bild hinter dem schwarzen Glas deutlicher, die Konturen zeichneten sich klar vor ihren Augen ab. Es war Teresa, ja, aber sie war nicht als die nächste Trägerin des Monokels bestimmt.
Jetzt sah sie die gleichmäßige Struktur des Bodens, auf dem diese Teresa lag.
Sie sah die unnatürlich krumme Haltung ihrer Beine.
Sie sah den leeren Blick ihrer Augen.
Und sie sah die klaffende, blutende Wunde auf ihrer Stirn.
Es war eine tote Teresa, die sie im Monokel sah.
Eine getötete Teresa.
 Berechtigungen
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
|







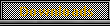



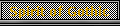










 World of Players
World of Players
 [Story]Glas
[Story]Glas









