-
 [Story]Frohe Weihnachten
[Story]Frohe Weihnachten
Als die rasende Wut des Schneesturms ihren Höhepunkt fast erreicht hatte und die Häuserfronten entlang der Hauptstraße nur noch als geisterhafte Schemen durch den immer dichter fallenden Schleier der Schneeflocken zu sehen waren, beendete Karrypto, Vorsitzender des Arkanums der Hohen Kirche Innos’, die erste Vortragsreihe des Tages mit einem Segenswunsch für König Rhobar II. Die Magier, die aus allen Teilen des Reiches angereist waren – nicht allein Diener Innos’, sondern auch Wassermagier und sogar einige dunkel gewandete Magier der Assassinen, erhoben sich von ihren Plätzen und verneigten sich. Es war ein Bild tiefen Friedens. Mochte der Krieg gegen die Orks im Norden auch seine blutigste Phase erreicht haben, mochte der Sturm das ganze Land unter Schneewehen begraben – hier drinnen war nichts davon zu spüren.
„Was hältst du von der Aufzeichnung eines Gedanken mit Hilfe dieses neuen Enzephalographen, den Karrypto vorgestellt hat?“ fragte Amul von Bakaresh seinen aus Khorinis angereisten Studienfreund Marduk. Sie hatten einander vor vielen Jahren an der Akademie von Faring kennengelernt, und obwohl sich ihre Wege getrennt hatten, waren sie einander immer noch freundschaftlich verbunden. Nun strebten sie durch eine von Kohlebecken beheizte Säulenflucht dem Ausgang der königlichen Akademie entgegen.
„Ein Gedanke ist nichts als eine Wellenschwingung, die mit feinmagischem Instrumentarium ohne Weiteres aufzuzeichnen ist. Daran ist nichts Zweifelhaftes.“
„Ich weiß, man kann es aufzeichnen und erklären, aber ich glaube nicht daran.“
Marduk lachte trocken auf. „Das ist keine Frage des Glaubens, Amul. Das ist Magie, Wissenschaft…“
„Ich kann nicht glauben, dass die klaren Gedanken eines Haran Ho oder die Empfindungen Finns messbare Wellen sein können.“ Er atmete hörbar aus und fuhr fort: „Vielleicht liegt es daran, dass wir Assassinen ein zutiefst religiöses Volk sind. Ich zweifle nicht am göttlichen Ursprung unseres Königs Zuben, und für diesen Glauben lebe und sterbe ich.“
Marduk sah Amul fragend an, und Amul fuhr fort: „Im Schrein von Bakaresh werden Asche und Gebeine aller für Varant gefallenen Krieger aufbewahrt. Der Abschiedsgruß unserer Soldaten lautet ‚Khoda hafez Bakaresh’, ‚Auf Wiedersehen in Bakaresh’. Ich habe selbst drei Neffen dort.“
Er schwieg eine Zeit lang und sagte dann: „Gewiss scheint dir unser Land verwunderlich. Wir sind der Sonne und dem endlosen Sand ausgeliefert. Die Natur ist Teil unseres Lebens, so wie unsere Häuser nur Teil unserer Gärten sind. Wir bemühen uns nicht, die Natur zu bezwingen, und niemand bekämpft die Winterkälte mit Ofenwärme. Einer unserer Dichter hat gesagt: ‚Das Feuer hat mir mein Haus geraubt. Nun kann ich mich ganz dem Mond hingeben.’ Niemand wird Varant je begreifen, wenn er nicht unsere Hingabe an die Elemente begreift. Der Tod ist für uns ein Teil der Natur, so wie der Krieg. Wir verneigen uns vor Beliar und vor der Sonne gleichermaßen.“
Sie hatten den Ausgang der Akademie erreicht und sahen in das Schneetreiben hinaus. Der Wind zerrte an ihren Gewändern, und Marduk zog seine Robe fest um seinen Körper.
„Woran glaubst du?“, fragte Amul, den Schneeflocken wie Nachtfalter umwirbelten. Als Marduk zu einer Antwort ansetzen wollte, kam ihm der Assassine zuvor: „Darf ich dich morgen vor Sonnenuntergang zum Tee bitten?“
Das Haus, in dem Amul für die Dauer des Arkanen Kongresses untergebracht war, lag an einem sanften Hang in einem Garten zwischen großen, glatten Felsen, die über und über von Schnee bedeckt waren. Als Marduk seine offizielle Robe mit einem Gewand aus feinster Varantiner Seide vertauscht und sich seiner Straßenschuhe entledigt hatte, wurde er in den Wohnraum geführt. Es gab keine Möbel außer einem niedrigen Tisch, eine Vase mit üppigen Ornamenten war der einzige Schmuck. Nach dem zeremoniell der Teezubereitung begann Amul mit seinem Gast ein Gespräch über den Krieg und die politische Lage. Er erzählte von einem Assassinenführer, der den Fürsten eines mächtigen Nomadenstammes einst um Beistand bei der Eroberung Myrtanas bat. Der Nomadenfürst hatte geantwortet: „Du willst Myrtana erobern? Dann bist du die Muschel, die den Ozean ausschöpfen will.“
Marduk begann, sich ein wenig zu langweilen, als der Assassine unvermittelt fragte: „Hast du je von den Ainus gehört?“ Als der Feuermagier verneinte, fuhr Amul fort: „Die Völker der Wüste halten den Löwen für den Mittler zwischen Diesseits und Jenseits. Dieser Glaube ist uralt. Das Leben ist nur kurz, und in der knappen Zeitspanne zwischen Geburt und Tod vermag der Mensch nicht vieles zu erfahren. Gäbe es nicht die Verbindung zu den Seelen der Ahnen und der Allheit der Götter, so wäre das Leben sinnlos.“
„Wie sollte denn diese Verbindung zustande kommen?“ fragte Marduk. In seinen Büchern zumindest stand nichts darüber.
„Dafür ist der Löwe da, sagen die Ainus. Sie sind die Vorfahren der Assassinen, und einige Stämme leben heute noch in der unendlichen Wüste Varants. Ihr größtes Fest ist das ‚Iyomande’, die Heimsendung der Seele des heiligen Löwen: Der Löwe wird gequält und in einem blutigen Zeremoniell getötet. Dabei wird er an ein Holzkreuz gebunden. Beginnt er zu sterben, wird er durch einen Lanzenstich ins Herz erlöst, während der Priester die Worte spricht: Wir senden dich Heim zu deinem Vater. Wenn du dort bist, sprich gut von uns. Steh uns bei in aller Not.“
Marduk sah Ainu mit unverhohlenem Grauen an. Von solch barbarischen Opferriten hatte er durchaus gehört, aber…
„Das Blut des Löwen wird aus einem Kelch getrunken, und so werden die Menschen durch das Leiden und den Tod einer unschuldigen Kreatur mit ihrem Schöpfer und Vater versöhnt. Der Löwe heißt ‚Nabiy’, Prophet.“
Marduk runzelte die Stirn. „Warum erzählst du mir das alles? Ich muss jetzt leider…“
Bei diesen Worten erhob er sich, aber Amul hielt ihn am Arm zurück. Marduk setzte sich ergeben und sah dem Assassinen dabei zu, wie dieser seinen Tee austrank. Dann sagte Amul: „In meinem Gefolge ist ein Mann, den meine Diener in Gewahrsam genommen haben. Es ist ein Mann aus deinem Volk, und ich weiß nicht, was ich mit ihm tun soll. Er kam vor einigen Tagen in mein Haus und verlangte dringend eine Audienz. Er nennt sich ‚Nabiy’ und behauptet, er sei der Sohn Innos’. Er habe, so sagte er, den Waffendienst verweigert und König Rhobar II beleidigt, so dass ihn der königliche Gerichtshof als Fahnenflüchtling und Verräter zum Tode verurteilt hat. Er bat mich, ihn anzuhören und mit nach Varant zu nehmen. Bis morgen Abend muss ich eine Entscheidung treffen: liefere ich ihn aus oder nehme ich ihn mit mir? Du bist ein kluger Mann, und du bist Myrtaner. Würdest du mir dabei helfen?“
„Dazu müsste ich den Mann sehen.“
„Darum wollte ich dich gerade bitten.“
Durch einen Sehschlitz in der Tür konnte Marduk den Mann beobachten, ohne von ihm gesehen zu werden. Er stand unter dem flackernden Licht einer Öllampe und starrte aus dem fenster in das Schneetreiben. Seine Lippen formten unausgesprochene Worte, und in seinen Augen brannte ein fiebriges Feuer. Das hagere Gesicht war hart und leichenfahl unter dem weichen, blauschwarzen Haar.
Marduk musterte ihn mit wachsendem Interesse. Er las sich noch einmal die Anklageschrift durch, die Amul ihm überreicht hatte „Ich möchte den Mann gerne sprechen.“
Als sie den Raum betraten, wandte der Mann ihnen das Gesicht zu, ohne seine Haltung zu verändern. Eine raubtierhafte Selbstsicherheit ging von ihm aus, die Selbstsicherheit eines Menschen, der nur an sich und seine Mission glaubt. Marduk wusste sofort, was er da vor sich hatte: Dieser Mann gehörte zu jenen Menschen, die die Kirche Innos’ als Heilige verehrte oder als Ketzter verbrannte. Zwischen diesen beiden Polen gab es für sie keinen Platz im menschlichen Gefüge.
„Wer bist du?“ fragte er den Mann.
„Ich bin Nabiy, das Licht der Welt, der Sohn Gottes.“
„Der Sohn welchen Gottes?“
„Es gibt nur den einen Gott.“
„Du erwartest von uns, dass wir dir glauben?“
„Alle Dinge sind denen möglich, die glauben“, antwortete der Mann lächelnd.
„Warum hast du König Rhobar beleidigt?“
„Ich habe ihn nicht beleidigt“, antwortete der Mann mit demselben sanften Lächeln. „Ich habe gesagt: ‚Gebt Gott, was Gottes ist, und dem König, was des Königs ist.’“
Marduk warf einen Blick auf das Pergament mit der Anklage, suchte eine Weile und fragte weiter: „Du hast den Menschen gesagt, dass der König nicht göttlichen Ursprungs sei. Und vor allem hast du versucht, den Kampfgeist der Menschen zu untergraben!“
„Ich habe gesagt: ‚Liebet eure Feinde’.“
Marduk schnaubte. Das sanfte Lächeln auf den harten Zügen des Mannes machte ihn wütend.
„Du bist ein Feigling. Du hast den Aufruf zu den Waffen verweigert!“
„Selig sind die Friedfertigen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Selig sind die…“
„Wie kannst du so vermessen sein?“ herrschte Marduk ihn an.
„Mein Reich ist nicht von dieser Welt“, fuhr der Mann in einem sanften Singsang fort. Er schien nun mehr mit sich selbst zu sprechen als mit den Magiern, die vor ihm standen. „Der Nabiy ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein leben zu geben als Bezahlung für viele…“
Marduk söhnte innerlich auf. Im Norden starben die Paladine Innos’ unter den Krushs der Orks, und dieser Sohn Gottes sprach von Frieden. Er wandte sich zu Amul und sagte: „Ich halte ihn für verantwortlich für das, was er sagt. Seine Antworten sind folgerichtig. Er redet dunkel, aber ich glaube, dass seine Worte beim Bodensatz der Bevölkerung Gehör finden könnten. Er ist gefährlich. Du solltest ihn nicht mit dir nehmen. Liefere ihn aus.“
Amul zögerte. „Unsere Entscheidung ist sein Todesurteil. Ich habe sie mir nicht leicht gemacht, bei Beliar!“
Als sie bereits wieder im Wohnraum des Assassinen angekommen waren, fragte dieser: „Und wenn er nun wirklich der Nabiy ist, der Sohn Gottes?“
Marduk lachte auf, und zum ersten Mal an diesem Tag war es ein heiteres Lachen. „Dann bin ich der Kaiser von Varant.“
Am nächsten Tag brachte man den Mann in das Zuchthaus von Vengard. Dort wurde er hingerichtet. Um die neunte Stunde schrie er laut auf und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten, und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf.
Geändert von MiMo (30.03.2017 um 14:58 Uhr)
-
Sonderbare Gastfreundschaft
Es tragen sich mitunter recht sonderbare Begebenheiten zu, gewissermaßen unerhörte Ereignisse, wie man sie nur der Einbildungskraft eines gar allzu kecken Lügners, oder eines laienhaften Dichters entsprungen zu sein vermutet. Nicht aber, so wird man meinen, könne dergleichen tatsächlich sich ereignet haben, widerspreche es doch jeglicher Wahrscheinlichkeit. Doch hat Wahrscheinlichkeit die recht merkwürdige Eigenart, sich zwar einen Anschein von Gesetzmäßigkeit wohl zu geben, ohne aber wahrhaftige Notwendigkeit in sich zu befassen. Sei die Wahrscheinlichkeit also auch noch so gering: Nichts hinderte, dass es sei.
Und so mögest Du, geneigter Leser, Dich in Anbetracht der Geschichte, die nun folget, nicht verächtlich abwenden, dem Anscheine nach von Vernunftgründen gestützet: “Lug und Trug, damit haben wir’s hier wohl zu tun! Und nichtmal schlau erdacht!” Denn wahrlich: Es hat sich alles im Detail so zugetragen, wie ich’s Dir nun berichten werde, werter Leser.
So gib denn Acht und lerne, zu entdecken, welch Wunder sich auf Adanos’ Welt tummeln, zu staunen und den Geist zu öffnen! Denn auch Dir könnte dergleichen wohl einst widerfahren.
Es betrug sich also, und dies war im Jahre des Feuers 413, zur Zeit also unsres guten Königs Wenzloch IV., dass sich der Held unsrer Geschichte über hohe Berge von Schnee kämpfte, durch eisige Kälte und unterm Grau eines wolkenverhangenen Himmels, aus dem es unablässig weiter schneite, dass die Fußabdrücke unsres Helden bald schon wieder verblassten, kaum dass er sie in die weiße Decke gestapft hatte. Der Schnee fiel so dicht, in so dicken Flocken, dass die Sicht kaum zehn Meter weit reichte, und der Wind trieb die Kälte in alle Spalten und Öffnungen der dicken Kleidung: Die Füße spürte er freilich schon lange nicht mehr. Die Hände, trotz der dicken Fäustlinge nur unzureichend wider die Eiseskälte geschützt, waren unter die Achseln geklemmt, der kapuzenverhangene und mit dicken Tüchern umwickelte Kopf zwischen die Schultern gezogen. Der Schnee beklebte allenthalben die dicken Felle, dass sich die Gestalt des Wandrers kaum mehr vor Untergrund und Schneesturm abhob.
Regibor wusste nicht mehr, wie lange er schon einher schritt. Jegliches Zeitgefühl war ihm abhanden gekommen. Die Sonne, des Wandrer’s bester und schier allgegenwärtiger Zeitanzeiger, war an diesem Tage freilich nicht zu sehen. Das einzige, was sich zu ändern schien, waren kleine Nuancen in der Helligkeit des Graus, welches Regibor nach allen Richtungen hin umgab. Und ohne Sonne, ohne Sicht, ohne Magnetstein, wie sollte man da wohl auf dem rechten Wege zu bleiben wissen? Wahrlich, nicht nur die Zeit, auch die Richtung hatte er lange schon verloren.
Und doch: Er schleppte sich vorwärts. Etwas anderes konnte er nicht. Innehalten war unmöglich, wollte er nicht elendiglich erfrieren. Einzig die Hoffnung darauf, aus Zufall auf eine Höhle zu treffen, eine Hütte inmitten der Wildnis, irgendeinen Schutz wider Wind und Wetter, trieben Regibor noch an. Eine Hoffnung, die mit jedem Schritt zu schwinden schien.
“Es ist unwahrscheinlich. Seit Stunden stapfe ich hier durch den Schnee. Hier draußen gibt es nichts und niemanden. Nur Bäume und Eis. Keine Hütte, keine Höhle. Ich bin verloren…”
Doch Regibor gab nicht auf. Sein Verstand sagte ihm, dass er verloren sei. Doch sein Herz schrie die Stimme der Vernunft nieder. Die kalte Angst drängte ihn vorwärts. Ebenso sein Stolz, sein Wille, zu überleben. Und mehr noch: Sein Wille, das Ziel zu erreichen, das ihn zu jenem Unterfangen getrieben hatte.
Was dies wohl für ein Unterfangen sein mag? Der Leser wird sich dies unweigerlich fragen, an dieser Stelle. Und in der Tat: Wer wäre ich, Deine Wünsche, oh Leser, so mir nichts Dir nichts einfach zu verachten?
So höre nun! Die Absicht, die Regibor in diese missliche Lage gebracht, hatte ihn bereits in einer Reise quer durchs winterliche Myrtana geführt. In Geldern, der goldnen und prächtigen Stadt weit im Südwesten war er aufgebrochen, über Silden und weitere kleine Ortschaften stetig gen Norden, hinein ins eisige Gebirge, auf dem Wege nach Nordmar. Nun kämpfte er sich den Berg hinan, den Pass zu durchqueren, und das raue Land des Nordens zu betreten. Ein Unterfangen, welches schon des Sommers schwierig, Winters jedoch nahezu unmöglich war. Doch Regibor versuchte es gleichwohl. Denn auch in Nordmar führte ihn sein Ziel weiter nordwärts, bis hin zum nördlichsten Zipfel der bekannten Welt, der letzten Bastion der Zivilisation: Dem heiligen Kloster der Brüder des Flammenstrauchs, des großen Klosters der Feuermagier zu Nordmar, dessen Bekanntschaft und Ruhm in jenen Tagen noch größer war denn heute, damals, als die Bibliothek des heiligen Ortes noch als die größte der Welt galt, und die heiligsten Reliquien der Götter den Mönchen und Magiern zur Aufbewahrung anvertraut waren.
Regibor also strebte jenem Kloster zu, und seine Mission war von recht heiliger Natur, denn auf seiner Haut, tief unter den Schichten aus Fell, Stoff und Leder verborgen, wider Kälte und Nässe geschützt, trug er pergamentenes Leder. Säuberlich zusammengefaltet, mit Unterschrift und Siegel von höchster Stelle: “Glaukon, Erzbischof zu Geldern, hoher Magier des Feuers” etc. pp; und der Brief, den Regibor trug, war für den ehrwürdigen Abt den Klosters bestimmt.
Nun, wes Inhalts der Brief war, welch wichtige Korrespondenz unser guter Regibor nun zutrug, dies ist für uns heute nicht weiter von Belang. Nur, dass es von recht großer spiritueller Wichtigkeit war, dann Pflichtgefühl und guter Glaube Regibor vorantrieben, und die Überzeugung, dem Herren Innos, der da ist Himmel, einen Dienst zu erweisen.
Wenn auch einen ziemlich unangenehmen.
In Anbetracht der Situation wirst Du Dir wohl denken können, guter Leser, dass das Feuer des Glaubens und die Treue des Novizen sich in Regibors Herzen erheblich abgekühlt hatten. Wortwörtlich. Die Pflicht war ja schön und gut, aber jetzt in der Residenz des Erzbischofs das Herdfeuer zu schüren, und mit den Zehen wackeln zu können, ja, sich ihrer tatsächlich als Leibesteile bewusst zu sein - das wäre noch schöner und besser!
Doch die Wahl des Kirchenfürsten war nun mal auf Regibor gefallen. Und Widerworte gab es nicht.
Gewiss hätte Regibor nicht nur seinen irdischen, sondern auch den Herrn im Himmel lästerlich verflucht. Allein - und dies mag wohl sein Glück gewesen sein! - ihm fehlte die Kraft dazu. Kein Wort entäußerte sich seinen Lippen, und der einzige Gedanke, den sein Gemüt unablässig produzierte, war: “Weitergehen!” Mit Ausrufezeichen und im Befehlstone.
Soweit also die Situation, und bislang magst Du Dich wundern, was denn nun so unwahrscheinlich an alldem sein möge: Novizen werden alle Tage als Boten entsandt, dass die höhren Vertreter des guten Gottes nur die eignen Füße nicht bemühen müssen, und auch auf die Jahreszeit wird hierbei erstaunlich wenig Acht gehabt. Und Regibor wäre wohl der weder erste, noch auch der letzte gewesen, den ein solcher Auftrag in die Hallen des Herrn geschickt hätte.
Unerhört aber beginnt es erst jetzt zu werden.
Denn Regibor gelangte weder in das jenseitige Reich Innos’, noch in dasjenige irgendeines andern Gottes.
Ja, Regibor überlebte. Und wie er überlebte!
Er hinterließ also kurzzeitige Spuren im Schnee, der seinen Schritten üblen Widerstand bot. Bis zu den Knien reichte ihm das ekle Kalt, und kaum kam er vorwärts. Und noch einen Schritt tat er, mühevoll und fast am Ende seiner Kräfte angelangt. Und noch tiefer sackte er in den Schnee. Bis zum Knie? Nein. Bis zum Oberschenkel? Weit gefehlt! Brust? Ach was! Eh man sich’s versah, war Regibor verschwunden. Von der buchstäblich schneeweißen Decke buchstäblich verschluckt. Kaum eine Mulde zeigte noch an, dass hier vor Sekunden noch ein Wanderer einhergegangen war. Und wenige Minuten später hatte das Schneetreiben alle Spuren Regibors vom Antlitz des Morgrad getilgt.
Wo war Regibor hin?
Nun, er wusste es selbst nicht so genau. Irgendwie, so hatte es ihm geschienen, war der Vorhang fallender Flocken plötzlich dichter geworden. Um einiges dichter, um es genau zu sagen. So dicht, dass da plötzlich - nicht etwa eine weiße, auch keine graue, sondern vielmehr eine Wand aus Schwärze war.
Und sonst?
Wäre Regibors Körper nicht so ganz und gar durch die Kälte betäubt gewesen, er hätte sich wohl fallen gespürt. So aber nahm er kaum wahr, wie ihm geschah. Erst, als er auf einem weichen, weißen Kissen eisiger Kristalle landete, die seinem Körpergewicht zuvor nachgegeben hatten, begann er, sich langsam wieder zu orientieren.
“Ich liege“, dachte er. “Auf einem Kissen aus Schnee. Ganz nett, oder? Zumindest fühle mich nicht kälter als zuvor.” Im Grunde fühlte er sich gar nicht mehr. Weder kalt, noch sonst wie. “Eine Höhle”, dachte Regibor weiter, und Du liegst durchaus recht in der Annahme, wenn Du meinst, dass Regibors Denken dort nicht besonders tiefsinnig oder gar rasch vonstatten ging. “Da vor mir öffnet sich ein Gang, aus dem irgendwie Licht kommt. Darum kann ich wohl sehen.” Nunja, Regibors Denken fasste halt erstmal das Offensichtliche zusammen. Und tat - wie der Mann im Ganzen - dann erstmal nichts.
Doch schließlich gelang es Denken und Körper, sich doch noch irgendwie aufzurappeln. Nicht, dass Regibor plötzlich angefangen hätte, wieder ein Gefühl für seinen Körper zu entwickeln; dies nämlich sollte erst etwas später kommen.
Einerlei, er wusste sich so weit zusammenzunehmen, dass er sich aus dem Schneehäufchen, darinnen er lag, freistrampelte und daraus erhob. Und der unregelmäßigen Öffnung zuwankte, aus der sich gelbes Licht in die Kammer ergoss, in der sich unser Held nun befand.
“Ich muss durch ein Loch in eine unterirdische Höhle gefallen sein. Ich bin durch den Schnee eingebrochen, und der hat dann meinen Sturz gedämpft.” Regibor wandte sich zu dem Haufen um, dem er soeben entstiegen war. Bei der schieren Menge schauderte ihn: Der Schnee dort droben, von wo er grad gekommen, musste nachgerade meterhoch das Land bedecken!
Da er aber nicht gerade den Wunsch verspürte, sich dem winterlichen Treiben wieder auszusetzen, und es wohl ohnehin nicht vermocht hätte, fehlte ihm doch das Kletterwerkzeug, den Ausgang der Höhle zu erklimmen, lenkte er seine Schritte wieder dem Kavernenausgang zu.
Dorthin, woher das Licht kam.
Die Höhle also mündete in einen Gang, und dieser schien aus nacktem Felsen zu bestehen, der einen bestenfalls grob behauenen Eindruck machte, dass er einigermaßen regelmäßig erschien, einem erwachsnen Manne gute Passage bot, und ebnen Bodens keine üblen Stolperfallen barg.
Und da endlich geschah, womit Regibor niemals mehr gerechnet hätte.
Seine Füße begannen, ihm weh zu tun.
Überhaupt ergriff ein wohliger Schmerz von seinem ganzen Körper Besitz, und erst jetzt, da er, dem Bogen des Ganges folgend, sich wärmern Gefilden der Höhle näherte, kehrte das Gefühl der Kälte in seine Glieder zurück. Dann andre Empfindungen, die seinen Geist belebten und gar freudig empfangen wurden: Das Stechen in Füßen und Händen, das Ziehen auf Wange und Ohren, das Kribbeln in Waden und Lunge. Ja, selbst das Laufen seiner Nase begann Regibor wieder zu spüren, so entfernte er zuerst die Lumpen, die von seinem Antlitze bloß noch die Augen hatten frei gelassen, und dann den eklen Rotz von der Nas, befreite das Haupt von der Kapuze, die Hände von den Fäustlingen, und hauchte beherzt auf seine Finger, genoss das Gefühl, wieder ein körperliches Wesen zu sein, und nicht bloß Gedanke ans Laufen, bloß Akt des Gehens und des Setzens von Schritt auf Schritt.
Während er nun dem Gange folgte, umhüllte ihn die umgebende Luft mit immer größrer Wärme, dass er sich Schicht um Schicht seiner Kleidung öffnete und langsam daraus schälte. Das Eis, das die Felle bedeckt hatte, tropfte schon längst zu Boden, bildete eine Spur, die auf dem Höhlenboden langsam trocknete. Das Weiß war dem Braun der unansehnlichen aber warmen Kleidung gewichen.
Schließlich erreiche Regibor das Ende des Ganges, der sich zu einer weiten Kaverne hin öffnete, die gut drei Mal so groß sein mochte, wie die vorherige. Mit einem Plump ließ Regibor sein Fellbündel zu Boden fallen, und bestaunte, was sich ihm darbot:
Die Höhle war von annähernd rechteckiger und länglicher Gestalt, und mochte gut sechzig Meter in der Länge betragen, in der Breite aber bloß dreißig. Die Decke indes, welche unregelmäßig geformt war, und gar nicht so eben, wie der ordentliche Boden, hätte einem Oger oder Troll hinlänglichen Platz geboten. Das Licht, so erkannte Regibor nun, kam - ebenso, wie die Wärme - von einem großen Kamin an der langen Seite der Halle, in dem ein großes und fröhliches Feuer prasselte. Davor befand sich eine kleine Sitzgruppe mit behaglichem Sessel, und anders, als es Regibor gewohnt war, bedeckten nicht Binsen oder Stroh den Boden, sondern flauschige Teppiche in komplizierten, verschlungenen Mustern aus rot und gold, blau und grün. Einige stellten allerlei Motive dar, darunter exotische Tiere, welche Regibor nicht zu erkennen vermochte: Darunter waren Löwen und Pfauen, Gazellen und Giraffen, wie Du, guter Leser, wohl hättest erkennen können. Aber auch gänzlich phantastische Wesen, wie Satyren und Nixen, Nymphen und Dryaden, die nackend durch Wälder - oder aufeinander - sprangen. Hier lugte ein Teufelchen auf der einen Seite des Baumes hervor, den Schwanz auf der andren keck emporgereckt, und betrachtete lüstern nackte Schönheiten im idyllischen See. Dort räkelte sich eine Barbusige, den Schoß nur vom Feigenblatte bedeckt, und ließ sich mit Weinbeeren und andrem Gaumenschmause von jenem Faunus füttern, der halb auf, halb neben ihr auf grünem Gräserbette lag, und dessen Lust nicht einmal ansatzweise verborgen war.
Auch sonst war die Höhle trefflich eingerichtet: Ein fein gedeckter Tisch in der einen Ecke, mit gedrechselten Stühlen dunklen Holzes umgeben; Reihen von Büchern an den Wänden, wo nicht gerade Gobelins und Ölgemälde hingen. Weitre Sitzecken, Schreibtische, auch alchemistisches Gerät, wie’s Regibor von seinem Meister daheim in Geldern kannte. Eine Wohnhöhle also, deren Mobiliar wohl dem ein oder andern Fürsten und König die Stolzesröte in Gesicht zu treiben vermöchte.
Für Regibor war’s, in jenem Augenblicke, nach der entbehrungsreichen Reise, wie’s Paradies.
So blickte unser Held sich um, ob denn nicht der Herr des “Hauses” vielleicht zugegen sei. An zwei weitern Stellen führten weitere Gänge wer weiß wohin. Doch von einem Bewohner keine Spur.
“Besonders weit werden die Bewohner nicht weg sein”, dachte sich Regibor. Ein Zeichen, dass auch sein Hirn nunmehro wieder zu tauen begann, denn freilich musste er recht haben: Kaminfeuer und Kerzen mussten vor nicht allzu langer Zeit entzündet worden sein.
Regibor ließ Mantel und Felle achtlos im Eingange liegen, und trat weiter in den Raum hinein. Nachdem Kälte und Schmerz abgeklungen waren, machte sich nunmehr Müdigkeit in seinen Gliedern breit, und die Anstrengung des Wegs wurde ihm mit aller Macht bewusst. Doch wollte er sich nicht so mir nichts, Dir nichts in ein Sofa fläzen. Vielmehr befiel ihn eine gewisse Sorge, die Einwohner der Höhle betreffend. Nur ungern ließe er sich schlafenderweise überraschen, und Du wirst ihn für diese Umsicht gewiss loben.
Vor der Ruhe also, sollte eine Erkundung der Lokalität her.
Regibor hatte sich von den beiden Gängen, welche noch aus dem Raume führten, gerade für den linken entschieden, und diesen beinahe erreicht, als er rechterhand ein Schlurfen vernahm. Angespannt wandte er sich dem andern Gange zu, und siehe da: Schon bald erschien eine Gestalt, gemütlich einherschlendernd, in einen bunten, seidenen Mantel gehüllt, der sich vorne überlappte und mit einem Gürtel zugebunden war. Unter dem Saum schauten flauschige Pantöffelchen hervor. Die Gestalt - sie war männlich - war von kleinem aber schlankem Wuchs, und hatte schulterlanges, schwarzes Haar, das in feuchten Locken wirr herabfiel. Das Alter des Mannes vermochte Regibor nicht so recht einzuschätzen, doch vermutete er, der Fremde sei so an die dreißig Jahr, vielleicht älter. Die Augen des Fremden glänzten in klarem Grau, und Regibor fand den Blick, ehrlich gesagt, ein wenig schauerlich.
Der Fremde aber zeigte weder Verwunderung, noch besondre Aggression. Stattdessen aber Benehmen: “Grüß Gott, Freund Wandrer, sei willkommen in meinem Hause!” Regibor furchte seine Stirn zu kleinen Runzeln. “Welchen Gott soll ich denn grüßen, Hausherr?” Der Fremde lachte leise: “Sollte ich besser wissen, zu wem Du betest, als Du selbst?” Der Hausherr trat weitere Schritte vor, doch betrachtete er Regibor bloß aus seinen klaren, hellen Augen. “Wer seid Ihr?”, fragte Regibor schließlich, und entschied sich dabei für die förmliche Anrede, die sonst nur den hohen Herrschaften bei Hofe, oder den Vertretern des Herrn Innos vorbehalten bleibt. “Eigentlich sollte das wohl eher ICH Fragen, als Hausherr, nicht wahr, Freund Wandrer?“ Antwortete der Fremde prompt: “Aber ich bin Graf Melchior von und zum Pass.” Das Lächeln war milde und ohne Arg. “Ich nehme an, Du wurdest vom Schneesturm überrascht, beim reichlich törichten Versuch, den Pass gen Nordmar zu überqueren?” Regibors Stirn furchte sich weiter, und eine steile Falte begann sie zu teilen, einem trocknen Flussbette gleich. Der Tonfall machte durchaus klar, dass der Fremde keine Antwort auf die Frage erwartete.
Und so sparte sich Regibor eine solche: “Ich habe, Euer Hochwohlgeboren, noch niemals von einem solchen Titel vernommen.” Sagte er stattdessen, mit durchaus skeptischem Tonfalle. Und in der Tat: Er glaubte dem Fremden, was den Titel betraf, kein Wort: “Ich wusste gar nicht, dass der Pass eine Grafschaft sei?” Der Fremde aber lachte nur wieder: “Aber Freund Wanderer, was wunder, dass Du davon nie gehört hast, handelt sich’s doch um einen Titel, den ich mir selbst gegeben habe.” Die Zähne des Fremden blitzen im vergnügten Grinsen auf. “Aber schau!” Der Fremde hob die Arme zu einer Geste, welche die ganze Höhle zu umfassen schien: “Lebe ich nicht gar fürstlich hier? Und sind wir nicht durchaus direkt am Pass zwischen Myrtana und Nordmar? Du siehst also, Freund Wanderer, das ich mir den Titel `Graf von und zum Pass` ganz zu Recht gegeben habe.”
Graf von und zum Pass war Regibor ganz und gar nicht geheuer, doch einstweilen sah er keinen Grunde, irgendeinen Zwist vom Zaume zu brechen, oder gar eine seiner magischen Spruchrollen zu zücken, welche unweit des erzbischöflichen Briefes verborgen waren.
“Lebt Ihr, Hausherr, hier alleine?” Regibor suchte, die Frage beiläufig klingen zu lassen. Und betrachtete das Gesicht Melchiors eingehend. Dieser aber ließ bloß ein vergnügtes Kichern vernehmen, und ließ erneut die Zähne aufblitzen. “Gewiss wäre es einem Grafen `von und zu` höchst angemessen, eine umfangreiche Dienerschaft zu haben, und ja, es würde sicherlich so einiges bequemer machen. Allerdings…” Melchior machte eine Kunstpause, “bin ich ein Graf der eher”, erneut ein Kichern “eremitären Art.” Ein triumphierendes Funkeln der Augen, ein glückliches Lächeln. “Und außerdem will hier außer mir eh kein Schwein leben. Wir sind ja praktisch am Arsch der Welt.” Und ein ziemlich unverschämtes Grinsen.
Regibor nickte. “Ihr seid wissenschaftlich interessiert?” Sein Kopf ruckte Richtung Alchemietisch. Melchior nickte fröhlich: “Gewiss, gewiss! Ich habe ja auch sonst nichts zu tun, nicht? Also kann ich Kräuter sammeln und untersuchen, allerlei Getier erforschen, und auch ordentlich lesen. Mit eleganter Handbewegung deutete Melchior auf die Bücherregale.
“Es ist schon ein merkwürdiger Zufall, dass Du hier her gefunden hast, Freund Wanderer. Und ein glücklicher, will mich dünken, denn andernfalls wärst Du erfroren. Komm, setz Dich doch ans Feuer! Ich hole Dir derweil was zu Essen aus der Küche.” Melchior bewegte sich in jenen Gang hinein, den Regibor zuvor hatte erkunden wollen. Regibor indes zuckte mit den Schultern. Zwar blieb er wachsam - wer mochte denn auch wissen, an welch absonderlichen Zausel er geraten sein mochte - doch schien ihm keine akute Gefahr zu drohen. So setzte er sich also ans Feuer, streckte knackend die Beine aus, und machte es sich im großen Ohrensessel bequem. Kurze Zeit später kam denn auch Freund Gastgeber zurück, und trug ein Tablett mit Käse, Brot und Schinken, Weinbeeren und Kuchen, sowieso duftendem Tee vor sich her, wie man ihn sonst nur im fernen Varant zu trinken pflegt.
Melchior stellte seine Last auf einem kleinen Tischchen ab, und Regibor bediente sich der guten Speisen. Der Gastgeber übrigens auch, und das nicht zu knapp, doch war die Menge reichlich bemessen, das niemand dem andern zu neiden hatte. Das Brot war locker und warm, als sei es dem Ofen frisch entnommen (Regibor konnte sich das nicht erklären), und schmeckte nussig-herb. Der Kuchen war süß und köstlich, und mir saftigen Kirschen verfeinert. Käse und Wurst waren von bester Qualität, und nach ordentlichem Süßen mundete auch der Tee ganz vorzüglich, zumal er von innen wärmte. Wohlbehagen breitete sich in Regibors Leibe aus, und der stetig größer werdende Drang, die Äuglein zu schließen, und zu schlafen.
Doch zwang er sich, wach zu bleiben.
“Sagt mir, Euer Hochwohlgeboren von und zum Pass” der Hausherr unterbrach Regibor: “Sach’ einfach Melchior zu mir!” “Sagt mir, Melchior, woher habt Ihr derart vorzügliche Speisen?” Melchior lächelte vielsagend. Das heißt: Eigentlich war es wohl eher nichts sagend, denn irgendeinen Aufschluss gab dies Lächeln durchaus nicht, allenfalls nur, dass es mit der Antwort auf die Frage eine besondere Bewandtnis haben mochte.
“Du wirst gewiss sehr müde sein, Freund Wanderer, und ich werde Dir gerne mein Bett richten. Du wirst gewiss verstehen, dass ich hier nicht oft Besuch empfange, und das eine Gästebett kann ich Dir derzeit leider nicht zur Verfügung stellen.”
Regibor hätte sich wohl von dieser letzten Bemerkung zu weitern Gedanken genötigt fühlen müssen, doch die Trägheit erfasste seine Glieder immer mehr. So widersprach er nicht, sondern folgte dem Fremden in jenen Gang, aus dem dieser ursprünglich gekommen war. Es ging an einigen Türen vorbei, und schließlich in ein größres Schlafgemach, gleichfalls mit Kamin ausgestattet, und einem schönen, weichen Himmelbett, in dessen Federkissen zu versinken sich Regibor kaum mehr bezähmen konnte.
Du, werter Leser, wirst es einen Fehler nennen. Womöglich gar verhängnisvoll. Doch stelle Dir vor, die Entbehrungen des Regibor selbst, am eignen Leibe, gespürt zu haben! Die Anstrengungen taten das ihre, Wärme und Behaglichkeit der Höhle das Übrige, und bald schon lag Regibor in den weichen Kissen, und war bald schon entschlummert.
Geweckt wurde Regibor langsam, und schließlich vom eigenen Überdruss an Schlaf. Seine Novizenkleidung, welche er unter den Winterklamotten getragen und vor dem zu Bett gehen abgelegt hatte, lagen nunmehr gereinigt und säuberlich gefaltet auf einem edlen Stuhle mit rotem Samtpolster, der nebem dem Himmelbette stand. Das Feuer im Kamin prasselte wie eh und je, wenn auch nicht gar so groß wie jenes im großen Wohnraum. Rasch kleidete sich Regibor an, und machte sich auf den Weg, diesen wieder zu erreichen.
Als Regibor den Wohnsaal betrat, schlugen ihm der Duft von Brot und Suppe, Speck und Ei entgegen. Der Hausherr hatte auf der Tafel feinste Speisen aufgetragen, und auch Kuchen sowie allerlei Obst und Früchte standen schon zum Nachtische bereit. Regibors Magen meldete sich grummelnd zum Zeichen des Hungers.
“Komm näher, setzt Dich!” Melchior hatte sich an die lange Seite des Tisches gesetzt, und deutete auf den ihm entgegenliegenden Platz. Regibor widersprach nicht, sondern setzte sich. Melchior schaute Regibor begeistert dabei zu, wie sich dieser an den Speisen gütlich tat. “Es nützt ja nichts”, dachte dieser, “ich muss ja eh essen. Vergiftet sein wird’s schon nicht, und so übel ist dieser Herr Graf ja nun auch nicht.”
Dieser indes schaute amüsiert, ließ sich aber auch nicht lumpen, sondern haute gleichfalls mächtig rein.
“Der Sturm, Freund Wanderer, ist abgeflaut, und so wirst Du wieder aufbrechen können. Alleine, den Pass würde ich nicht überqueren, an Deiner Stelle, das schaffst Du nicht. Was immer Dich nach Nordmar führt, es muss warten. Der Pass ist zu dieser Jahreszeit gänzlich unpassierbar.” Melchior schien sich über sein Wortspiel köstlich zu amüsieren. Regibor aber schüttelte entschieden den Kopf: “Ich bin Bote und muss schnellstmöglich nach Nordmar, den Brief überbringen.” Melchior lachte, wie's für ihn typisch war: “Versuchst Du dies, kommt der Brief gar nicht an. Wie dem auch sei: Ich schlage vor, dass Du nach dem Essen erstmal ins Bad gehst, Dir gründlich den… äh, Staub der Straße abwäschst, und Dich danach wieder auf den Weg machst. Ich werde Dir ordentliche, saubere und warme Kleidung mitgeben, und auch einiges an Proviant, damit solltest Du’s zur nächsten Siedlung schaffen. Auf DIESER Seite der Berge, wohlgemerkt.”
Regibor hätte dem am liebsten zugestimmt. Alleine: Er wusste um seine Pflichten, und die mögliche Strafe des Oberen. Doch konnte diese schlimmer sein, als ein zu erwartender Kältetod?
“Warte hier, Freund Gast, und mach’s Dir nur bequem! Ich bereite Dir das Bad.”
Melchior erhob sich, und verschwand in den rechten Gang.
Regibor stand auf, und vertrat sich im Raum die Beine. Interessiert näherte er sich einer der Buchreihen. Große, lederne Folianten reckten ihm ihre Rücken entgegen, die verschlungenen Titel und kunstvollen Verzierungen aus feinstem Golde, das sich vom Einbande abhob. Er trat näher heran, zu schauen, womit sein Gastgeber sich wohl beschäftige, ob nicht ihm bekannte Werke in dieser beachtlichen Bibliothek zu finden seien: Daheim, in Geldern, pflegte Regibor seinem erzbischöflichen Oberen auch in akademischen Belangen zu helfen, und führte sogar die ein- oder andre Lesung in theoretischer Theologie.
Im Näherkommen erkannte Regibor jedoch, das ihm keins der Werke auch nur im Mindesten bekannt schien. Vielmehr: Er vermochte nicht einmal die eigentümlichen, verschlungenen Schriftzeichen zu lesen, welche ihm entgegenblickten. Mit der Hand sacht die Buchrücken entlang streichend ging er das Regal ab, und wunderte sich über die merkwürdige, ihm unbekannte Schrift.
Regibor hielt inne, machte einen Schritt zurück, und so kam seine Hand auf einem dicken, schwarzen Einbande zur Ruhe. Seine Fingerspitzen berührten die güldnen Buchstaben, die den Titel anzeigten. Diese hier vermochte er zu lesen: I.W.S.
Gar wunderlich erschien ihm dieses Buch inmitten der andern, und ein leichtes Kribbeln schien es ihm auszusenden, das über seine Fingerspitzen in Wellen sich seines Leibes zu bemächtigen schien. Dies Buch zog ihn an. Sollte er es sich näher besehen? Was wäre schon dabei, hatte ihm doch der Gastgeber nichts dergleichen verboten?
Gerade als Regibors Finger den Einband fassten, ihn zwischen seinen Geschwistern hervorzuholen, unterbrach ihn des Gastgebers Stimme:
“Wohlan, Freund Gast, das Bad ist bereit. Du kannst mir jetzt folgen.”
Obwohl Melchiors Stimme keinerlei Schärfe entäußerte, nicht weniger freundlich war, denn sonst, schreckte Regibor zusammen, als fühle er sich bei Verbotnem ertappet, fühlte sich an die Zeiten im elterlichen Hause erinnert, wenn er mit den Fingern an den frisch gebacknen Küchlein - gewissermaßen in flagranti - erwischt ward.
Melchior jedoch ließ sich nicht anmerken, ob ihn seines Gastes Betragen wohl verwirrte. Die gleiche, wohlbekannte Heiterkeit sprach aus seinem Antlitz.
“Ich komme”, gab Regibor schließlich zur Antwort, und folgte Melchior in eine geräumige Kammer, welche von einem metallnen Ofen erwärmt und von einem großen, in den Boden gelassenen Becken beherrscht wurde, aus dem es heiß und schaumig dampfte. Regior wunderte sich, woher denn das Wasser komme, und wie es Melchior so schnell erhitzt haben mochte. Er dachte an die Bücher zurück, mit ihren mysteriösen Zeichen.
Ein Magier?
Der Gedanke schien wohl nahe liegend, denn wie sonst sollte Melchior sich auf solch treffliche Weise inmitten der Wildnis eingerichtet haben, so scheinbar spielend allen Wünschen, die ein Gast haben mochte, nachkommen?
Regibor entschloss sich zur Vorsicht. Gewiss, Melchior hatte keinerlei Arg erkennen lassen. Doch welchem Gotte mochte er dienen? Ein Feuermagier war er gewiss nicht. War’s also Adanos? Die Diener desselben, so wusste Regibor, lebten oftmals als Einsiedler. Aber gewiss nicht in solchem Prunke, wie Melchior.
Und was, wenn der nun einem andern, finsteren Herrn zu Dienste war…?
“Ich werde Dich nun eine Weile verlassen, Freund Gast. Bist Du mit dem Baden fertig, kehre in die Wohnhalle zurück. Solltest Du Hunger bekommen: Du weißt, wo die Küche liegt. Einstweilen wünsche ich Dir einen schönen Tag.”
Mit diesen Worten wandte sich Melchior zum Gehen.
Das Badewasser stellte sich fürwahr als heiß heraus, und mit Lust gab sich Regibor dem entspannenden Nass hin, wusch sich den geschundnen Körper, und dachte über seine Situation nach.
Du, guter Leser, wirst wohl schon lange einen Argwohn wider Melchior gefasst haben. Regibor indes hatte sich zunächst bloß um seines Leibes Bedürfnisse zu kümmern vermocht. Nun aber, da die Last der letzten, beschwerlichen Tage von ihm abzufallen schien, und sich Körper und Geist im Gleichklange erquickten, begann auch er seinem Gönner zu misstrauen.
Nach dem Bade kleidete er sich wieder an. Doch entgegen der Bitte - oder des Befehles? - Melchiors, begab sich Regibor nicht in die Wohnhöhle zurück, sondern besah sich die andern Räume, welche von dem Gange, daran sowohl die Schlafkammer, als auch das Bad grenzten, abgingen. Ein weitres Schlafzimmer, in ebensolchem Luxus eingerichtet und mit frisch gemachtem Bette, lag ganz in der Nähe. Ansonsten entdeckte er, den Gang entlang, ein Musikzimmer mit allerlei Klimperzeug: Kithara und Klampfe aus edlem Holze kunstvoll gefertigt, Harfe und Flöten von unterschiedlicher Größe und Machart. Trömmelchen und Schellen, und am Ende des Raumes eine kleine Bühne, mit einigen Stühlchen davor. Angesichts der Einsamkeit des Melchior wunderte sich Regibor, wofür dieser wohl eine solche Bühne brauchte.
Das nächste Zimmer erwies sich als ein Atelier, mit Leinwänden, Farben und Pinseln gefüllet. Einige fertige, auch so manch unfertige Bildnisse lehnten an Wänden oder Kommoden, und auf einer Staffelei prangte ein nahezu fertiges Gemälde, an welchem sich der Künstler wohl zuletzt betätigt haben mochte. Melchior hatte offenbar umfangreiche Interessen und Talente. Regibor besah sich des Bildes, das mit recht kraftvollem Pinselstriche eine große, rote Echse zeigte, in majestätischer Pose die Flügel gereckt, das Haupt stolz erhoben. Ein ungewöhnliches Bildnis einer solche Kreatur Beliars: Andere Bilder von Drachen, welche Regibor kannte, stellten sie zumeist mit eklen Fratzen dar, und bösem Blicke, oft im Streite mit edlen Rittern des Herrn. Hier jedoch wirkte der Drache königlich und schön.
Regibor wandte sich zum Gehen, und auf dem Gange zurück, folgte er diesem weiter. Auch hier führte der Gang nicht gerade heraus, sondern zog leichte Bogen, so dass Regibor nie allzu weit sehen konnte, wohin sein Weg denn führe.
Schließlich hielt er inne, von einem Geräusche alarmiert.
Eine Stimme.
So leise als möglich schlich er weiter, und schließlich vermochte er nicht bloß der Stimme Eigentümer - es war Melchior - sondern auch der Worte Bedeutung zu erkennen.
“Ich bitte Dich! Mein Bruder ist ein Idiot. Er wird sich übernehmen, wie schon Vater. Ich sage Dir, es ist nicht schlimm, ganz im Gegenteil! Ja, sie sind klein, geradezu mickrig. Und schwach. Aber es ist nicht übel, so zu leben, glaube mir!” Endlich eröffnete sich Regibor das Ende des Ganges, und was er sah, ließ ihn erschricken:
Der Gang öffnete sich in eine gewaltige Felsenhalle. Von oben her fiel das Licht der Sonne herein, welches den Schnee, der den Höhlenboden bedeckte, grell aufleuchten ließ. Doch weniger der Ort war’s, der Regibors Schaudern erregte. Vielmehr das, was sich darinnen befand: Sein Gastgeber, in seinem merkwürdigen Mantel, hatte ihm den Rücken zugewandt, und schaute eine riesige, rot geschuppte Gestalt empor. Sofort fühlte sich Regibor an das Gemälde erinnert, und Du vermutest Recht, oh Leser: Ein Drache war’s, zu dem Melchior da sprach. Ein gewaltiger, roter Drache. Eine Kreatur der Finsternis und des Bösen, ein Geschöpf des finstern Gottes Beliar.
Melchior, ein Schwarzmagier und Priester des großen Widersachers?
“So ein Unsinn, das wird niemals mehr möglich sein. Unsere Zeit ist vorbei, wir haben uns übernommen. Die kleinen Völker haben sich als stärker erwiesen, und sei es nur durch ihre Zahl. Ich sage Dir: In dieser Gestalt wirst Du…”
Melchior hielt Inne, und fuhr herum. Selbst aus der Entfernung blitzen die Augen im hellen Grau sichtbar auf. Der Blick des Drachen richtete sich auf Regibor: Kalte, gelbe Echsenaugen.
Oh wehe! Regibor kam nicht mehr dazu, sich umzuwenden, zu fliehen. Melchior hob eine Hand, und Regibor fühlte die Wucht eines gewaltigen Schlags, seinen Körper durch die Luft geschleudert, und der Aufprall nahm ihm das Bewusstsein. Dunkelheit trübte seinen Blick, nicht einmal der Schmerz in Rücken und Schulter hielt ihn bei Sinnen.
Geweckt wurde Regibor von Stimmen. Und vom Schmerze, der sich ihm nun, zunächst schmählich ignoriert, umso hartnäckiger aufdrängte.
“Was sollen wir jetzt mit dem Menschlein machen?” Eine Frauenstimme. “Was wohl?” Melchior. “Er hat zu viel gesehen. Es ist klar, was wir tun müssen.” Kalte Angst bemächtigte sich Regibors Herzen. Worin war er nur geraten?
“Offensichtlich ein neugieriger Bub.” Die Frau. “Ein Innosdiener, scheint mir. Aber das spielt nur für ihn eine Rolle.” Melchior. “Mir scheint, dass er erwacht ist. Seine Augenlider zittern. Und sein Atem geht nicht mehr so regelmäßig. Außerdem hat er ziemliche Angst. Findest Du es nicht merkwürdig, Melchior, dass ich auch jetzt noch die Angst der Menschen riechen kann?”
Regibor öffnete die Augen. Er lag auf dem Rücken, zwei Häupter über sich gebeugt. Zu seiner rechten Melchior, der nicht minder milde und freundlich lächelte, als sonst. Und zu seiner linken die Frau, aus deren Augen Schalk und Spott blitzen. Die Frau war schlank, und lange, schwarze Haare fielen in Locken über ihre bloßen Schultern. Auch sonst trug die Dame herzlich wenig am Leibe, und unter andren Umständen hätte Regibor wohl gewisse andre Dinge mit ihr zu tun beabsichtigt. Ihre Körperhaltung schien ihm etwas verkrampft, als fühle sie sich nicht recht zu Hause, in ihrer Haut.
“Sieh an, unser Mönchlein ist erwacht”, flötete sie. “Und sieh nur, wie er mich anschaut!” “Och, ich muss Dir sagen, Alzhara, dass Du Deine Gestalt ja auch nicht schlecht gewählt hast. Du wirst schon sehr bald feststellen, dass es durchaus bequem ist. Und merkst Du nicht, wie empfindsam die Haut ist?” Alzhara kicherte: “Vor allem fühle ich die Kälte. Wie es diese Menschlein bloß jemals so weit gebracht haben, so zerbrechlich, wie sie sind? Doch Finkregh wirst Du nie überzeugen können.” “Ich sagte doch, mein Bruder ist ein Idiot. Soll er sich doch von irgendeinem Glücksritter abschlachten lassen, dem es um den Drachenschatz geht!”
Regibor bewegte seine Glieder, prüfte, ob er aufstehen könne. Seine Hand schloss sich um das heilige Symbol der Sonnenscheibe, dass ihm um den Hals baumelte, das Zeichen des Herrn Innos. Plötzlich reckte er es den den beiden entgegen: “Weicht zurück, Schergen der Finsternis! Innos beschützt mich!”
Melchior gähnte. Alzahra betrachtete ihren Fuß, und bewegte ihn hin- und her, als teste sie ihre neue Gestalt.
“Lass es uns schnell erledigen, ja, Melchior? Ich habe keinen Nerv für das Menschlein.” Ihre dunklen Augen hefteten sich auf diejenigen Regibors, brachten ihn zum Schaudern. “Jetzt, Freundchen, wirst Du erfahren, was wir mit Dienern des Feuers tun.”
Das Letzte, das Regibor sah, war das böse Lächeln Alzharas.
Dann nichts.
Nur wieder Schwärze.
Beim dritten Male erwachte Regibor nicht etwa vom Überdruss an Schlaf, nicht von Schmerz oder Stimmen, sondern vor Kälte. Noch flackerten hinter seinen geschlossenen Lidern gar seltsame Bilder, von prächtig eingerichteten Höhlen, hellgrauen Augen, nackten Frauen und rot geschuppten Drachen. Doch diese Bilder zerfaserten, lösten sich in nichts auf, wie’s Traumbilder eben tun, und bald schon rappelte sich Regibor auf.
Es war etwa gegen Mittag, wie er am Sonnenstande erkannte. Doch etwas daran deuchte ihm falsch. Seine Kleidung war außen nass und voller Schnee, doch fror er nicht so sehr, als er erwartet hätte. Was war geschehen?
Er entsann sich wohl, in einen Schneesturm geraten zu sein. Beinahe hätte er alle Hoffnung verloren, doch offenbar hatte er überlebt. Doch wie nur?
Der Brief des Erzbischofs war an seinem Platze. Regibor fühlte sich nicht schlecht, beinahe erfrischt. Und da erkannte er, was ihm am Sonnenstande merkwürdig erschien: Innos’ Antlitz befand sich direkt über dem Gebirge, nicht ihm entgegen! So lagen die Berge nun… im Süden?
Ein Jubelschrei entwich Regibors Kehle: Wie immer ihm dies geglückt sein mochte, offenbar hatte er den Pass bezwungen! Er befand sich nun in Nordmar. Jetzt war es nur noch ein kurzes Stück Wegs bis zum Kloster, bald schon würde er seine Mission erfüllt haben.
Beschwingt macht sich Regibor auf den Weg, die Passtraße entlang, dem Tale entgegen.
Die Erinnerungen kamen ihm freilich erst Jahre später, nachdem er den Brief schon lange zugestellt hatte, zurück. Er hatte die Weihen der Priesterschaft schon lange empfangen, war in die Reihen der Feuermagier emporgestiegen, und sein zunehmend scharfer Geist lüftete den Schleier, den der Drachenzauber über ihn geworfen hatte. Den Lehrstuhl für praktische Theologie an der Universität zu Geldern hatte er von seinem Meister Glaukon übernommen, und blickte einer prächtigen Karriere - in Kirche ebenso wie Wissenschaft - entgegen.
Doch von seinem Erlebnisse erzähle er niemandem, bis zu seinem Tode nicht.
Nur seinem Diarium vertraute er das Wissen um dies Abenteuer an.
Nachbemerkung: Die Figur Alzhara kommt auch hier vor, und hat zudem zusammen mit Melchior einen Auftritt in "Theodizee", das über meine Signatur erreichbar ist.
Geändert von Sir Ewek Emelot (08.09.2010 um 21:38 Uhr)
 Berechtigungen
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
|







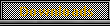



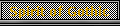










 World of Players
World of Players
 [Story]Frohe Weihnachten
[Story]Frohe Weihnachten










