-
 [Story]Schaum
[Story]Schaum
Schaum
Es lebte einmal im fernen Vengard ein betuchter Händler, der hatte eine wohl geratene Gemahlin und fünf gesunde Kinder, von denen er eines lieber hatte als das andere. Die beiden Töchter hatte er bereits zum großen Wohlgefallen der Familie an zwei verdiente Ehrenmänner verheiratet, während ihm die beiden ältesten Söhne nach Kräften bei der Führung seines Handelsbetriebes halfen und sich längst als würdige Erben erwiesen hatten. Bloß der jüngste Sohn, der blonde Theobald, machte dem alten Herren gehörige Sorgen, und dieses nicht gar zu knapp: Fürs Feilschen, Verwalten und für Zahlen ganz im Allgemeinen hatte der junge Mann kein Gespür, und jeder Versuch, ihn einem befreundeten Handwerksmeister als Lehrling zu überlassen, hatte bereits nach kurzer Zeit ein unrühmliches Ende in seinem bald mehr, bald weniger beschämenden Rauswurf gefunden. In seiner Ratlosigkeit hatte der Händler schon einen Magiekundigen zurate gezogen, um den Jungen auf magische Fähigkeiten zu testen – Theobalds vollkommene Talentlosigkeit hatte ihn an die vielen Geschichten über lange Zeit missverstandene Magier erinnert, die ihre Begabung erst spät erkannt hatten –, doch auch am Ende dieses bislang letzten Versuches hatte nur die niederschmetternde Erkenntnis gestanden, dass der jüngste Sprössling seinen Geschwistern und seinen Eltern in jeder erdenklicher Hinsicht unterlegen war und wohl als schwarzes Schaf der Familie zu gelten hatte.
So hockte Theobald nun Tag ein, Tag aus im Anwesen der Familie herum und vertrieb sich die Zeit mit dem Schmökern in den Büchern seines Vaters – das ihn allerdings immer schon nach kurzer Zeit anstrengte, denn auch im Lesen hatte er es nicht zur Meisterschaft gebracht – und einer ganzen Reihe von Tagträumereien, in denen er sich eine glorreiche Zukunft ausmalte. Im Grunde aber war er schon mit seiner derzeitigen Situation nicht unzufrieden, denn sein Vater, der ihn ja trotz aller Sorgen beinahe so lieb hatte wie seine nützlicheren Kinder, beschenkte ihn immer wieder mit allerlei überschüssigem Handelsgut, während ihm seine fürsorgliche Mutter dreimal am Tag die leckersten Speisen auftischte.
So lebte es sich nicht schlecht, und so wäre es mit Sicherheit noch einige Zeit weitergegangen, wenn nicht die Mutter eines schlimmen Tages von einer Krankheit erfasst worden wäre, die sich zwar nach kurzem Bangen als harmlose Sommergrippe entpuppte, aber die Mutter für einige Tage an ein Bett im Hause eines Heilers fesselte. Der Vater und seine beiden älteren Söhne, die den größten Teil des Tages mit ihm im familieneigenen Geschäft, in einem ihrer Lagerhäuser oder am Marktplatz verbrachten, mochten aber auch in dieser Zeit, in der die Mutter abwesend war, nicht auf ihr tägliches Mittags- und Abendmahl verzichten, und schon gar nicht auf ein ausgiebiges Frühstück. So kam es, dass der Vater Theobalds Zimmer betrat, in dem dieser gerade mit halb geöffnetem Mund auf seinem Bett döste, das infolge der mütterlichen Erkrankung inzwischen stark an Muffigkeit hinzugewonnen hatte, und dem Sohnemann mitteilte: „Theobald! Du weißt ja, dass die Mutter nicht dazu in der Lage ist, also wirst du nun bis zum Ende ihrer Leidenszeit all ihre Pflichten übernehmen. Morgens wirst du uns ein schmackhaftes Frückstück zubereiten, mittags wirst du uns ein warmes Gericht auftischen, und abends wirst du uns nach getaner Abend den verdienten Feierabend mit einem vorzüglichen Mahl veredeln! Hast du verstanden, was ich dir gesagt habe, Junge?“
Theobald begegnete den Wünschen des Erzeugers und Ernährers mit erstaunlicher Besonnenheit. „Natürlich, Vater“, sagte er. „Ich werde mein Bestes geben.“
Tatsächlich fühlte er sich beflügelt von der Vorstellung, der Familie auch einmal etwas zurückgeben zu können und einen wichtigen Beitrag zu ihrer Erhaltung zu leisten. Allzu schwierig, davon war er überzeugt, konnte das Kochen ohnehin nicht sein, denn die Mutter hatte diese Herausforderung ja schließlich auch all die Jahre lang mit Bravour gemeistert.
Am nächsten Morgen schaffte er es zur allgemeinen und durchaus auch zur eigenen Verblüffung in der Tat, rechtzeitig aus den Federn zu kommen, um aus den in der Speisekammer reichlich vorhandenen Getreide-, Milch- und Eierspeisen ein ansehnliches Frühstück für den Vater, seine beiden Geschwister und ihn selbst zusammenzustellen. Er musste sich zwar eingestehen, dass es vielleicht nicht ganz so mundete wie die köstlichen Kreationen seiner Mutter, aber alle am Tisch waren sich einig, dass es beim ersten Versuch – und gerade unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Theobald der Koch war – durchaus schlimmer hätte kommen können.
Nachdem der Vater und die Brüder das Haus verlassen hatten, um ihrer Arbeit nachzugehen, rieb sich Theobald zufrieden den Bauch und blickte mit einer angemessenen Portion Stolz auf die wenigen Überreste seiner morgendlichen Arbeit, die auf den Tellern und in den Tassen der nahen Anverwandten verblieben waren. Natürlich hatte Theobald nicht vergessen, dass er all das auch noch abspülen musste, aber ein solcher Aufwand wie die Zubereitung des Frühstücks, so vermutete er, konnte das Spülen wohl kaum sein, sodass er beschloss, diese Kleinigkeit auf später zu verschieben und sich zunächst ein wenig Freizeit zu gönnen, die er sich nach den vorangegangenen Strapazen redlich verdient hatte.
Als er sich wieder daran erinnerte, nahte bereits der Mittag, und dem erschrockenen Theobald dämmerte es, dass der Vater und die Brüder schon bald in Erwartung einer warmen Mahlzeit erscheinen würden. Für das Spülen, entschied er, blieb da keine Zeit, sodass er bloß rasch die gröbsten Essensreste vom Geschirr wischte und die schmutzigen Teller, Tassen, Gabeln, Messer, Löffel, Eierbecher, Käseplatten und Haferflockenschalen hastig in einen Schrank stellte, in dem er sie vor argwöhnischen Blicken sicher wähnte. Kaum war dies geschafft, da machte sich Theobald bereits mit Eifer an die Zubereitung des Mittagsmahls, das zu seiner Erleichterung zeitgleich mit dem Eintreffen der drei hungrigen Mäuler vollendet und genussbereit war.
Obwohl sich Theobald dessen bewusst war, dass seine unbeholfene Interpretation des tranchierten Moleratschinkens auf Feldrübenpüree nicht an die wesentlich ausgefeiltere Variante seiner Mutter heranreichte, sparten der Vater und die Brüder nicht mit Lob. Die Brüder kratzten begeistert auch die letzten Reste vom Teller, während der Vater bereits darüber spekulierte, welcher der ihm bekannten Vengarder Köche wohl Bedarf für einen begabten jungen Lehrling haben mochte. Mit einiger Herzlichkeit verabschiedeten sich die drei schließlich wieder vom strahlenden Theobald, der sich selten in seinem Leben so gut gefühlt hatte. Der Blick auf die klebrigen Töpfe, fettigen Pfannen und schmierigen Teller, die in der Küche und auf dem Esstisch verblieben waren, verschaffte seiner guten Laune zwar einen leichten Dämpfer, doch auch davon ließ sich Theobald in seiner Heiterkeit nicht lange beirren. Natürlich würde er vor dem Abend noch die doppelte Menge abspülen müssen, aber bis dahin war ja viel Zeit, die er, so seine Überzeugung, zumindest zu einem kleinen Teil ruhigen Gewissens mit einem erholsamen Nickerchen verbringen durfte.
Als Theobald erwachte, war es in seinem Zimmer schon etwas dunkler geworden, und ein rascher Blick aus dem Fenster bestätigte seine Befürchtungen: Der Abend war bereits hereingebrochen, und der hart arbeitende Teil der Familie konnte jederzeit zurückkehren. Fest entschlossen, die am Mittagstisch entstandene gute Stimmung nicht durch ein ausbleibendes Abendessen wieder zu verderben, eilte Theobald in die Küche. An das Abspülen war nun natürlich nicht zu denken, und kurzerhand räumte er das schmutzige Geschirr des Mittags zu den Überbleibseln des Frühstücks in den Schrank. Dort hatte sich nun schon eine recht einschüchternde Masse an dreckigem Allerlei angesammelt, doch Theobald war nach wie vor guten Mutes: Es war ja womöglich gar keine schlechte Strategie, im Anschluss an das Abendmahl alles zusammen in einem großen Rutsch abzuspülen.
Theobald hatte damit gerechnet, seine lieben Verwandten nach ihrer Ankunft zumindest um eine Viertelstunde vertrösten zu müssen, doch an diesem Abend war das Glück auf seiner Seite: Der Vater und die Brüder kehrten etwas später von der Arbeit zurück als es für gewöhnlich ihre Art war, und entschuldigten sich ihrerseits in vielen Worten bei Theobald dafür, dass sein liebevoll zubereiteter Waranrücken in Kronstöcklsoße mit gegrillten Feuernesselrouladen möglicherweise bereits in der Erkaltung begriffen war. Dem aber war, da das Gericht durch Theobalds eigene Verspätung gerade zur rechten Zeit fertig geworden war, natürlich nicht so, sodass sich die drei Beköstigten zurecht zufrieden über das Ergebnis von Theobalds Kochbemühungen zeigen konnten.
„Ich bin stolz auf dich, mein Junge“, sagte der Vater schließlich, als sich die beiden müden Brüder bereits zu Bett begeben hatten. „Du hast deine Pflichten zu meiner vollsten Zufriedenheit erfüllt. Nun brauchst du nur noch den Abwasch zu machen, dann kannst auch du dich zur Ruhe legen. Heute, so kann ich sagen, hast du dir diese Ruhe mit Fug und Recht verdient.“
Der Vater herzte und umarmte seinen Jüngsten mit vor Zuneigung geröteten Wangen, setzte sich mit sorgsamen Griffen seine bebommelte Schlafmütze auf das Haupt und begab sich anschließend in das Schlafzimmer, um dort bis zum nächsten Morgen geruhsam zu schlummern.
Allein zurück blieb der Theobald, der sich noch immer über die vielen lobenden Worte freute, obwohl er nicht ganz zu unrecht den Verdacht hegte, dass er ihrer nicht zuletzt deshalb in einer solchen Vielzahl bedacht worden war, da die Erwartungen der Familie an seine Kochkunst zuvor so unermesslich niedrig gewesen waren. Ein Meisterkoch, das wusste er, war an ihm sicherlich nicht verloren gegangen, aber das Gefühl, zumindest einmal nicht auf ganzer Linie versagt zu haben, war dennoch kein unangenehmes.
Eine Kleinigkeit aber blieb natürlich noch, bevor er sich in sein eigenes Bett begeben und dieses Wohlgefühl vollends auskosten durfte: Das viele Schmutzgeschirr, das noch im Schrank auf ihn wartete, und das am Abend einige Verstärkung in Gestalt weiterer verschmierter Teller, Töpfe, Pfannen und Gläser erhalten hatte, musste noch von ihm abgespült werden. Ein weiteres Aufschieben kam jetzt natürlich nicht mehr infrage, und Theobald hatte auch gar kein Verlangen mehr danach. Er war davon überzeugt, dass er auch diese Aufgabe ebenso gut lösen konnte, wie die vorangegangenen, die ja wohl eindeutig die schwierigeren gewesen waren.
Im Wasserkessel erhitzte er eine ausreichende Menge Wasser, gab ein großes Stück Seife hinzu und machte sich daran, das viele verunreinigte Geschirr vom Tisch, Herd und natürlich aus dem Schrank herbeizuschaffen und neben dem Spülbottich aufzutürmen. Als das geschafft war, krempelte er die Ärmel hoch, griff sich den Spüllappen und tunkte ihn ins seifige Spülwasser.
Zunächst war Theobald noch guten Mutes. Innerhalb weniger Minuten hatte er die ersten Teller und Tassen abgespült und auf der Küchenplatte zum Abtropfen abgelegt. Dann aber warf er noch einmal einen genaueren Blick auf einen der vermeintlich gereinigten Teller und bekam einen gehörigen Schrecken: Das scheinbar so saubere Stück Porzellan hielt einer genaueren Prüfung ebenso wenig stand wie die übrigen Teller und Tassen: Hier klebte noch ein Stückchen Waranfett, dort noch ein angetrockneter Rest Scavengereierschale, und auch das Feldrübenpüree war längst nicht so leicht von den Tellern zu bekommen, wie es zuvor darauf abzulegen gewesen war. Entsetzt begriff der arme Theobald, dass er alles noch einmal abspülen musste, denn derart fahrlässig gereinigte Teller und Tassen durfte er seinem Vater und den beinahe noch anspruchsvolleren Brüdern am nächsten Tag natürlich unmöglich vorsetzen. So sehr er jedoch schrubbte, und so viele zusätzliche Seifenstücke er auch ins Wasser gab, so wenig zufriedenstellend war das Ergebnis seiner Mühen. Das Wasser blubberte und schäumte fröhlich vor sich hin, doch Theobald war angesichts der einfach nicht wegzubekommenden Fettflecken auf den bisher gewaschenen Geschirrstücken und der gewaltigen Mengen an noch überhaupt nicht angerührtem Schmutzzeug ganz und gar trübselig zumute. Draußen war es bereits schwarz geworden, und er musste einige Kerzen anzünden, um überhaupt noch etwas sehen zu können – aber angesichts seiner nassen und darüber hinaus vom vielen Seifenwasser schon leicht angeschrumpelten Hände gelang ihm nicht einmal das Anzünden der Kerzen auf Anhieb. Als er es schließlich doch geschafft hatte, wünschte er sich allerdings gleich wieder die Dunkelheit zurück, denn der Anblick, der sich ihm bot, erinnerte ihn auf schmerzliche Weise an das schier unmögliche Spülvorhaben, das ihm noch bevorstand. Wie bloß hatte die Mutter diese Aufgabe all die Jahre lang mit einer solchen Leichtigkeit bewältigen können? So leicht ihm auch das Kochen gefallen war, so sehr verzweifelte Theobald nun an der scheinbaren Nebensächlichkeit des Abwaschs, dessen Grausamkeiten ihm erst jetzt, da er sie am eigenen Leibe durchleiden musste, vollends bewusst wurden. Noch immer steckte der unbedingte Wille in ihm, den Vater und den Bruder nach den vielen Komplimenten des vergangenen Tages letztlich nicht doch zu enttäuschen, indem er ihnen seine Unfähigkeit beim Spülen offenbarte, doch all sein Bemühen und all sein eisernes Durchhaltevermögen halfen nicht: Kaum ein Löffel, der einmal weitgehend fleckenfrei verblieb; kaum eine Gabel, zwischen deren Zinken nicht noch die miefigen Erinnerungen an den vergangenen Speisegenuss steckten; kaum ein Topf, der sich von der klebrigen Schicht am Boden auch nur in Ansätzen trennen wollte.
Er hatte noch nicht einmal die Hälfte des Geschirrberges überhaupt angerührt, als von draußen das liebliche Gezwitscher der Vöglein herein drang, die natürlich gar nicht ahnen konnten, was ihr unbedarft vorgetragener Gesang im verzweifelten Theobald auszulösen vermochte. In nicht einmal einer Stunde würden der Vater und die Brüder ihr Frühstück erwarten – und er war noch immer mit den stinkenden Vermächtnissen des vergangenen Tages beschäftigt, ohne dass sich ein Ende der Plackerei auch nur in Sichtweite befand!
Stöhnend und keuchend brach Theobald über dem Spülbottich zusammen und vergrub sein Gesicht in den seifigen und gänzlich verschrumpelten Händen, deren gereizte Haut vom vielen Spülwasser an einigen Stellen bereits aufgerissen war.
„Ich will nicht mehr“, wimmerte er in seiner völligen Ermattung und seiner unendlichen Niedergeschlagenheit. „Ich... ich will einfach nicht mehr...“
Der Spüllappen entglitt seinen kraftlosen Fingern und landete in der großen, schäumenden Pfütze, die sich zu seinen Füßen längst gebildet hatte.
„Was würde ich nur darum geben, wenn all das Zeug... wenn es einfach sauber wäre... wenn dieser ganze Mist doch bloß einfach... einfach... sauber wäre...“
Er hatte diese Worte noch nicht ganz ausgesprochen, als sich unter sein Gewinsel plötzlich das zunächst viel leisere Geräusch eines leichten Brausens legte, das aber immer lauter und lauter wurde. Erstaunt nahm Theobald die Hände von den Augen und wollte eben jenen Augen zunächst gar nicht so recht glauben: Das Spülwasser, das schon zuvor von einer dicken Schaumkrone bedeckt gewesen war, sprudelte geradezu über vor Seifenschaum und sprühte dabei hunderte und aberhunderte Seifenblasen in die Höhe, dass Theobald die Sicht davon schwand. Verblüfft kniff er die Augen zusammen und wedelte mit den Armen die vielen Blasen von sich, während dem Bottich ein wahres Ungetüm aus Seifenschaum entstieg. Schon reichte es fast bis zur Decke, und schon reckten sich zwei dicke Blubberarme nach vorn, um sich mit brausenden Fingern an der Vorderkante der Küchenplatte festzukrallen. Theobald wusste nicht wie ihm geschah, er wollte fortlaufen, aber er schaffte nicht einmal einen kleinen Schritt zurück – selbst dann nicht, als ganz oben in der Sprudelmasse plötzlich zwei dicke runde Seifenstücke als große, glotzende Glubschaugen hervorploppten und das seifige Ungeheuer einen gewaltigen Schlund offenbarte, den es sogleich zu einem breiten Grinsen aufriss. Vollends von den Socken war Theobald, als sich aus dem blubbernden Brausen, das diesem Rachen entwich, deutlich vernehmbare Worte herausbildeten:
„Hallo, mein Freund, du ahnst es schon:
Ja, ich bin es – der Spüldämon!
Wenn Menschen an dem Schmutz verzweifeln
Und stundenlang sich selbst einseifen
Im Kampf mit Krümeln, Schmalz und Fetten,
Dann komme ich, um sie zu retten!
Ich seh es gleich – ist auch nicht schwer –
Du, mein Lieber, brauchst mich sehr.
Die herkömmliche Seife da
Kommt mit dem fiesen Dreck nicht klar.
Soll's streifenfrei sein – glitzergut! –
Braucht's den Dämonenseifensud!“
Bei diesen Worten griff die rechte der beiden große Schaumhände des Spüldämonen in eben jenen Bottich, aus dem er entstiegen war, und zog eine glänzende Glasphiole daraus hervor, in der eine grünliche durchsichtige Flüssigkeit herumschwappte. Theobald brauchte einige Sekunden, bis er begriffen hatte, dass ihm der Dämon das Gefäß in die Hand drücken wollte.
„Das... das soll ich zum... Sp- spülen benutzen?“, stammelte der verwirrte junge Mann, in dem sich angesichts des freundlichen Verhaltens seines ominösen Gegenübers, das sich immerhin als Dämon vorgestellt hatte, auch ein gesundes Misstrauen regte. „Und das gibst du mir... einfach so? Ohne Gegenleistung?“
Begeistert zustimmend hüpften die beiden Seifenaugen im Schaumgesicht auf und ab.
„Oh ja, mein Freund, ich nehm dir nur
Die Qualen deiner Spültortur:
Ob Messing, Silber oder Glas –
Mit meinem Sud macht Spülen Spaß!
Gib einen Spritzer nur hinzu
Und alles glänzt und strahlt im Nu.
Ganz gratis und auch ohne Pfand
Kriegst du die Flasche in die Hand.
Doch damit ist's noch nicht genug:
Dazu gibt’s auch noch einen Fluch!“
Theobald, der bereits die Finger nach der leuchtend grünen Phiole ausgestreckt hatte, zog die Hand erschrocken zurück.
„W- wie bitte? Hast du gerade Fluch gesagt?“
„Na klar – ich wär ja kein Dämon
Würd ich dir nicht mit Flüchen droh'n!
Doch dieser Fluch, sei unbeschwert,
Ist deine Sorgen gar nicht wert
Und bald schon wieder aus dem Sinn
Besagt er bloß, dass – Hör gut hin! –
Das siebte Weib, das du lieb küsst
Dich prompt mit Haut und Haaren frisst.
Den Fluch, den musst du akzeptieren
Willst du ein Topfset ohne Schlieren!“
Skeptisch blickte Theobald in die feuchte Dämonenfratze, in deren Tausendschaft kleiner Bläschen sich der unruhige Kerzenschein schillernd spiegelte. Er hielt nicht viel davon, einen Pakt mit einem Dämonen einzugehen, der als solcher – so viel hatte der zumeist ungelehrige Junge im Religionsunterricht dann doch aufgeschnappt – natürlich zweifelsfrei zu den Dienern Beliars, des dunklen Schattengottes aus dem Unterreich, zählte. Aber bisher hatte er, soweit er sich entsinnen konnte, in seinem Leben noch kein einziges Mädchen geküsst, und zum ersten Mal wusste er sich darüber tatsächlich ein wenig zu freuen. Denn wenn er in den ersten siebzehn Jahren seines Lebens so wenig Erfolg bei den Frauen gehabt hatte, überlegte er, dann war es höchst unwahrscheinlich, dass er es jemals bis zu einer siebten Frau bringen würde, die sich bereitwillig von ihm küssen lassen wollte. Eine große Einschränkung würde dieser Fluch also nicht für ihn bedeuten, und falls es tatsächlich einmal dazu kommen sollte, dass er sich der siebten Frau näherte, so konnte er ja immer noch damit beginnen, ein wenig wählerischer zu werden. All das aber erschien dem jungen Theobald ohnehin so weit entfernt, dass er es im Angesicht der viel drängenderen Bedrohung durch den erwachenden Vater tiefer gehender Betrachtungen gar nicht wert erachtete.
„Na gut“, sagte er und bemerkte, wie der Spüldämon bei diesen Worten vor Freude sogleich noch ein wenig heftiger blubberte. „Ich nehme deine Flasche. Das Zeug wirkt ja auch ganz sicher so gut wie du sagst, ja?“
„Ganz sicher, Freund, ich geb mein Wort:
Es spült den Schmodder schleunigst fort.
Nimm meine Flasche, und ab morgen
Musst du um's Spülen dich nie sorgen!“
Ein paar Sekunden lang starrte Theobald noch zögerlich ins einladende Grinsegesicht des Dämonen, dann fiel sein Blick erneut auf die fürchterliche Anhäufung verunreinigten Essgeschirrs, und seine Entscheidung stand fest. Entschlossen streckte er die Hand aus und schloss die Finger um das Glasgefäß. Im gleichen Moment gurgelte und schlürfte es im Spülbecken, als habe jemand einen Stöpsel gezogen, und der ganze dämonische Schaumberg fiel in sich zusammen, bis er schließlich vollends im kristallklaren Wasser aufgegangen war, das sich nun im Bottich befand. Weder vom Spüldämonen noch von der Seife, die Theobald ursprünglich hineingegeben hatte, war noch etwas übrig geblieben, aber darüber wunderte sich der Junge nach den vergangenen Geschehnissen nicht mehr allzu sehr. Wichtig war ihm ohnehin nur, dass sich die Phiole noch immer in seiner Hand befand, und dass sie noch immer eine reichliche Menge der grünlichen Flüssigkeit enthielt, von der er sich die Lösung seines Abwaschproblems erhoffte.
Draußen war der Sonnenaufgang so weit vorangeschritten, dass er die Kerzen schon beinahe überflüssig gemacht hatte, und Theobald beschloss, keine Zeit mehr mit weiteren Grübeleien zu verschwenden. Mit seinen nassen und vor Aufregung zitternden Fingern drehte er den Verschluss des Gefäßes auf und träufelte vorsichtig zwei, drei Tropfen der rätselhaften Substanz in das Spülbecken, woraufhin das Wasser in Sekundenschnelle das Grün der Dämonenflüssigkeit annahm. Hoffnungsvoll nahm sich Theobald einen der moleratfettverkrusteten Teller, an dem er sich bereits eine Viertelstunde lang vergeblich abgemüht hatte, tunkte ihn in das Spülwasser – und hätte vor Begeisterung beinahe einen gehörigen Satz in die Luft gemacht, als der Teller beim Herausziehen so glänzte und funkelte, als sei er eine niegelnagelneue Anschaffung aus dem Privatbesitz des Königs höchstpersönlich. Noch dazu war der Teller durch die Magie des dämonischen Spülmittels gleich nach dem Herausziehen völlig trocken, so dass ihn Theobald nur noch in den richtigen Geschirrschrank einräumen musste. Gepackt von der Euphorie des so erfolgreich und rasch gespülten Tellers machte er sich daran, auch die übrigen schmutzigen Geschirrstücke in das wundersame Spülwasser zu geben, das seine beeindruckende Wirkung bis zum letzten Messer zuverlässig aufrecht erhielt. Es waren keine drei Minuten vergangen, da hatte Theobald den ganzen Haufen abgearbeitet, an dem er zuvor die gesamte Nacht lang verzweifelt war. Leuchtend funkelte das Geschirr aus den Schränken und Schubladen hervor, und nichts deutete darauf hin, dass es von einem lebenden Geschöpf jemals auch nur angerührt worden war.
„Danke, Spüldämon“, sagte Theobald, auch wenn er nicht wusste, ob ihn der Dämon überhaupt noch hören konnte. „Du hast mir wirklich aus der Klemme geholfen. Das werd' ich dir nie vergessen!“
Wie es von Theobald in Anbetracht des überwältigenden Spülerfolgs gar nicht anders erwartet werden konnte, zeigten sich der Vater und die Brüder vom brillierend strahlenden Weiß des frisch gereinigten Porzellans ebenso hingerissen wie vom Blitzen und Blinken des Messingbestecks, das nach der nächtlichen Behandlung ganz den Eindruck machte, aus reinstem, frisch poliertem Silber gefertigt zu sein. Da jeder darin übereinstimmte, dass das Familiengeschirr noch niemals so bestechend rein gewesen war, erklärte man des Vaters Jüngsten ab sofort einstimmig zum Alleinverantwortlichen für den Abwasch auf unbestimmte Zeit – eine Entscheidung, die der glückliche Theobald dank seines Wissens um die ihm zugängliche Spülkraft der dämonischen Seifenlauge mit Freuden aufnahm und die auch, nachdem jene davon erfahren hatte, sehr zur baldigen Gesundung der Mutter beitrug.
In der Tat leistete die Gabe des Dämonen seinem neuen Besitzer auch in den folgenden Wochen gute Dienste: Selbst die größten Schmutzkatastrophen bereinigte Theobald unter Einsatz eines Spritzers der grünen Flüssigkeit binnen weniger Minuten, was seine Familie ein ums andere Mal in ungläubiges Staunen versetzte. Theobald hatte daher alle Mühe damit, die Existenz des übernatürlichen Spülkonzentrats vor seinen lieben Verwandten geheim zu halten, wollten diese ihm doch gerade in den ersten Tagen nur allzu gern beim Spülen über die Schulter schauen, um das Geheimnis seiner bemerkenswerten Effizienz in Erfahrung zu bringen. Der Junge half sich damit aus, das Spülwasser zunächst mit ganz gewöhnlicher Seife anzurühren und das Dämonengebräu in einem unbeobachteten Moment erst dann unterzumischen, wenn sich schon eine so dicke Schaumkrone gebildet hatte, dass die grünliche Farbe des Wassers für die spinksenden Schaulustigen nicht mehr zu erkennen war. Auf diese Weise konnte er das Geheimnis für sich behalten, was ihm günstig schien: Der Vater, so glaubte er, wäre einem Pakt mit einem Dämonen, und sei es auch ein hilfreicher Spüldämon, sicherlich mit einer gehörigen Portion Skepsis begegnet und von Theobalds Entscheidung nicht begeistert gewesen, so er denn davon erfahren hätte.
Die Wochen vergingen, und der zeit seines Lebens als Nichtsnutz geltende Theobald entwickelte sich rasch zum unverzichtbaren Teil der Familiengemeinschaft, den alle mit großem Respekt und einer gehörigen Portion Stolz zu behandeln pflegten. Nicht selten schwärmte der Vater vor Freunden und Handelspartnern von der außerordentlichen Begabung seines jüngsten Sohnes. Es war also nicht verwunderlich, dass das Gespräch auch dann rasch auf Theobalds Abwaschleistungen zu sprechen kam, als der Vater eines Tages das Oberhaupt der alteingesessenen und einflussreichen Vengarder Händlergilde Araxos bei sich empfing. Der Großhändler, ein bereits ergrauter und wohl genährter älterer Herr, wunderte sich sehr über das prächtig funkelnde Geschirr, auf dem ihm die Speisen der Mutter aufgetischt wurden und merkte in seiner großmütigen Bescheidenheit an, dass es der Ehre zu viel sei, eigens für ihn ganz neue Teller, Messer und Gabeln zu beschaffen. Der stolze Vater versicherte seinem Gast, dass sich das Geschirr bereits seit zwei Jahrzehnten im Besitz der Familie befände und berichtete ihm davon, wie es allein seinem Jüngsten, dem aufgeweckten Theobald, zu verdanken sei, dass es seit Kurzem wieder so schön strahlte wie vor zwanzig Jahren, ja schöner noch sogar. Erstaunt bat der Großhändler darum, diesen Meister des Abwaschs selbst sprechen zu dürfen, und der Vater verwehrte ihm seinen Wunsch nicht.
„Du bist also der Theobald“, wandte sich der alte Mann mit gütigem Lächeln an den Knaben, „der eine solche Funkelkraft ins Hause seines Vaters gebracht hat?“
„Der bin ich“, erwiderte Theobald, zufrieden über das Lob des Fremden.
„Ich sehe, dass du gründlich bist“, fuhr der Händler nach kurzem Zögern fort. „Aber bist du auch geschwind? Wie lange benötigst du, um deinen Glitzerzauber zu entfalten?“
„Gar nicht lang“, sagte Theobald, und der Vater nickte zustimmend. „Bloß ein paar Minuten.“
„Wenn du die Wahrheit sprichst, dann ist dir eine außerordentliche Gabe zuteil geworden, mein Junge.“ Der Gildenleiter legte die Stirn in Falten und rieb sich mit einiger gut ersichtlicher Nachdenklichkeit die wulstigen Lippen. „Wie wäre es, wenn du diese Gabe in Zukunft für mich und die Gilde einsetzt? In unserem Gildenhaus werden jeden Tag Händler und Botschafter aus aller Welt beköstigt, deren Gunst wir zu erringen suchen, und die Spülknaben, die wir beschäftigen, wissen des anfallenden Schmutzgeschirrs nicht Herr zu werden. Erst in der vergangenen Woche habe ich zwei weitere ins Haus geholt, doch eine Besserung ist ausgeblieben. Du, mein Junge, scheinst mir aber aus einem ganz anderen Holz geschnitzt und der Herausforderung gewachsen. Mach deine Sache gut, und ein reicher Lohn ist dir gewiss. Was sagst du?“
Theobald war ganz sprachlos vor freudiger Überraschung. Nachdem seine Arbeitskraft zuvor stets verschmäht worden war, bot man ihm nun sogar eine Beschäftigung an, ohne dass er überhaupt darum ersucht hatte – noch dazu bei der bekannten Gilde Araxos, der nur die betuchtesten und umtriebigsten Geschäftsmänner Myrtanas angehörten.
„Darf ich, Vater?“, wandte sich Theobald aufgeregt an seinen Vormund, der ihm freundlich die Hand tätschelte.
„Aber natürlich, mein Sohn. Unser verbrauchtes Geschirr werden wir einfach bis zum Abend aufbewahren, damit du es dir nach getaner Arbeit vornehmen kannst.“
Mit dieser Lösung waren alle einverstanden, und noch am selben Abend setzte Theobald seine schiefe Unterschrift unter einen flugs aufgesetzten Beschäftigungsvertrag.
Theobald bemerkte schnell, dass sein neuer Arbeitgeber beileibe nicht übertrieben hatte, was die Zustände in der Spülkammer des Gildenhauses betraf: Während den vielen Gästen aus Varant, Khorinis und noch viel weiter entfernten Orten die herrlichsten Festmähler aufgetischt wurden, arbeiteten sich fünf verschwitzte Spülschergen nach Kräften daran ab, den stetig wachsenden Nachschub an dreckigem Essgeschirr unter Aufwendung gewaltiger Seifenmengen für die nächste Verwendung zu präparieren, was ihnen allerdings – wie Theobalds reinheitsverwöhntem Auge nicht entging – auf das Kläglichste misslang.
Anfangs hatte Theobald noch seine liebe Mühe damit, den Einsatz der Dämonensubstanz vor seinen Arbeitskollegen zu verheimlichen, doch es dauert keine zwei Tage, da hatte er keine Arbeitskollegen mehr und die Alleinverantwortung für den Spülbetrieb im Gildenhaus lag ganz bei ihm. Nun also schaute ihm niemand mehr über die Schulter, und der Arbeitstag im Dienste von Araxos unterschied sich kaum noch von seinem üblichen Tagesablauf im Elternhaus: Die meiste Zeit trödelte er herum, blätterte in einem Büchlein, das er sich von zuhause mitgenommen hatte oder starrte mit verträumtem Gesicht Löcher in die Wand, wenn er nicht gerade ein Nickerchen eingelegt hatte, was ziemlich häufig der Fall war. Die Gildenleute kümmerte dieses Verhalten nicht, denn immer wenn sie ihn anstupsten und auf einen frisch gelieferten Stapel verunreinigter Teller hinwiesen, dann war dieser Stapel nach fünf Minuten auf wundersame Weise einer Kollektion des allerherrlichsten Prachtporzellans gewichen, wie man es sich augenschmeichelnder und wohlriechender gar nicht denken konnte.
Nachdem also Theobald das Spülproblem der Araxos-Gesellschaft ohne jede Mühe im Alleingang gelöst und somit keinen Zweifel mehr an seinen Fähigkeiten gelassen hatte, ließ auch der Dank des Gildenmeisters nicht lange auf sich warten. Der alte Mann war so zufrieden mit Theobalds Leistung, dass er damit begann, ihm über den ohnehin schon üppigen Lohn hinaus reiche Geschenke zu unterbreiten und ihn nicht selten auch zu Festlichkeiten und Familienversammlungen in seinem eigenen Hause einzuladen. So kam es, dass Theobald auf die jüngste Tochter des an Kindern nicht armen Gildenleiters, die liebreizende Sophie, traf, und sich mit einer solchen Leidenschaft und Hingabe in die Schöne verliebte, wie er sie von sich selbst bis dahin nicht gekannt hatte. Sophie wiederum war dem Jüngling schon verfallen, bevor sie ihn überhaupt zu Gesicht bekommen hatte, denn der Vater hatte am Familientisch mit aufregenden Geschichten über die außerordentliche Spülkompetenz des jungen Mannes nicht gespart. Es brauchte bloß einen einzigen gemeinsam verbrachten Abend bei einem Geburtstagsfest, das für eine von Sophies älteren Schwestern gegeben wurde, da hatten sich die beiden mit Haut und Haar ineinander verliebt und wollten gar nicht mehr voneinander lassen. Noch in der gleichen Nacht stahlen sich die zwei Turteltauben in den weitläufigen Garten davon und gewährten ihrer aufkeimenden Liebe in einem zärtlichen Kuss ihre Erfüllung. Nachdem diesem Kuss in den folgenden Tagen noch viele weitere gefolgt waren, nahm Theobald all seinen Mut zusammen und bat Sophies Vater um die Hand seiner Tochter. Der alte Gildenleiter wiederum war dem vorbildlichen Reinemacher so zugetan, dass er nicht eine Sekunde lang daran dachte, dessen frommem Wunsch zu widersprechen und noch in der gleichen Woche die Verlobung der beiden Glücklichen ausrief – eine Nachricht, die auch die Eltern des zukünftigen Bräutigams mit ebenso großer Freude wie Verblüffung erfüllte.
Der junge Theobald wiederum konnte sein Glück kaum fassen, hatte er es doch in kürzerster Zeit nicht bloß zu einigem Wohlstand und noch größerer Anerkennung gebracht, sondern dazu auch das Herz der entzückendsten Dame für sich gewonnen, die er je kennen gelernt hatte. Um den Fluch machte er sich nun noch weniger Sorgen als zuvor, denn dass er jemals eine andere Frau als die holde Sophie küssen wollte, das erschien ihm ganz und gar unvorstellbar. Er hätte also sein Leben in vollen Zügen genießen und die seltsame Begegnung mit dem Dämonen vergessen können, wäre ihm nicht jederzeit bewusst gewesen, dass seine Fähigkeit zur täglichen Reinigung des Gildengeschirrs und damit auch sein gesamter beruflicher und womöglich privater Erfolg einzig und allein von der wundersamen Flüssigkeit abhing, die allerdings zunehmend zur Neige ging. Zwar hatte Theobald längst verstanden, dass schon ein einziger kleiner Tropfen genügte, um auch die miefigste Großansammlung der widerwärtigsten Teller und Töpfe zum Strahlen zu bringen, aber all seine Sparsamkeit änderte natürlich nichts an der grundsätzlichen Endlichkeit des Phioleninhalts. Mit dem abnehmenden Pegelstand im Fläschchen senkte sich auch Theobalds gute Laune zunehmend, was der verunsicherten Sophie nicht entging. Vergeblich versuchte sie, ihren Zukünftigen aufzuheitern und erkundigte sich ein ums andere Mal nach der Ursache dieser ihr unerklärlichen Trübseligkeit, von der ihr Theobald aber um keinen Preis berichten wollte.
Schließlich war der Tag gekommen, an dem Theobald vergeblich die Phiole schüttelte, um noch einen letzten Rest des so bitterlich benötigten Extrakts herauszuquetschen: Das Glasgefäß war leer und der arme Theobald blickte hilflos hinüber auf einen Tisch voller Schmutzgeschirr, das er nun, da ihm der magische Beistand fehlte, wieder in seiner ganzen einschüchternden Bedrohlichkeit vor sich sah. Er nahm aber all seinen Mut zusammen, erinnerte sich an die vielen lobenden Worte über seine Meisterleistungen in der Kunst des Abwaschs und machte sich daran, den ersten Teller mit ganz gewöhnlichem Seifenwasser zu reinigen. Doch so sehr er auch gehofft hatte, vielleicht gar nicht so sehr auf das Spezialwässerchen angewiesen zu sein, so rasch wurden ihm seine letzten verzweifelten Illusionen wieder genommen: Nicht einmal nach einer Viertelstunde energischen Einseifens, Schrubbens und Aufpolierens hatte er dem Teller auch nur einen Hauch des Glanzes zurückgegeben, den er in den letzten Wochen mit einer solchen Leichtigkeit zu verleihen imstande gewesen war. Schon warfen ihm die Bediensteten verwunderte, dann skeptische und bald tadelnde Blicke zu, als sie beim Hereintragen des frisch verschmutzten Geschirrs die alten Dreckhaufen noch ganz unberührt sahen und am Ende des Tages ihre liebe Not damit hatten, überhaupt noch eine freie Stelle zum Abstellen der vielen unreinen Schalen, Tassen und Karaffen zu finden.
Als es draußen dunkel wurde, blieb Theobald allein im Gildenhaus zurück. Er wusste, dass er unmöglich nach Hause gehen durfte, ohne mit all dem Unrat um ihn herum fertig geworden zu sein, denn am nächsten Morgen würden die Köche und Küchendiener prall gefüllte Schränke erwarten, aus denen ihnen blank poliertes Porzellan entgegen strahlte. Aber wie bei allen Göttern sollte er bloß ohne das Zaubermittel des Dämonen allein verrichten, woran fünf gut ausgebildete Spülknechte zuvor regelmäßig gescheitert waren?
„Spüldämon“, flüsterte Theobald schließlich in seiner Ausweglosigkeit, „komm bitte her und bring mir eine zweite Flasche! Spüldämon, bitte, bitte, tu mir diesen Gefallen... nur diese eine Flasche noch! Ich kann das alles nicht allein schaffen, hörst du? Ich brauch deine Hilfe, Spüldämon!“
Doch so sehr er auch jammerte und flehte, bald leise, bald laut – es kam keine Antwort, und wäre nicht die leere Glasphiole noch immer in seinem Besitz gewesen, so hätte er geglaubt, den Verstand verloren zu haben und einer Wahnvorstellung nachzujagen, die in Wahrheit bloß ihn selbst in den Irrsinn trieb.
Als der Morgen nahte, waren Theobalds Hände längst aufgequollen, die Haut blutig vom vielen Schrubben und sein Gesicht verklebt durch die getrockneten Tränen, die ihm beim Gedanken an Sophies enttäuschten Blick und die zornige Miene ihres Vaters in Sturzbächen über das zittrige Gesicht gelaufen waren. Die vergnügt und sorglos tirilierenden Vögelchen, deren klarer Gesang von draußen an Theobalds Ohren drang, waren schließlich zu viel für den bedauernswerten Jungen, dem nicht einmal mehr zum Weinen die nötige Kraft geblieben war. Mit rasselndem Atem sackte er über dem Spülbecken in sich zusammen und ließ den vor Fett triefenden Spülschwamm in den kleinen Teich fallen, der sich in der Spülkammer längst gebildet hatte und in dem er auf seinem halb aufgeweichten Holzschemel hockte.
Da hörte er plötzlich ein vertrautes Brausen, das aus dem Spülbecken herauf drang und rasch lauter und lauter wurde, bis es dem Theobald endlich dämmerte, dass es nicht bloß in seinem Kopf ertönte. Als er erstaunt aufblickte, hatte sich der Spüldämon längst in seiner bekannten Form aus dem schaumigen Seifenwasser erhoben und bedachte den Jungen mit seinem breiten Dämonengrinsen.
„Hallo, mein Freund, und guten Tag!
Ich seh, du schrubbst dir einen Warg
An dieser ölbefleckten Pfanne
Und jener stark verstopften Kanne.
Doch hab ich nicht vor kurzer Zeit
Dich von dem Spülverdruss befreit?
Ich wunder mich, muss sagen, sehr:
Hast du denn meinen Sud nicht mehr?“
Theobald war so erleichtert von dem plötzlichen Auftauchen des Dämonen, dass er der Schaumgestalt beinahe ungeachtet der wohl zerstörerischen Folgen um den Hals gefallen wäre.
„Endlich bist du da, Spüldämon!“, rief der Junge aus. „Ich habe gestern das letzte Tröpfchen deiner Flüssigkeit aufgebraucht. Du musst mir glauben, dass ich ganz sparsam damit war, aber es hat einfach nicht mehr ausgereicht. Bitte gib mir noch ein Fläschchen, hörst du? Ich werde diesmal sogar noch sparsamer damit sein!“
Die beiden Seifenaugen des Dämonen stießen vor Freude zweimal dumpf klackernd aneinander, als er dem Theobald antwortete:
„Ich gebe gern für dich, mein Guter
Noch einen Teil von meinem Sud her.
Doch braucht es, weiß der Spüldämon,
Diesmal 'ne größere Portion!
Wird dir ein Fläschchen bloß gehören
Wird mich dein Klagen bald schon stören
Denn noch eines der kleinen Teilchen
Reicht dir ja auch nur für ein Weilchen.
Nach kurzer Zeit ist das gewiss leer –
Was du jetzt brauchst, ist ein Kanister!“
Ein Zischen fuhr durch den unruhig blubbernden Leib des Dämonen, als er in das Spülbecken unter sich griff und ein großes kastenförmiges Glasbehältnis an die Oberfläche hievte, aus dem die von Theobald so ersehnte Flüssigkeit in stechendem Grün hervor strahlte.
„Ein... ein ganzer Kanister?“, stotterte Theobald mit leuchtenden Augen. „Ja – ja, sehr gerne, natürlich! Aber den, naja... den gibst du mir sicher nicht einfach so, oder?“
„Nun schau doch nicht so depressiv –
Ich schenk ihn dir zum Nulltarif!
Für mich ist's weder Gold noch Geld
Sondern dein Spülspaß, der was zählt.
Nur einen Fluch – brauchst dich nicht grämen –
Den musst du dazu auch noch nehmen.
Ist aber, ehrlich, halb so wild
Besagt bloß, dass – Mach dir ein Bild! –
Das siebte Kind, das von dir stammt,
Dich auffrisst, und zwar insgesamt.
Den Fluch, den musst du mit einstecken,
Willst du ein Weinglas ohne Flecken!“
Theobald hatte bereits befürchtet, dass er auch den zweiten Handel mit dem Dämonen nicht ohne einen weiteren Fluch abzuschließen in der Lage sein würde, und nachdem er in Sophie seine zukünftige Gemahlin gefunden hatte, war ihm die Vorstellung einer Vaterschaft keine abwegige mehr. Sieben Kinder allerdings, überlegte er, das waren schon eine ganze Menge, und die wenigsten Familien, die er kannte, waren mit einer solchen überreichen Nachkommenschaft gesegnet worden. Es war also sehr gut möglich, dass ihn der Fluch überhaupt nie treffen würde, und selbst wenn es einmal dazu kommen sollte, dass Sophie ihm ein fünftes oder gar sechstes Kind gebar, dann konnte man sich ja immer noch dazu entschließen, mit dem Kinderbekommen einfach aufzuhören. Zwar hatten es sich einige Zweifel in Theobalds Hinterstübchen so gemütlich gemacht, dass er sie auch nach längerem Abwägen nicht von dort vertreiben konnte, doch als er sich noch einmal vor Augen führte, dass die Alternative darin bestand, aufgrund seiner plötzlichen Unfähigkeit beim Abwasch von Sophies Familie verstoßen zu werden – und also überhaupt keine Kinder zu bekommen –, fiel ihm die Entscheidung plötzlich sehr leicht.
„Na gut“, sagte Theobald, und das Brausen des Spüldämonen nahm den Ton eines fröhlichen Pfeifens an, „ich bin einverstanden.“
In dem Augenblick, in dem der Junge den Griff an der Oberseite des großen Behältnisses gepackt hatte, sackte der Dämon in sich zusammen und war innerhalb weniger Sekunden vollends verschwunden, ganz so wie es Theobald bereits bei seiner ersten Begegnung mit dem sonderbaren Geschöpf hatte beobachten können und wie er es also schon vorausgesehen hatte.
Zunächst war es dem jungen Mann noch etwas mulmig zumute, als er daran dachte, dass nun bereits zwei Flüche auf ihm lasteten, die ihm beide nicht recht geheuer waren. Diese finsteren Gedanken waren allerdings bald zur Nebensache geworden, nachdem Theobald das erste Tröpfchen aus dem Kanister in das Spülwasser hatte fallen lassen und den aufgestauten Abwasch des ganzen Tages innerhalb von nicht einmal zwanzig Minuten sowohl bereinigt als auch in die richtigen Schränke eingeräumt hatte.
„Du hast mir wieder einmal richtig aus der Patsche geholfen“, murmelte er nach getaner Arbeit mit einem dankbaren Lächeln auf den Lippen. „Gut, dass es dich gibt, Spüldämon!“
So begab es sich, dass der junge Theobald durch das erneute hilfreiche Eingreifen der absonderlichen Schaumgestalt weiterhin gern gesehen war im Kreise der Familie des Gildenmeisters und bald schon erste Pläne für die große Hochzeit mit Sophie geschmiedet wurden. Theobalds Ruhm als geschicktester Tellerwäscher unter Innos' gütiger Sonne wuchs derweil in ungeahnte Höhen, denn jeder Gast aus fernen Landen, der in den Genuss eines Gastmahls im Gildenhaus gekommen war, trug die Geschichten über das makellose Weiß des Porzellans und den kristallinen Glanz der Gläser und Karaffen mit sich in seine Heimat. So war es nicht verwunderlich, dass auch dem mächtigen König Rhobar, der in einem gewaltigen Palast inmitten der Stadt Vengard hauste, bald die Erzählungen über den begnadeten Spülmeister zu Ohren kamen. Um die vielversprechenden Gerüchte einer Probe zu unterziehen, begab er sich unter dem Vorwand einer wichtigen Besprechung in das Haus der Gilde Araxos, wo ihm, dem Herrscher des Reiches von Myrtana, natürlich sogleich ein reiches Mahl aufgetischt wurde, wie es einem Monarchen angemessen war. Die Speisen selbst aber beachtete Rhobar kaum, war er doch hingerissen von dem Spektakel der Teller und des Bestecks, dessen Glanzvermögen jenes seiner eigenen luxuriösen Palastausstattung um ein Vielfaches übertraf. Beeindruckt und auch ein wenig eifersüchtig ließ der König nach dem Meisterschrubber rufen, von dem er schon so viel gehört hatte, und der in Gestalt des jungen Theobald auch kurze Zeit später im Speisesaal eintraf.
Verblüfft darüber, vom König persönlich gerufen worden zu sein, ging Theobald in die Knie.
„Euer Majestät –“, begann er, doch Rhobar bedeutete ihm mit einer königlichen Geste, sich wieder zu erheben.
„Ich sollte es sein, der vor Euch in die Knie geht“, sprach der Mächtige, „denn Euren Händen wohnt eine Kraft inne, die keinem anderen sterblichen Menschen zugänglich ist: Ihr habt das Gildenhaus von Araxos durch Eure Gabe in den wahren myrtanischen Palast verwandelt.“
„Ich... ich danke Euch, Euer Majestät“, brachte der aufgeregte Theobald mit Mühe hervor.
„Ihr sollt mir nicht danken“, brummte der König, „sondern mir untertan sein. Ab sofort werdet Ihr in meinem Palast leben und dafür Sorge tragen, dass mein eigenes Geschirr genauso glänzt und funkelt wie der Teller hier vor meinen Augen. Ihr sollt eine prunkvoll ausgestattete Unterkunft bekommen und für Eure Dienste reich belohnt werden, so wie es Euch gebührt.“
Im ersten Moment glaubte Theobald noch, dass ihn der König gleich um seine Zustimmung bitten würde, aber die Möglichkeit einer Ablehnung kam für den Monarchen natürlich gar nicht infrage. So musste Theobald wenig später den Gildenmeister und seinen Vater davon unterrichten, dass er in Zukunft für keinen der beiden mehr das Geschirr würde spülen können, was auf beiden Seiten mit großem Entsetzen aufgenommen wurde. Dennoch war der Vater natürlich mächtig stolz auf die ungeahnt steile Karriere seines Sohnes, und der Gildenmeister, dem an einer guten Beziehung zwischen dem Königshaus und Araxos sehr gelegen war, schien auch nicht ganz unglücklich darüber, seine Tochter einem hohen Bediensteten des Königs versprochen zu haben. Sophie wiederum fühlte sich wie in einem Märchen, als sie davon erfuhr, in Zukunft in einem echten Königspalast leben zu dürfen und herzte und knuffte ihren Gemahl den ganzen Abend hindurch auf das Wonnevollste.
So kam es, dass Theobald in den Dienst des Königs geriet und fortan im Palast von Myrtana ein Leben im Überfluss genoss, das ihm zusätzlich versüßt wurde durch die ihm reichlich dargebotene Zuneigung seiner Verlobten.
Und auch die Arbeit bewältigte er ganz so, wie es Rhobar von ihm erwartet hatte. Da er die Gunst des Königs genoss, war es Theobald glücklicherweise ein Leichtes gewesen, die Verbannung sämtlicher übrigen Diener aus der Spületage des Palasts zu bewirken, um dort ungestört mit dem großen und somit nicht ganz leicht zu verbergenden Glaskanister herumhantieren zu können. Dass er seine Arbeit ganz allein verrichten konnte, hatte ihm anfangs trotz aller Legenden, die sich längst um ihn rankten, noch kaum jemand glauben wollen, doch es brauchte nur zwei, drei Tage, bis auch der letzte Zweifler überzeugt war. Dennoch war die Arbeit im Palast anders als alles, was er zuvor gekannt hatte: Sie fühlte sich zum ersten Mal tatsächlich nach Arbeit an. Theobald hatte es gar nicht für möglich gehalten, aber im Wohnsitz des Monarchen, der eine kleine Stadt für sich war, fiel noch deutlich mehr Schmutzgeschirr an als bei den Gildenleuten von Araxos. Selbst unter Einsatz des Dämonenmittels hatte er gut damit zu tun, die von den Dienern des Königs und der Königsfamilie selbst verbrauchten Geschirrstücke rein zu bekommen und musste gelegentlich sogar einmal den Mittags- oder den Nachmittagsschlaf ausfallen lassen. Da ihm für seine Mühen aber größerer Dank entgegengebracht wurde als je zuvor, nahm er sie bereitwillig auf sich.
Die Vorbereitungen für die Hochzeit waren derweil in vollem Gange. Nachdem der König so hingerissen war von den Leistungen seines neuesten Dieners, hatte er Theobald zugesagt, ihm den königlichen Ballsaal im obersten Palastgeschoss für die Feierlichkeiten zur Verfügung zu stellen und für alle Unkosten selbst aufzukommen. Theobalds wie Sophies Eltern waren von dieser Nachricht über alle Maßen erfreut, und auch das Brautpaar selbst konnte den Tag der Vermählung sowie die darauf folgenden Freuden der Ehe kaum noch erwarten.
Schließlich war der ersehnte Tag gekommen, und die Feier wurde in einem rauschenden Fest begangen. Theobalds Familie war ebenso geladen wie die Sippe des Gildenmeisters, aus deren Gemeinschaft allen voran Sophies älteste Schwester, die sich derzeit in anderen Umständen befand, durch ihren kugelrunden Bauch herausragte. Die zauberhaft schöne Sophie hingegen trug das herrlichste Kleid des Königreichs, während ihr Gemahl den ganzen Abend über aus leuchtenden Augen strahlte, ganz so als habe er den eigenen Kopf tief in die grüne Spülflüssigkeit getaucht.
Als die Feierlichkeiten vorüber waren und sich die beiden frisch Vermählten in ihre Gemächer zurückgezogen hatten, legte Sophie ihren Kopf in den Schoß des Liebsten, schaute hoch in sein freundliches Gesicht und sagte wohlig lächelnd: „Nun sind wir also Mann und Frau. Was meinst du, mein Teurer, wie viele Kinderchen wir wohl einmal haben werden?“
Theobald, der seine Gedanken mehr beim baldigen Vollzug der Ehe als bei dessen möglichem Resultat hatte, fühlte sich von der Frage etwas überrumpelt, auch weil sie die Erinnerungen an den Dämonenpakt wach rief, die er gerade am Tage seiner Hochzeit von sich fern halten wollte.
„Ich weiß nicht, meine Holde“, antwortete er der süßen Sophie. „Zwei vielleicht? Oder drei?“
Sophie schmunzelte, hob ihren Kopf und gab dem Theobald einen kecken Schmatzer auf die Lippen. „Dabei wird es sicher nicht bleiben. Weißt du, was mir meine Schwester vorhin geflüstert hat? Sie hat einen der Feuermagier zu Rate gezogen, und der glaubt, dass sie nicht bloß ein einziges Kind bekommen wird, sondern... na, was glaubst du?“
„Da bin ich überfragt, meine Holde“, entgegnete Theobald, der das Gesprächsthema lieber gewechselt hätte. „Zwei vielleicht? Oder drei?“
„Oh nein! Sieben, mein Herz, sieben! Sie bekommt Siebenlinge – genau wie es schon meiner Großmutter widerfahren ist, und meiner Großtante mütterlicherseits – und deren Kusine ja ebenfalls! Das muss in der Familie liegen, glaube ich, und mit ein bisschen Glück wird uns, so Innos will, womöglich der gleiche Kindersegen zuteil werden.“
„G- glück?“, krächzte der entsetzte Theobald. „Das wäre doch... fürchterlich!“
„Aber wieso denn das? Denk doch nur an die vielen süßen kleinen Gesichtchen, und die vielen tapsenden Beinchen und Ärmchen – und wir können uns gleich sieben Namen zugleich ausdenken, für jedes einen anderen!“ Sophie legte die Stirn in Falten. „Möchtest du... möchtest du denn etwa keine Kinder, mein Schatz?“
„Doch – doch, natürlich!“, bemühte sich Theobald rasch klarzustellen. „Aber gleich Siebenlinge... da muss ich mir ja gewaltige Sorgen um deine Gesundheit machen, und dazu auch die der Kinder.“
„Ach, wir haben doch die Magier gleich hier im Hause, und mit magischer Hilfe ist noch jede Geburt erfolgreich gewesen. Wahrscheinlich wird es ja ohnehin nicht soweit kommen... es ist ein schöner Gedanke, aber wenn du mir ein Kindlein nach dem anderen schenkst, dann ist es mir ebenso recht.“ Ein erwartungsvolles Lächeln trat auf ihr sanftes Gesicht, als sie ganz sachte Theobalds Wange berührte und in sein Ohr hauchte: „Mach dir keine Sorgen, mein Stern – umarme mich lieber, liebkose mich und lass uns gemeinsam die Saat unserer Ehe säen!“
Theobald aber hatte plötzlich alles im Kopf – Schaum, grünes Brodeln, ein kleines blondes Kind mit den Reißzähnen eines Wolfes – bloß nicht mehr den Vollzug der Ehe, und er löste sich panisch aus der Umarmung seiner Angetrauten, mit der sie ihn bedacht hatte.
„Ich... ich denke, wir sollten nicht gleich...“, stammelte er und wich dem schockierten Blick Sophies aus, so gut er konnte. „Lass uns... lass uns das einfach auf morgen verschieben, ja?“
Aber auch der Schlaf brachte keine Besserung. Zwar hatte sich Sophies Laune zum Abend hin wieder so weit gebessert, dass sie bereit war, einen neuerlichen Versuch zu wagen, doch wieder stellte sich Theobald quer. Erst am dritten Tag, nachdem er zu sich selbst gesagt hatte, dass eine Geburt von Siebenlingen ja grundsätzlich sehr selten sei und er sich nur überflüssige Sorgen machte, legte sich Theobald zu seiner Ehefrau in das gemeinsame Bett. Kaum jedoch hatten sich die beiden entkleidet und waren einander näher gekommen, da hallten in Theobalds Ohren die Worte des Dämonen wider, und er lief tobend und unter lautem Geschrei aus dem Zimmer.
Tage vergingen, dann Wochen, in denen sich Sophie vergeblich bemühte, die Ursache jenes ihr ebenso unerklärlichen wie fürchterlichen Verhaltens des ihr so lieben Menschen in Erfahrung zu bringen. Unter keinen Umständen wollte ihr Theobald aber von der unheilvollen Verfluchung durch den Spüldämonen berichten, und so wurde aus Sophies anfänglicher Verwirrung und Verzweiflung eine zunehmende Bitterkeit, die einen immer größeren Keil zwischen die beiden Liebenden trieb.
Als Theobald eines Abends aus der Spületage in die gemeinsamen Gemächer heim kehrte, war Sophie verschwunden. Erst am nächsten Tag erfuhr er durch einen Brief ihres Vaters, dass sie gedachte, die Ehe für null und nichtig zu erklären, da eine Ehe ohne Vollzug laut den Gesetzen Innos' keine gültige Ehe sei.
Theobald war am Boden zerstört, zumal er nicht einmal zornig auf seine Gattin sein konnte, die er noch immer liebte wie am ersten Tag, und die ihn, wie er selbst einsehen musste, ja auch beim besten Willen nicht hatte verstehen können. Tagelang schloss sich der Ärmste in seinen Räumlichkeiten ein, bis schließlich der König selbst an seine Tür kam, um ihn um eine Wiederaufnahme des für den Alltag im Königspalast so unverzichtbaren Spülbetriebs zu bitten.
Erst am siebten Tag, nachdem die Aufforderungen des Königs an Nachdruck bereits um einiges gewonnen hatten, riss sich der Unglückliche zusammen und schlurfte die Treppen zur Spületage hinab. Dort jedoch erwartete ihn eine weitere unliebsame Überraschung: Da er seine Arbeit so lange verweigert hatte, war der König gezwungen gewesen, die alten Spülgehilfen zurückzuholen, die sich nun in den Kammern der Spületage breit gemacht hatten. Zornig darüber, die fremden Menschen in seinem eigenen Reich vorzufinden, machte sich Theobald daran, die Schergen zu verjagen, bis sein Blick auf einen großen, kastenförmigen Glasbehälter fiel, der schräg in einer Ecke lehnte und – Theobalds Herz setzte für einen kurzen Moment aus – völlig leer war.
„Was habt ihr getan?“, schrie Theobald, ganz außer sich vor Wut und Entsetzen. „Was habt ihr – was habt ihr mit der Flüssigkeit getan, die in diesem Kanister war?“
Einer der Männer zuckte ratlos mit den Schultern. „War doch nur so'n komisches grünes Zeuch drin, sah aus wie so 'ne Drecksplörre“, nuschelte er. „Hab's innen Abfluss weggekippt.“
„Weg- weg- wegge...“
Theobald glaubte, ihm müsste der Kopf platzen, und er drehte um und eilte die Treppen hoch bis in seine Gemächer, schloss die Tür hinter sich dreimal ab und schmiss sich in sein Bett, das er mit den Fäusten und Zähnen so lange malträtierte, bis er es so weit zerstört hatte, dass er sich zum Schlafen in eines seiner anderen Betten begeben musste.
Der König, den man vom sonderlichen Betragen des Spülmeisters natürlich unterrichtet hatte, grübelte lange darüber nach, wie er seinen gleichzeitig wichtigsten wie schwierigsten Untertan wieder zur Arbeit bewegen konnte. Er ahnte, dass er es mit Drohungen nicht weit bringen würde, und beschloss, es mit einer sanfteren Lösung zu versuchen, die ihm darüber hinaus auch auf andere Art zum Vorteil gereichen mochte: Da sich Theobald von der Tochter des Gildenmeisters gerade erst getrennt hatte, sah er die Gelegenheit gekommen, die Blutlinie seiner Dynastie mit dem Blute des kenntnisreichen Abwaschexperten zu stärken und schickte seine jüngste Tochter zu Theobalds Gemächern, um dessen Laune zu bessern und Liebe zu gewinnen.
Theobald wollte die junge Dame zunächst gar nicht einlassen, da er Rhobars Pläne erahnte und in seinem Herzen, das noch ganz von seiner Liebe zu Sophie erfüllt war, keinen Platz mehr für eine andere Frau sah. Da er jedoch trotz seiner resignativen Stimmung noch immer einen gesunden Respekt vor dem möglichen Zorn des Königs hatte, entschied er sich schließlich doch dazu, dem Mädchen die Tür zu seinen Gemächern zu öffnen.
Rhobars Tochter war eine wunderhübsche junge Dame, die in ihrer Anmut und ihrer natürlichen Grazie der Sophie in nichts nachstand. Obwohl Theobald seine Sophie in keinem Augenblick ganz vergessen konnte, sprach er gern mit der Königstochter und ließ sich von ihren wohl gewählten Worten und ihrem sonnigen Gemüt aufmuntern. So verplauderten die beiden den ganzen Abend, bis sich die Schöne schließlich dazu entschloss, einen Schritt weiter zu gehen, Theobald bei der Hand nahm und ihm einen beherzten Kuss auf die Lippen gab.
Theobald war überrascht, aber erwiderte den Kuss auf sanfte Weise, umschmeichelte die Lippen der Königstochter, die Nasenflügel erfüllt vom wohligen Blumengeruch, der das Mädchen umschwebte.
Doch gleich im nächsten Moment, da glitten seine Gedanken hin zum ersten der beiden Flüche, den der Dämon auf ihn gesprochen hatte – das zweite Mädchen, sagte er sich in Gedanken, sie ist ja erst das zweite Mädchen – doch er konnte nicht anders, als weiter über die Worte des Dämonen nachzudenken, und plötzlich kam ihm der schreckliche Gedanke, dass sie womöglich nicht erst die Zweite war: Der Dämon hatte ja von Weibern gesprochen, und war nicht etwa auch seine Mutter ein Weib? Wie oft hatte er seine Mutter mit Küssen bedacht – und wie oft hatte er seinen beiden Schwestern einen geschwisterlichen Kuss auf die Wange gegeben? War es nicht gut möglich – ja war es nicht sogar anzunehmen, dass der Dämon auch diese Küsse zählte, dass er selbst also der siebten Geküssten schon ganz nahe war? Mit einem Mal kam ihm seine Großtante in den Sinn, die mehrmals aus dem fernen östlichen Archipel zu Besuch gekommen war – hatte er nicht auch sie zum Empfang und zum Abschied geküsst, wie man es von ihm erwartet hatte? Immer weiter und weiter kreiselte Theobalds Gedankenspirale, bis er schließlich sogar an die beiden Hausratten denken musste, die er vor Jahren einmal besessen hatte, und an deren Geschlecht er sich nicht entsinnen konnte – aber er hatte sie auf ihr struppiges Fell geküsst, ganz sicher, und sehr oft sogar, und der Dämon hatte mit keinem Wort erwähnt, dass es sich um menschliche Weiber handeln musste!
Im schrecklichen Gedanken angekommen, dass die siebte Frau womöglich längst erreicht war – dass es eben jene Frau war, die er in gerade diesem Augenblick küsste – spürte er die Zähne der Königstochter auf seinen Lippen, ganz sanft nur, aber im nächsten Augenblick schon etwas fester, begieriger, hungriger –
Er riss sich los, stieß das aufschreiende Mädchen zur Seite und rannte aus dem Zimmer, hastete die Treppe hinab, immer weiter hinab – hinab – hinab, und dann den Korridor entlang, immer weiter, immer weiter, bis er an der Pforte angelangt war, stieß die Tür auf und lief über den Außenhof des Palastes hinaus bis zu den Toren, quetschte sich durch die beiden Wachen hindurch, ehe sie recht begriffen hatten, wie ihnen geschah, und hechtete atemlos durch die verwinkelten Gassen von Vengard, bis er nicht mehr konnte und bis er nicht mehr wusste wo er war und in der Orientierungslosigkeit zu Boden ging.
Am nächsten Morgen erwachte er in seinem Bett im Hause des Vaters. Ein Handelsfreund des Vaters, der auf den bewusstlos am Straßenrand ruhenden Jungen gestoßen war, hatte die vertrauten Gesichtszüge wiedererkannt und ihn zu seinem Elternhaus zurückgebracht, wo er unter den besorgten Blicken der Eltern und der Brüder die Nacht verbracht hatte.
Nachdem er erwacht war, bemühte sich die Familie, die genauen Umstände seiner absonderlichen Ohnmacht in Erfahrung zu bringen, drängte aber bald auch darauf, dass Theobald an den Königspalast zurückkehren mochte, um den Herrscher des Reiches nicht unnötig zu verärgern. Das allerdings kam für Theobald gar nicht mehr infrage, der ab diesem Morgen wieder ganz so lebte, wie er es in den ersten siebzehn Jahren seines Lebens gehalten hatte: Die meiste Zeit über verbrachte er schlafend oder dösend in seinem Zimmer, und das Haus verließ er nur dann, wenn es dringend nötig war. Der einzige Unterschied lag in der Natur der Tagträume, denen er sich hingab. Waren sie zuvor stets auf die Zukunft gerichtet gewesen und voller Zutrauen in das, was noch kommen mochte, so stellten sie nun ausschließlich schwache Schatten der vergangenen Freuden dar, die sich Theobald sehnlichst zurückwünschte und gleichzeitig für immer verloren wusste.
So lebte Theobald einige Wochen lang vor sich hin. Wochen, in denen ein Brief aus dem Palast, der ihm seine unehrenhafte Entlassung aus dem königlichen Dienst mitteilte, und ein beiliegendes Paket mit seinen zurückgelassenen Habseligkeiten die einzigen letzten Spuren der zurückliegenden Vergangenheit waren. Im Bewusstsein, die beste Zeit seines Lebens längst hinter sich zu haben, dachte Theobald gar nicht mehr daran, sich Gedanken über seine Zukunft zu machen, die ihm durch die Flüche des Dämonen ohnehin schon unumkehrbar verbaut schien, und verdämmerte im Zustand ständiger Beklemmung und dumpfer Niedergeschlagenheit Tag um Tag...
...Woche um Woche...
...Monat um Monat...
… bis er eines Nachts von einem leisen Brausen geweckt wurde.
Theobald glaubte sich zunächst noch in einem Traum gefangen, wälzte sich angestrengt im Bett herum, um ihm wieder zu entfliehen, und begriff erst spät, dass das Brausen nicht bloß ein Echo seiner ihn plagenden Vergangenheit war. Es war ganz gegenwärtig, ganz echt, und es kam aus der Küche.
Vorsichtig stieg der Junge aus dem Bett, öffnete die Tür und schlich auf leisen Sohlen zur Küche hinüber. Und tatsächlich: Dort im Wasserbottich, in dem die Mutter abends noch den Abwasch gemacht hatte, wartete bereits brodelnd und schäumend und mit tanzenden Seifenaugen der Blasen sprühende Spüldämon!
„Ach, du schon wieder“, brummte Theobald verstimmt. Das blöde Grinsen des Dämonen, der ihm durch seine Flüche ja schließlich allen Ärger überhaupt erst eingebrockt hatte, wollte er gerade am allerwenigsten sehen. „Was willst denn du?“
Der Dämon wirkte durch die schroffen Worte des Jünglings zunächst ein wenig verunsichert, doch die Strahlkraft seines Grinsens ließ nur unmerklich nach, als er dem Theobald mit blubbernder Stimme erwiderte:
„Hallo, mein Freund, ich forschte schon
In jedem Spültopf der Nation
Nach dir, mein lieber Menschenmann,
Zu schau'n, ob ich dir helfen kann!
Ich gab dir ja – Mir selber fehlt er –
Den schönen grünen Großbehälter.
Das ist jetzt schon was länger her:
Mir deucht's, der ist inzwischen leer!
Ich musste kürzlich an dich denken
Und wollt' dir gerne Nachschub schenken.
Natürlich, wie ich das gern tu,
Leg ich dir noch 'nen Fluch dazu!“
Zornig funkelte Theobald den Dämonen an.
„Hör mir bloß mit deinen bescheuerten Flüchen auf!“, knurrte er und ballte die Hand zur Faust. „Wegen denen ist jetzt mein ganzes Leben versaut... meine Frau hat mich verlassen, die will mich nie mehr sehen, und eine andere Frau kann ich mir auch nicht nehmen, selbst wenn ich wollte, weil ich ja gar nicht weiß, ob sie vielleicht die siebte ist, die mich dann auffrisst... und jetzt glaubst du wirklich, dass ich noch einen Fluch dazu nehme? Vergiss es! Und verzieh dich in die verdammte Kloake, da wo du herkommst!“
Mit einem Mal war das Grinsen völlig aus dem Gesicht des Dämonen verschwunden, und auch die Seifenaugen senkten sich traurig herab. Nachdem die Gestalt eine Weile geschwiegen hatte, glaubte Theobald schon, sie sei nun ganz verstummt, als sie schließlich ganz leise erneut das Wort ergriff:
„Ich glaub, ich muss dir jetzt was beichten:
Ich hab von Flüchen, auch den leichten
So wenig Ahnung wie die vielen
Myrtanamenschen von dem Spülen.
Ich bin ja bloß ein Spüldämon,
Und damit hat es sich auch schon:
Nach wahrer Macht muss ich stets lechzen,
Kann weder fluchen noch verhexen,
Kann weder umbringen noch heilen,
Sondern nur Spülmittel verteilen.
Ich schaute so in dein Gesicht
Und dachte mir: 'Der kriegt doch nicht
Der Frauen und der Kinder sieben
Und wird nie in den Fluch getrieben.
Deswegen', dacht ich, 'merkt der nie
Was von der Scharlatanerie!'
Ich wollt' ja nur, es tut mir leid,
ein echter Dämon sein, mein Freund,
Und dachte, um das zu versuchen,
Muss ich mal jemanden verfluchen.
Ich bitte dich, nimm's mir nicht krumm
Es war ja harmlos, wenn auch dumm:
Die Flüche – diese blöde Chose –
Sind beide zwei ganz wirkungslose.“
„Wie bitte?“, entfuhr es dem verblüfften Theobald, nachdem er sich noch einmal gründlich durch den Kopf hatte gehen lassen, was ihm der Dämon gerade mitgeteilt hatte. „Du hast mir die ganze Zeit über nur etwas vorgemacht mit deinen Flüchen? Dann wäre also all der Ärger gar nicht nötig gewesen? Ich habe alles verloren, nur weil du unbedingt so tun musstest, als könntest du Leute verfluchen?“
Doch so sehr Theobald dem Dämonen in seinen Worten zürnte, so erleichtert war er insgeheim auch darüber, dass er offenbar gar nicht so sehr verflucht war, wie er geglaubt hatte, und dass vielleicht doch noch nicht alles verloren war.
Ähnliche Gedanken schien auch der Spüldämon zu hegen, als er dem Theobald in einer Versöhnungsgeste die schaumige Hand reichte und ihm sagte:
„Nun reg dich ab und hör gut zu:
Wir biegen das schon hin im Nu,
Weil ich dir bis ans Lebensende
Ab jetzt das Spülzeug frei Haus sende!
Der Flüche bist du nun befreit
– Ich bin sie ja längst selber leid –
Und kannst das Herz der Dame binnen
Zwei, drei Tagen zurückgewinnen.
Das klappt schon, bin da guter Dinge,
Dass uns das beiden schon gelinge.
Aus Fehlern lernt man, heißt's so schön
So sollten wir das jetzt mal seh'n.
Ich danke dir, mein Kompagnon,
Für diese wichtige Lektion!“
So kam es, dass der Theobald sich ein zweites Mal aus seiner Lethargie löste und, ermutigt durch die aufmunternden Worte des Spüldämonen, alles daran setzte, das Verlorene wieder zurück zu gewinnen.
Und fast so, wie es der Dämon vorausgesehen hatte, geschah es auch: Nach einigem untertänigem Flehen und Betteln gab Rhobar dem Theobald, der ihm ja eine ganze Weile lang hervorragende Dienste geleistet hatte, eine zweite Chance und sah sich in seiner Großmut nach den ersten gewohnt überwältigenden Spülresultaten prompt bestätigt. Schwieriger war es, auch Sophie wieder von einer gemeinsamen Zukunft zu überzeugen, denn sein absonderliches und verletzendes Verhalten während der kurzen Zeit ihrer ersten Ehe konnte ihr der Theobald ja nach wie vor nicht verständlich machen. Nach einem guten halben Jahr des Werbens und des wachsenden Ruhms durch die treuen Dienste für den König wollte jedoch auch sie nicht länger widerstehen und gab ihren Gefühlen, die sie ja noch immer für den jungen Mann hegte, endlich nach.
Es war kein Jahr vergangen, da wurde erneut Hochzeit gefeiert – und, so viel kann ich Euch, werter Leser, im Vertrauen verraten: Diese zweite Hochzeit wurde dann auch zur vollsten Zufriedenheit beider Beteiligter noch in der gleichen Nacht auf das Feierlichste vollzogen.
Der glückliche Theobald verbrachte seither schon viele Jahre im Dienste des Königs, durch den getreuen Dämonen stetig mit frischer Spülflüssigkeit versorgt, und von der lieben Gemahlin mit einer Vielzahl wohl geratener, goldiger Kinderlein beschenkt. Auf diese Weise lebte unser Theobald glücklich und zufrieden, mit allem, was zu einem rundum erfüllten und sorgenfreien Leben dazu gehört, und wenn er nicht gestorben ist, dann –
Nun, genau genommen, kann ich Euch, werter Leser, versichern, dass er noch nicht gestorben ist. In eben diesem Augenblick, da ich die Euch vorliegenden Zeilen verfasse, erreicht mich nämlich die frohe Botschaft, dass er zum mittlerweile siebenten Male zum Vater geworden ist. Ich bin mir sicher, dass er seinem kleinen, liebreizenden Töchterlein in eben dieser Sekunde zum ersten Mal einen liebevollen Kuss auf die Stirn gibt.
Geändert von Laidoridas (01.09.2014 um 02:25 Uhr)
 Berechtigungen
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
|







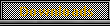



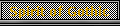










 World of Players
World of Players
 [Story]Schaum
[Story]Schaum









