-
 [Story]Die Wahrheit über Brahims Vater
[Story]Die Wahrheit über Brahims Vater
Die Wahrheit über Brahims Vater
Eine der Barmherzigen Schwestern der Heiligen Flamme tritt aus der Eingangstür hinaus auf die Treppe und verscheucht mit dem Fuß eine gestreifte Katze von der untersten Stufe. Dann mustert sie Brahim über den Rand einer goldgefassten Brille.
„Herr Brahim? Bitte kommen Sie doch herein!“
Sie hält ihm die Tür auf und Brahim folgt ihr in einen hohen, schmalen Raum mit schweren Damastgardinen vor dem Fenster. Die Schwester setzt sich hinter einen wuchtigen Schreibtisch in der Mitte des Raums und bedeutet Brahim, ihr gegenüber Platz zu nehmen.
„Mein Name ist Schwester Agostea. Ich bin die Leiterin des Pflegedienstes. Sie sind gekommen, um…“ - Schwester Agostea macht eine kurze Pause – „…Ihren Vater zu sehen.“
Brahim nickt, die Worte der Schwester hallen in seinem Kopf nach. Seinen Vater. Den Mann, von dem er erst vor einer Woche erfahren hat, dass er noch am Leben ist.
Schwester Agostea sagt in das unangenehme Schweigen zwischen ihnen: „Nun, leider bin ich im Moment sehr beschäftigt. Es hat ein kleines Missgeschick in einer der Abteilungen gegeben, und ich muss mich darum kümmern.“ Ihr Lächeln ist hart und sonnig. „Ich zeige Ihnen gleich den Besucherraum. Dort können Sie warten, bis es soweit ist.“
„Ich hoffe, es macht Ihnen nicht zu viel Mühe“, bringt Brahim lahm hervor.
„Ganz und gar nicht. Wenn ich recht verstanden habe,“ sagt sie und klopft mit der rechten Hand leicht auf ihre Brusttasche, um anzudeuten, dass sie Brahims Brief dort sorgfältig aufbewahrt, „dann haben Sie Ihren Vater bisher noch nie gesehen oder gesprochen.“
Brahim öffnet den Mund, aber es kommt nur ein trockenes Krächzen heraus. Er räuspert sich und sagt dann: „Ja, das stimmt.“
„Darf ich Sie dann darauf hinweisen, dass Ihr Vater eine sehr gebrechliche Konstitution hat? Er verfällt bei starken Gemütserschütterungen schnell in tiefste Melancholie und Zwangsgedanken. Wir haben ihn ja bereits seit über dreißig Jahren bei uns; ich weiß, wovon ich rede.“
„Ich verstehe.“
„Man kann sich leicht von seinem gefassten Auftreten täuschen lassen. Nun, Sie haben ja sicher auch schon darüber nachgedacht, nicht wahr, Herr Brahim?“
Brahim nickt. „Kann ich… kann ich vorher mit dem Professor sprechen? Ich muss ihn um Rat fragen in einer… heiklen Angelegenheit, die meinen Vater betrifft.“
„Natürlich“, erwidert Schwester Agostea steif. „Wenn Sie jetzt bitte so gut wären, mir zu folgen? Der Professor kommt, so schnell er kann.“
Durch eine Hintertür des Raumes betreten sie einen leicht abschüssigen Gang, der zu einem großen Zimmer im Untergeschoss der Klinik führt. Dann lässt Schwester Agostea Brahim allein.
Brahim sieht sich um. Eine große, bauchige Sanduhr im Regal zeigt die Zeit an. Auf einem runden Tisch liegen einige Zeitschriften und ein in elegantes blaues Leinen gebundenes Buch. Er geht zu dem Tisch, gießt sich aus einer Glaskaraffe Wasser ein und nimmt einen Schluck, denn sein Mund ist trocken. Sehr trocken. Dann nimmt er das Buch zur Hand und betrachtet die in Gold aufgeprägten Buchstaben. Adanos’ Friede ist in dir.
„Herr Brahim?“
Brahim fährt herum und lässt sein Glas fallen. Er hat nicht gehört, wie der Mann im weißen Kittel den Besucherraum betreten hat. Das Glas rollt über den Teppich und hinterlässt eine dünne Spur kleiner, dunkelgrauer Wasserflecken.
Der Mann, eine stattliche Gestalt in den Sechzigern mit graumeliertem, etwas zu langem Haar und einem gepflegten Bart, nimmt keinerlei Notiz davon. „Tut mir Leid, dass Sie warten mussten. Es gab einen kleinen Zwischenfall auf einer der Stationen.“
„Ich habe davon gehört“, antwortet Brahim. „Sie sind der Herr Professor?“
Der Professor setzt sich an den runden Tisch und macht eine einladende Geste. Auch Brahim nimmt Platz.
„Sie sind also hier, um Ihren Vater zu besuchen?“
„Ja. Ich hoffe, ich konnte Sie mit meinem Brief mit den näheren Umständen meines Besuchs vertraut machen?“
„Aber ja!“ Der Professor lacht und tippt sich leicht an die Stirn, um zu zeigen, dass er im Bilde ist. Seine Augen hinter den runden Brillengläsern funkeln lebhaft. „Und bitteschön, erzählen Sie mir, was Sie auf dem Herzen haben!“
Brahim reibt sich mit der rechten Hand die Schläfen und atmet aus. Dann sagt er: „Ich muss mich zunächst entschuldigen, dass ich Ihre Zeit in dieser Form beanspruche. Aber ich muss dringend jemanden in dieser Sache um Rat fragen.“
„Nehmen Sie sich nur die Zeit, die Sie brauchen!“, sagt der Professor und versucht ein ermunterndes Lächeln.
„Ja. Natürlich muss ich selbst entscheiden, was ich tun soll, aber es würde mir helfen, wenn ich mit einem Menschen darüber reden könnte, der meinen Vater kennt.“
Der Professor nickt und lehnt sich in seinem Stuhl zurück.
„Verstehen Sie, die Situation ist vollkommen neu für mich. Schließlich habe ich dreißig Jahre lang geglaubt, mein Vater sei mit seinem Fischerboot verunglückt, noch bevor ich auf die Welt kam. Erst auf dem Sterbebett hat meine Mutter mich zu sich gerufen und mir, nun, von den Umständen meiner Geburt erzählt. Das…das habe ich Ihnen ja schon alles in meinem Brief geschrieben. Als sie spürte, dass es zu Ende ging, da…“
„…da beschloss sie, ihr Gewissen zu erleichtern“, führt der Professor den Satz zu Ende.
Brahim nickt.
„Wenn Sie nun bitte zur Sache kommen könnten, Herr Brahim? Ich bin ganz Ohr!“, sagt der Professor und lacht meckernd.
„Nun, ich bin hier in Khorinis geboren und habe bis zu ihrem Tod mit meiner Mutter zusammengelebt. Mein Vater war Fischer. Er hatte einen drei Jahre jüngeren Bruder, den Adanos weder mit Ehrgeiz noch Fleiß gesegnet hatte, aber dafür mit einem angenehmen Aussehen und Erfolg bei den Frauen. Dieser Bruder… nun… er war eine Person, die von der Hand in den Mund lebte, wie man so sagt.“
„Verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche“, sagt der Professor, „Aber das, was Sie mir berichten, das haben Sie selbst erst vor wenigen Tagen erfahren?“
„Ja, ich weiß es seit sieben Tagen. Während meiner ganzen Kindheit, meiner ganzen Jugend wusste ich nichts von diesem Bruder und auch nichts davon, was mein Vater…“ Brahim schluckt und setzt von Neuem an: „…dass mein Vater noch am Leben ist. Man hat mir erzählt, er sei vor der Küste in einen Sturm geraten und ertrunken.“
Der Professor schaut zur Decke und sagt: „Aber… stattdessen… hat er sich hier befunden. All die Jahre.“
„Ja. Nein. Er war zunächst einige Jahre als Sträfling im Minental, ist aber dann, wenn ich es richtig verstanden habe, hierher verlegt worden, wegen unheilbarer Melancholie.“
Brahim betrachtet sein Gegenüber, aber die Augen des Professors sind unbeweglich. In einem Akt unendlicher Anstrengung würgt er den nächsten Satz hervor:
„Was wirklich kurz vor meiner Geburt passiert ist: Mein Vater hat seinen Bruder in einem Anfall von Eifersucht erschlagen.“
Brahim lässt sich in seinen Sessel sinken. Er fühlt sich auf einmal sehr erschöpft.
Der Professor streicht sich über den kurzen Bart. Brahim greift zur Karaffe und gießt sich etwas Wasser ein. Dabei bemerkt er, dass seine Hand zittert.
Endlich bricht der Professor das Schweigen: „Erschlagen?“
„Ja. Offenbar hat er eine Zeitlang den Verdacht gehegt, dass meine Mutter und sein Bruder… in einer Beziehung zueinander standen, die über Verschwägerung hinausging, wenn Sie verstehen. Das war natürlich ein schrecklicher Verdacht, und dann… ein schreckliches Verbrechen.“
Der Professor sah einen Moment lang unsicher aus. „Er hat ihn also erschlagen?“
„Ja. Steht denn darüber nichts in Ihren Unterlagen?“
„Nein. Wir wollen hier auch gar nicht immer alles wissen. Was wir wissen, wollen wir von unseren Patienten selbst erfahren.“
Brahim nickt und räuspert sich: „Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie in einer stürmischen Oktobernacht einige Wochen vor meiner Geburt aufgewacht ist und gesehen hat, dass das Bett meines Vaters leer war. Sie wartete Stunde um Stunde angstvoll auf seine Rückkehr, und als er schließlich kam, sagte er ’Jetzt habe ich ihn mit meinen eigenen Händen erschlagen’. Meine Mutter wagte nicht, irgendetwas zu sagen oder zu fragen, aber am nächsten Morgen wurde der Bruder meines Vaters tatsächlich ermordet in seinem Elternhaus aufgefunden. Mein Vater wurde wenige Stunden später festgenommen und er hat sofort alles gestanden, jede Einzelheit seiner Tat.“
Brahim macht eine Pause und trinkt einen Schluck Wasser. Der Professor lehnt sich zurück und vergräbt die Hände in den Taschen seines weißen Kittels.
„Eine schreckliche Geschichte“, konstatiert er sachlich. „Es ist verständlich, dass Ihre Mutter Ihnen diese Geschichte so lange wie möglich vorenthalten hat.“
Brahim denkt einen Augenblick lang nach. „Kann sein“, antwortet er, „Aber sie muss doch gewusst haben, dass sie eines Tages gezwungen sein würde, mir die Wahrheit zu erzählen.“
Der Professor schaut wieder zur Decke. „War sie wirklich gezwungen?“
Brahim sieht ihn verblüfft an. „Wie dem auch sei, ich habe bis zu ihrem Tod bei meiner Mutter gelebt, und ich weiß mit Sicherheit, dass sie niemals irgendeinen anderen Mann hatte.“
„Was wohl verständlich ist“, erwidert der Professor und lacht kurz auf. „Wissen Sie, ob Ihre Mutter ihn jemals besucht hat?“
„Ja, sie hat es zweimal versucht. Aber beide Male hat er sich geweigert, sie zu empfangen. Sie hat Briefe geschrieben, unzählige Briefe, aber er hat sie ihr ungeöffnet zurückschicken lassen. Zu tief war die Überzeugung meines Vaters, dass sie mit seinem Bruder ein Verhältnis hatte, und nicht nur das: Er glaubte, dass ihr Sohn – ich – eine Frucht dieser verbotenen Beziehung war.“
„Dass Sie also… gar nicht sein Kind sind?“
„Ja.“
Irgendwo aus den Eingeweiden der Klinik sind aufgeregte Stimmen zu hören und ein merkwürdig rhythmisches Klopfen. Der Professor nimmt seine Brille ab, betrachtet missvergnügt die Fingerabdrücke auf den Gläsern, haucht sie an und reibt sie mit einem Zipfel seines Kittels sauber. Dann fragt er: „Und inwiefern kann ich Ihnen mit einem Rat weiterhelfen?“
Brahim setzt sich zurecht, beugt sich vor und stützt seine Ellenbogen auf den Tisch: „Der letzte Wunsch meiner Mutter war, dass ich meinen Vater aufsuchen und ihn überzeugen soll, dass alle seine Verdächtigungen jeglicher Grundlage entbehren. Dass niemals etwas Unerlaubtes zwischen ihr und seinem Bruder vorgefallen sei.“
Brahim unterbricht sich. Er sehnt sich nach frischer Luft. Und das, obwohl es sich doch bisher nur um die Präludien vor der eigentlichen Konfrontation handelt.
Der Professor sagt nichts und reibt weiter an seiner Brille herum.
„Ich habe ihr also auf dem Totenbett versprochen, dass ich meinem Vater das erklären und ihn dazu bringen würde zu verstehen, dass seine Frau ihm ihr Leben lang treu war - bis in den Tod treu war! - und ich tatsächlich sein Sohn bin. Das war ihr ausdrücklicher Wunsch. Zwei Stunden später war sie tot.“
Der Professor schiebt seine Brille wieder auf die Nase und zwinkert ein paar Mal.
„Das freut mich“, sagt er nach einer Weile. „Ich verstehe, dass das alles für Sie sehr aufwühlend sein muss, aber zweifellos haben Sie einen guten Grund, hierher zu kommen.“ Er lacht wieder meckernd auf. „Ihr Vater wird also heute einen Sohn bekommen, von dem er bisher nicht geglaubt hat, dass es seiner ist.“ Er zögert, fährt sich durch das dichte Haar und sieht Brahim fragend an. „Aber ich sehe immer noch nicht, wo Ihr Problem liegt und wofür Sie meinen Rat benötigen.“
„Meine Mutter war bis zur letzten Sekunde bei klarem Verstand. Einige Minuten, bevor sie starb, schickte sie die Pflegerin hinaus und griff nach meiner Hand. Sie drückte sie fest, so fest, dass ich kaum glauben konnte, dass es mit ihr zu Ende ging.“
Der Professor hustet leicht, aber bedeutet Brahim, fortzufahren.
„Dann sagte sie: ‚Du hältst dein Versprechen, nicht wahr, Brahim?’ Ich nickte, und sie fragte noch einmal: ‚Du erklärst ihm also, dass du sein eigen Fleisch und Blut bist und dass ich niemals einen anderen Mann hatte als ihn?’ ‚Das habe ich dir doch versprochen!’ ‚Damit wirst du ihn retten, Brahim. Sein Leben, seine Seele, seinen Verstand.’ Ich streichelte ihre Hand und nickte. Sie sammelte noch einmal ihre Kräfte und sagte: ‚Aber trotzdem möchte ich, dass du weißt, dass er Recht hatte. Er ist nicht dein Vater, sondern der Mörder deines Vaters.’ Dann ließ sie meine Hand los, und wenige Minuten später war sie tot.“
Der Professor sieht plötzlich ganz blass aus. Er sucht in seiner Tasche nach irgendetwas, das er nicht finden kann. Erneut sitzen sie schweigend da. Brahim betrachtet die farblosen Aquarelle an der Wand hinter dem Rücken des Professors, wässrige Bilder mit ziemlich alltäglichen Motiven. Irgendwo sind wieder Stimmen und das metallische Klopfen zu hören.
Der Professor schiebt seinen Stuhl zurück, steht auf und geht ans Fenster. Er blickt in die Dunkelheit hinaus. „Und jetzt möchten Sie wissen, was Sie tun sollen?“
„Wenn Sie mir einen Rat geben könnten…“, sagt Brahim hilflos.
„Ob Sie das Versprechen einhalten sollen, das Sie Ihrer Mutter auf dem Totenbett gegeben haben, oder ob Sie die Wahrheit sagen sollen.“
„Ja.“
Der Professor zögert einen Augenblick, doch dann dreht er sich zu Brahim um und sagt mit entschlossener Miene: „Tun Sie, was Ihre Mutter von Ihnen verlangt hat. Vielleicht rettet es das Leben Ihres Vaters, wie sie es gesagt hat. Auf jeden Fall versichere ich Ihnen, dass die Wahrheit ihn umbringen würde. Vermutlich ist es nur dieser dünne Faden der Hoffnung, der ihn all die Jahre noch aufrecht gehalten hat. Er würde es nicht ertragen können.“
„Aber…“
„Ihre Mutter hat mit der Wahrheit mehr als dreißig Jahre gelebt, nicht wahr? Jetzt sind Sie dran, Brahim.“
Der Professor streckt ihm die Hand entgegen und lacht sein meckerndes Lachen. „Sie müssen mich jetzt bitte entschuldigen, Herr Brahim. Die Pflicht ruft. Ich danke Ihnen für das interessante Gespräch. Vielleicht sehen wir uns ja einmal wieder.“
Brahim sieht zu, wie der Professor das Besucherzimmer verlässt. Dann steht er auf, geht ans Fenster und versucht hinauszusehen, aber er sieht nur die Spiegelung seines eigenen Gesichts. Das Gespräch hat über eine Stunde gedauert, das verrät ihm ein Blick auf die ungerührt rieselnde Sanduhr im Regal. Er setzt sich wieder an den Tisch und blättert unkonzentriert in Adanos’ Friede ist in dir. Eine neue Unruhe wächst in ihm. Die Begegnung mit seinem Vater steht nun unmittelbar bevor… oder besser, mit dem Mörder seines Vaters. Die Konturen dieser Gewissheit, die Brahim seit dem Tod seiner Mutter hat, sind durch die Unterredung mit dem Professor geschärft worden.
Es klopft an der Tür, und Brahim spürt seinen Herzschlag in den Schläfen. Schwester Agostea betritt den Raum.
„Sie sind noch da?“, fragt sie überrascht.
Brahim erhebt sich. „Natürlich.“
„Warum denn?“
„Ich… ich warte auf meinen Vater.“
„Wie bitte?“
„Auf meinen Vater. Ich warte darauf, dass ich mit ihm reden kann.“
Schwester Agostea starrt Brahim an. „Aber Sie haben doch gerade mit ihm gesprochen. Über eine Stunde lang! Ich habe ihn gerade getroffen, als er von hier kam. Es tut mir Leid, dass der Professor nicht zu Ihnen kommen konnte, aber sehen Sie, dieser Zwischenfall vorhin…“
„Ich…“ Weiter kommt Brahim nicht. Wieder sind Schreie irgendwo aus der Anstalt zu hören. Für einen kurzen Moment scheint es Brahim, als würde Schwester Agostea schwanken. Ihre weiße Gestalt zerfließt vor seinen Augen, und Brahim muss unwillkürlich an ein Stück Butter in einer zu heißen Pfanne denken. Dann beginnt der Raum zu schwanken. Es wird dunkel um ihn herum, und Brahim weiß nicht, ob der Schrei, der in seinen Ohren dröhnt, aus dem Inneren der Anstalt oder seinem eigenen Inneren kommt.
Geändert von MiMo (29.03.2017 um 21:53 Uhr)
 Berechtigungen
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
|







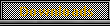



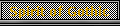










 World of Players
World of Players
 [Story]Die Wahrheit über Brahims Vater
[Story]Die Wahrheit über Brahims Vater









